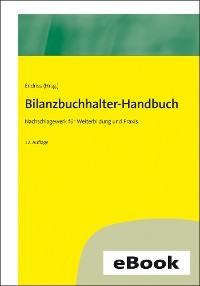Kitabı oku: «Bilanzbuchhalter-Handbuch», sayfa 32
947Einlagen sind nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 Halbsatz 1 EStG für den Regelfall mit dem Teilwert (vgl. Rdn. 1115 ff.) im Zeitpunkt der Zuführung (vgl. BFH v. 9. 6. 1997, BStBl 1998 II S. 307; v. 15. 10. 1997, BStBl 1998 II S. 305) zu bewerten. Höchstwert sind jedoch nach Halbsatz 2 dieser Regelung die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, wenn
 | das Wirtschaftsgut innerhalb der letzten drei Jahre vor der Einlage angeschafft oder hergestellt wurde oder | |||
 | es sich um eine (wesentliche) Beteiligung i. S. des § 17 Abs. 1, 6 EStG an einer Kapitalgesellschaft oder an einer Genossenschaft (vgl. § 17 Abs. 7 EStG) handelt, oder | |||
 | es sich um Wirtschaftsgüter i. S. des § 20 Abs. 2 EStG (zum Begriff vgl. BMF-Schreiben v. 18. 1. 2016, BStBl 2016 I S. 85, Rdn. 9 ff.) handelt. | |||
Wird ein Wirtschaftsgut nach Entnahme aus einem Betriebsvermögen aus dem Privatvermögen in ein anderes Betriebsvermögen eingelegt, gilt nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 3 EStG die Entnahme als Anschaffung, der Entnahmewert als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
948 948 A hat am 15. 7. 2016 aus seinem in Münster betriebenen Einzelunternehmen ein abnutzbares Wirtschaftsgut zum Teilwert von 40 000 € entnommen. Am 3. 5. 2018 legt er dieses Wirtschaftsgut in sein inzwischen in Düsseldorf eröffnetes Einzelunternehmen ein. Für die Bewertung der Einlage vom 3. 5. 2018 gilt die Entnahme am 15. 7. 2016 als Anschaffung, der Entnahmewert von 40 000 € als Anschaffungskosten.
949Bei der Überführung von Wirtschaftsgütern aus dem Privatvermögen in das Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten handelt es sich um keine Einlage, sondern um die entgeltliche Anschaffung der Gesellschaftsrechte (BFH v. 24. 1. 2008, BStBl 2011 II S. 464), vgl. dazu auch BMF-Schreiben v. 11. 7. 2011 (BStBl 2011 I S. 713), modifiziert durch BMF-Schreiben v. 26. 7. 2016 (BStBl 2016 I S. 684). Danach ist § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG in diesen Fällen nicht anwendbar.
950Wird ein Wirtschaftsgut im Privatvermögen angeschafft oder hergestellt und innerhalb von drei Jahren in ein Betriebsvermögen eingelegt, ist es nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 Halbsatz 2 EStG nur dann mit dem Teilwert anzusetzen, wenn dieser niedriger als die Anschaffungs- oder Herstellungskosten ist.
951Handelt es sich um ein abnutzbares Wirtschaftsgut, sind die historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 EStG um die AfA zu kürzen, die auf den Zeitraum zwischen Anschaffung oder Herstellung und Einlage entfällt. Nach dem Urteil des BFH v. 27. 1. 1994 (BStBl II S. 638) ist diese Regelung dahingehend zu verstehen, dass eine Kürzung um die Abschreibungen zu erfolgen hat, die bei einer Nutzung im Privatvermögen bei der Ermittlung zu besteuernder Einkünfte vorgenommen wurden.
952 952 A vermietet seit 2009 eine Ferienwohnung und bezieht daraus Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Die Aufwendungen für die Einrichtungsgegenstände werden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 7 EStG i. V. m. § 7 EStG als AfA berücksichtigt. Anfang Juli 2015 wird eine als einheitliches Wirtschaftsgut zu behandelnde Küchenzeile für 5 000 € angeschafft; die AfA wurde nach einer Nutzungsdauer von 10 Jahren vorgenommen.
Zum 1. 1. 2018 wird A der bisher von seinem Vater geführte Gasthof unentgeltlich übertragen; A führt danach gem. § 6 Abs. 3 EStG die Buchwerte seines Vaters fort (vgl. Rdn. 781 ff.). Die Ferienwohnung wird nunmehr im Rahmen des Gasthofs vermietet und damit notwendiges Betriebsvermögen dieses Gewerbebetriebs. Sie wird damit insgesamt, d. h. Gebäudeteil einschl. des dazu gehörenden Grundstücksteils sowie der Einrichtungsgegenstände, am 1. 1. 2018 in das Betriebsvermögen des Gasthofes eingelegt. Diese Wirtschaftsgüter sind mit Ausnahme der Küchenzeile vor mehr als drei Jahren angeschafft bzw. hergestellt worden, so dass sie jeweils mit dem Teilwert zu bewerten sind. Der Einlagewert der Küchenzeile ist hingegen wie folgt zu ermitteln:
Anschaffungskosten Anfang Juli 20155 000 €
./. AfA 2015 ½ von 10 %250 €
./. AfA 2016 10 %500 €
./. AfA 2017 10 % 500 €
Buchwert 31. 12. 2017
zugleich Einlagewert 1. 1. 20183 750 €
953Eine Kürzung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten um die AfA hat auch dann zu erfolgen, wenn das innerhalb der Dreijahresfrist angeschaffte/hergestellte Wirtschaftsgut im Privatvermögen nicht zur Einkunftserzielung verwendet wurde, wie z. B. ein Pkw oder Teile eines ausschließlich eigengenutzten Einfamilienhauses, die nunmehr betrieblich genutzt werden und deswegen notwendiges Betriebsvermögen geworden sind. Es ist die AfA in der Höhe zu berücksichtigen, die bei einer Nutzung zur Erzielung von Einkünften mindestens abziehbar gewesen wäre.
954Die Regelung des § 6 Abs. 1 Nr. 5 Halbsatz 2 EStG bezieht sich nur auf die Fälle, in denen der Stpfl. selbst die Wirtschaftsgüter innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren vor der Einlage angeschafft hat, zur Ermittlung der Anschaffungskosten bei verbilligtem Erwerb vom Arbeitgeber vgl. das Urteil des BFH v. 9. 12. 2000 (BStBl 2001 II S. 190). Wurde ihm das Wirtschaftsgut hingegen geschenkt, ist die Einlage auch dann mit dem Teilwert zu bewerten, wenn es von dem Schenker innerhalb der Dreijahresfrist entgeltlich angeschafft wurde (BFH v. 14. 7. 1993, BStBl 1994 II S. 15); entsprechendes gilt für ein Gebäude, das ein Unternehmer für seine betrieblichen Zwecke ohne weitergehende Vereinbarungen auf dem Grundstück seines Ehegatten/Lebenspartners errichtet hat, nach Beendigung der Nutzung durch den Unternehmer-Ehegatten/Lebenspartner vom Grundstückseigentümer in ein Betriebsvermögen eingelegt wird (BMF-Schreiben v. 16. 12. 2016, BStBl 2016 I S. 1431).
955Liegt zwischen Anschaffung/Herstellung und Einlage ein Zeitraum von mehr als drei Jahren, ist die Einlage auch dann mit dem Teilwert zu bewerten, wenn bereits die gesamten Aufwendungen bei der Ermittlung der außerhalb eines Betriebsvermögens bezogenen Einkünfte abgezogen wurden (BFH v. 27. 1. 1994, a. a. O.).
956Wurde ein abnutzbares Wirtschaftsgut vor der Einlage bereits im Privatvermögen zur Einkunftserzielung genutzt, ist die AfA gem. § 7 Abs. 1 Satz 5 EStG zu bemessen. Danach ist der Einlagewert nicht in jedem Fall AfA-Bemessungsgrundlage (Rdn. 998 ff.).
957Wird eine im Privatvermögen gehaltene Beteiligung an einer in- oder ausländischen Kapitalgesellschaft oder an einer Genossenschaft veräußert, ist der daraus erzielte Gewinn nach § 17 EStG als Einkünfte aus Gewerbetrieb zu versteuern, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre zu mindestens 1 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt war (vgl. 5. Kap. Teil A Rdn. 220 ff.). Bei vorherigem unentgeltlichem Erwerb der veräußerten Beteiligung ist es ausreichend, wenn der Rechtsvorgänger innerhalb der letzten fünf Jahre zu 1 % beteiligt war. Besonderheiten sind zu beachten, wenn die Anteile aus Anlass eines Umwandlungs- oder Einbringungsvorgangs nach Maßgabe des UmwStG (vgl. 6. Kap. Rdn. 91 ff.) erworben wurden. Die Rechtsfolgen ergeben sich aus den Vorschriften des UmwStG, die auf die Einbringung bzw. die Umwandlung angewendet wurden.
Im Hinblick auf die in der Vergangenheit erfolgten Absenkungen des Schwellenwerts für das Vorliegen einer (wesentlichen) Beteiligung i. S. des § 17 EStG vertritt der BFH (Urteil v. 11. 12. 2012, BStBl 2013 II S. 372; vgl. auch BMF v. 27. 5. 2013, BStBl 2013 I S. 721) die Auffassung, dass das Tatbestandsmerkmal „innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft wesentlich beteiligt” in § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG für jeden abgeschlossenen Veranlagungszeitraum nach der in diesem Veranlagungszeitraum jeweils geltenden Beteiligungsgrenze zu bestimmen ist. Danach kommt die Bewertung der Einlage nach auf § 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 Buchst. b EStG mit den historischen Anschaffungskosten nur dann in Betracht, wenn bei einer Veräußerung des Anteils zum Zeitpunkt der Einlage ein Gewinn nach § 17 EStG zu versteuern wäre.
958Liegt der Teilwert der Beteiligung unter den anzusetzenden historischen Anschaffungskosten, sind nach dem Urteil des BFH v. 2. 9. 2008 (BStBl 2010 II S. 162; beachte BFH v. 26. 6. 2013, BFH/NV 2013 S. 1578) gleichwohl die Anschaffungskosten anzusetzen. Eine anschließende Teilwertabschreibung ist nicht zulässig. Die Wertminderung wird erst bei Ausscheiden der Beteiligung aus dem Betriebsvermögen erfolgswirksam. Die Übertragung einer wertgeminderten Beteiligung auf eine Personengesellschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten führt zu einer Veräußerung der Anteile (vgl. Rdn. 949), so dass insoweit ein Veräußerungsverlust realisiert wird (BMF-Schreiben v. 29. 3. 2000, BStBl 2000 I S. 482).
§ 20 Abs. 2 EStG
959Gewinne aus bestimmten Kapitalanlagen unterliegen bei Zugehörigkeit zum Privatvermögen gem. § 20 Abs. 2 EStG (vgl. Rdn. 9 ff. des BMF-Schreibens v. 18. 1. 2016, BStBl 2016 I S. 85) als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Abgeltungsteuer (§ 32d EStG; 5. Kap. Teil A Rdn. 251 ff.). Die Einlage derartiger Kapitalanlagen in ein Betriebsvermögen hat gem. § 6 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. c EStG mit dem Teilwert höchstens jedoch mit den Anschaffungskosten zu erfolgen. Damit sind die daraus erzielten Einkünfte als Bestandteil des aus dem Betrieb erzielten Gewinns nach allgemeinen Grundsätzen zu besteuern.
960Begrifflich liegt eine Entnahme auch dann vor, wenn ein Stpfl. ein Wirtschaftsgut aus einem Betriebsvermögen in ein anderes ihm zuzurechnendes Betriebsvermögen überführt (R 4.3 Abs. 1 EStR). Die Überführung von Wirtschaftsgütern zwischen in- und ausländischen Betriebsstätten hat der Gesetzgeber Entnahmen und Einlagen gleichgestellt (vgl. Rdn. 115 ff.), die zu einer Aufdeckung der stillen Reserven führen. Aus Anlass der Überführung von Wirtschaftsgütern zwischen inländischen Betriebsvermögen desselben Stpfl. kommt hingegen eine Aufdeckung der stillen Reserven unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 5 EStG nicht in Betracht. Für die Fälle der Beendigung einer Personengesellschaft unter Aufteilung des Betriebsvermögens auf die bisherigen Gesellschafter – Realteilung – und Überführung der so erlangten Wirtschaftsgüter in ein Betriebsvermögen kann unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 3 Satz 2 bis 4 EStG auf die Aufdeckung der stillen Reserven verzichtet werden (vgl. dazu auch BMF-Schreiben v. 20. 12. 2016, BStBl 2017 I S. 36; beachte BFH v. 16. 3. 2014 – IV R 31/14, NWB DokID: FAAAG-48085, und v. 30. 3. 2017 – IV R 11/15, NWB DokID: LAAAG-48083).
961In den Fällen des § 6 Abs. 5 EStG hat der abgebende Betrieb das ausscheidende Wirtschaftsgut mit seinem Buchwert auszubuchen, der aufnehmende Betrieb hat es dementsprechend mit diesem Wert einzubuchen. Voraussetzung ist, dass die Besteuerung der danach auf den anderen Betrieb übergehenden stillen Reserven gesichert ist. Dies ist immer der Fall, wenn auch der Gewinn dieses Betriebes uneingeschränkt der inländischen Besteuerung unterliegt. Der übernehmende Betrieb führt damit den Buchwert des abgebenden Betriebs fort. Damit ist auch die AfA in der vom abgebenden Betrieb vorgenommenen Weise fortzuführen.
962 962 A überführt aus seinem inländischen Bauunternehmen einen Pkw in seinen als gesonderten Betrieb im Inland geführten Baumaschinenhandel. Der Buchwert beträgt 30 000 €, der Teilwert 40 000 €. Der Pkw ist gem. § 6 Abs. 5 Satz 1 EStG beim Bauunternehmen mit 30 000 € aus- und beim Baumaschinenhandel mit 30 000 € einzubuchen. Die Aufdeckung der stillen Reserven ist ausgeschlossen.
963Nach § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG ist ferner auf die Aufdeckung stiller Reserven zu verzichten, soweit ein Wirtschaftsgut
 | unentgeltlich oder gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten aus einem Betriebsvermögen des Mitunternehmers in das Gesamthandsvermögen einer Mitunternehmerschaft, | |||
 | unentgeltlich oder gegen Minderung von Gesellschaftsrechten aus dem Gesamthandsvermögen einer Mitunternehmerschaft in ein Betriebsvermögen des Mitunternehmers, | |||
 | unentgeltlich oder gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten aus dem Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers in das Gesamthandsvermögen derselben Mitunternehmerschaft oder einer anderen Mitunternehmerschaft, an der er beteiligt ist, | |||
 | unentgeltlich oder gegen Minderung von Gesellschaftsrechten aus dem Gesamthandsvermögen einer Mitunternehmerschaft in das Sonderbetriebsvermögen eines Mitunternehmers bei derselben Mitunternehmerschaft oder das Sonderbetriebsvermögen dieses Mitunternehmers bei einer anderen Mitunternehmerschaft, | |||
 | unentgeltlich zwischen den jeweiligen Sonderbetriebsvermögen derselben Mitunternehmerschaft | |||
übertragen wird. Es handelt sich um eine abschließende Aufzählung; dazu zu beachten BFH v. 19. 9. 2012 – IV R 11/12 (BFH/NV 2012 S. 1880).
Mitunternehmer i. S. der vorstehenden Ausführungen können auch Körperschaften, insbesondere Kapitalgesellschaften, sowie auch – wie bei den sog. doppelstöckigen Personengesellschaften – Personengesellschaften sein (BMF-Schreiben v. 7. 2. 2002, StuB 2002 S. 344). Weiter ist zu beachten, dass die Einbringung von Wirtschaftsgütern in eine Mitunternehmerschaft gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten nach § 6 Abs. 6 Satz 4 EStG nicht als ein Tausch i. S. dieser Regelung zu verstehen ist, sondern dass insoweit nach § 6 Abs. 5 EStG zu verfahren und damit auf die Aufdeckung der stillen Reserven zu verzichten ist. Zu den Voraussetzungen, unter denen von einer unentgeltlichen Übertragung bzw. einer Übertragung gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten auszugehen ist, hat das BMF in seinen Schreiben v. 8. 12. 2011 (BStBl 2011 I S. 1279) und v. 12. 9. 2013 (BStBl 2013 I S. 1164) Stellung genommen. Hinsichtlich Zweifelsfragen zur Übertragung und überführung von einzelnen Wirtschaftsgütern wird auf OFD Frankfurt v. 11. 10. 2013 – S 2241 A – 117 – St verwiesen. Diese Ausführungen stehen teilweise im Widerspruch zur Rechtsprechung des BFH. Überträgt ein Mitunternehmer seinen Anteil unentgeltlich und überführt er gleichzeitig ein Wirtschaftsgut seines Sonderbetriebsvermögens in ein anderes, ihm zuzurechnendes Betriebsvermögen, kommt – entgegen der Auffassung der FinVerw – im Regelfall sowohl hinsichtlich des Mitunternehmeranteils nach § 6 Abs. 3 EStG, als auch hinsichtlich des Wirtschaftsguts seines Sonderbetriebsvermögens nach § 6 Abs. 5 EStG eine Aufdeckung der stillen Reserven nicht in Betracht (BFH v. 2. 8. 2012 – IV R 41/11, NWB DokID: TAAAE-19933).
964Nach dem BMF-Schreiben v. 12. 9. 2013 (BStBl 2013 I S. 1164, so bereits Tz. 16 des Schreibens v. 8. 12. 2011, BStBl 2011 I S. 1279) liegt ein unentgeltlicher Erwerb nur vor, wenn keine Gegenleistung gewährt wird. Demgegenüber liegt nach Auffassung des BFH ein unentgeltlicher Erwerb auch dann vor, wenn das Teilentgelt den Buchwert des Wirtschaftsgutes nicht erreicht (Urteile v. 21. 6. 2012 – IV R 1/08, BFH/NV 2012 S. 1536; v. 19. 9. 2012 – IV R 11/12, BFH/NV 2012 S. 1880). Eine Klärung wird durch ein weiteres Revisionsverfahren vor dem BFH erwartet (vgl. Beschluss v. 19. 3. 2014, BStBl 2014 II S. 629).
Weiter ist umstritten, ob die unentgeltliche Übertragung eines Wirtschaftsgutes in ein anderes Betriebsvermögen in zeitlichem Zusammenhang mit einer unentgeltlichen Übertragung des Betriebs, eines Mitunternehmeranteils i. S. des § 6 Abs. 3 EStG zulässig ist (BFH v. 2. 8. 2012, DStR 2012 S. 2118; v. 18. 9. 2013 – X R 42/10, BFH/NV 2013 S. 2006; BMF-Schreiben v. 12. 9. 2013, a. a. O.).
Die unentgeltliche Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter in ein anderes Betriebsvermögen im Zusammenhang mit der Veräußerung des danach verbleibenden Betriebs, Mitunternehmeranteils kann der Anwendung des § 16 EStG auf den insoweit erzielten Veräußerungsgewinn entgegenstehen (BFH v. 6. 9. 2000, BStBl 2001 II S. 229).
965Nach dem Urteil des BFH v. 25. 11. 2009 (BStBl 2010 II S. 471) führt die unentgeltliche Überführung eines Wirtschaftsgutes aus dem Betriebsvermögen einer gewerblich tätigen Personengesellschaft in das Betriebsvermögen einer beteiligungsidentischen anderen Personengesellschaft zur Aufdeckung der in dem Wirtschaftsgut ruhenden stillen Reserven. Der IV. Senat des BFH hält dies für zweifelhaft (Beschluss v. 15. 4. 2010, BStBl 2010 II S. 971). Der I. Senat des BFH hat dem BVerfG die Frage vorgelegt, ob § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG insoweit gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstößt, als hiernach eine Übertragung von Wirtschaftsgütern zwischen beteiligungsidentischen Personengesellschaften nicht zum Buchwert möglich ist (Beschluss v. 10. 4. 2013, BStBl 2013 II S. 1004, Az. BVerfG 2 BvL 8/13). Nach dem BMF-Schreiben v. 29. 10. 2010 (BStBl 2010 I S. 1206) kann bei Rechtsbehelfsverfahren Aussetzung der Vollziehung gewährt werden.
966Geht man in Abwandlung des vorstehenden Beispiels 66 davon aus, dass A die Wirtschaftsgüter in die X-GmbH & Co. KG, an der er als alleiniger Kommanditist beteiligt ist, überführt, sind die Buchwerte des Einzelunternehmens unabhängig davon fortzuführen, ob die Einbringung in das Gesamthandsvermögen der KG oder aber in sein Sonderbetriebsvermögen erfolgt. Eine Aufdeckung der stillen Reserven kommt u. a. auch dann nicht in Betracht, wenn ein Wirtschaftsgut aus dem Sonderbetriebsvermögen in ein anderes Betriebsvermögens des Mitunternehmers überführt wird.
967 967 A ist Kommanditist der X-GmbH & Co. KG, der er ein Grundstück vermietet hat. Dieses Grundstück gehört damit zu seinem Sonderbetriebsvermögen bei der X-GmbH & Co. KG (vgl. 5. Kap. Teil A Rdn. 113). Das Mietverhältnis wird gelöst.
| a) | A nutzt das Grundstück nunmehr für eigengewerbliche Zwecke. Das Grundstück ist mit seinem Buchwert aus dem Sonderbetriebsvermögen des A aus- und mit diesem Wert bei dem Einzelunternehmen des A einzubuchen. | |||
| b) | A überlässt das Grundstück nunmehr der Y-GmbH & Co. KG, an der er ebenfalls als Kommanditist beteiligt ist. Das Grundstück wird damit Sonderbetriebsvermögen des A bei der Y-GmbH & Co. KG. Es ist mit seinem Buchwert aus dem Sonderbetriebsvermögen des A der X-GmbH & Co. KG aus- und mit diesem Wert bei dem Sonderbetriebsvermögen des A bei der Y-GmbH & Co. KG einzubuchen. | |||
968Im Übrigen wird eine unentgeltliche Übertragung aus einem Betriebsvermögen in ein anderes Betriebsvermögen immer nur dann erfolgen, wenn dadurch der Vermögensstand des betreffenden Unternehmers (Mitunternehmers) nicht beeinträchtigt wird oder aber wenn damit eine unentgeltliche Vermögensübertragung auf nahe stehende Personen, z. B. im Interesse der Heranführung der nachfolgenden Generation an das Unternehmen, erfolgen soll.
969 969
| a) | VA ist alleiniger Kommanditist der X-GmbH & Co. KG sowie alleiniger Gesellschafter der Komplementär GmbH, die am Vermögen der KG nicht beteiligt ist. Die KG betreibt ihr Unternehmen auf einem Grundstück, das ihr von A gegen Pachtzahlung überlassen wird. Das Grundstück gehört deswegen zum Sonderbetriebsvermögen I des A bei der KG (vgl. 5. Kap. Teil A Rdn. 113). A überträgt das Grundstück unentgeltlich auf die KG. Im Ergebnis wird der Vermögensstand des A durch diese Übertragung nicht beeinträchtigt. | |||
| b) | Abwandlung des Sachverhalts zu a) dahingehend, dass neben VA seine Kinder SA und TA weitere Kommanditisten sind. Mit der Übertragung des Grundstücks in das Gesamthandsvermögen geht im Ergebnis ein Teil des väterlichem Vermögens auf die Kinder über. | |||
| c) | Abweichend von dem Sachverhalt zu b) überträgt VA das Grundstück nicht in das Gesamthandsvermögen der KG, sondern auf SA und TA je zur Hälfte. Das Grundstück wird infolge der unveränderten Nutzung durch die KG Sonderbetriebsvermögen I von SA und TA. | |||
970Wird das zum Buchwert übertragene Wirtschaftsgut innerhalb einer Sperrfrist von drei Jahren nach Abgabe der Steuererklärung des Übertragenden (in den Fällen des Beispiel 66a des A, in den Fällen der Beispiele 67 und 68 der X-GmbH & Co. KG) für das Jahr, in dem die Übertragung erfolgte, veräußert oder entnommen, ist nach § 6 Abs. 5 Satz 4 EStG rückwirkend auf den Zeitpunkt der Übertragung der Teilwert anzusetzen. Nach R 6.15 EStR ist der Teilwert des veräußerten Wirtschaftsgutes auch dann rückwirkend zum Übertragungszeitpunkt anzusetzen, wenn die bis zur Übertragung entstandenen stillen Reserven durch Erstellung einer Ergänzungsbilanz dem übertragenden Gesellschafter zugeordnet worden sind, durch die Übertragung jedoch keine Änderung des Anteils des übertragenden Gesellschafters an dem übertragenen Wirtschaftsgut eingetreten ist. Der BFH folgt dieser Auffassung dann nicht, wenn der Übertragende bei Überführung und bei der späteren Veräußerung des Wirtschaftsgutes unverändert zu 100 % beteiligt ist (Urteile v. 31. 7. 2013 – I R 44/12, BFH/NV 2013 S. 1855; v. 26. 6. 2014, BStBl 2015 II S. 463).
Die Sperrfrist endet drei Jahre nach Abgabe der Steuererklärung des Übertragenden für den Veranlagungszeitraum, in dem die betreffende Übertragung erfolgt ist. Wegen weiterer Einzelheiten vgl. Tz. 22 ff. BMF-Schreiben v. 8. 12. 2011 (BStBl 2011 I S. 1279).
971Nach § 6 Abs. 5 Satz 5 EStG ist dagegen die Aufdeckung der stillen Reserven erforderlich, sofern und soweit aus Anlass der Überführung des Wirtschaftsguts stille Reserven auf eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse übergehen. Dies wäre z. B. der Fall, wenn im Beispiel 68, Sachverhaltsvariante a), an der X-GmbH & Co. KG neben VA eine Kapitalgesellschaft als Kommanditistin beteiligt wäre. Die Regelung des § 6 Abs. 5 Satz 5 EStG greift dann nicht ein, wenn die übertragende Kapitalgesellschaft zu 100 % an Gewinn und Vermögen der Mitunternehmerschaft beteiligt ist. (Ziff. 2 BMF-Schreiben v. 7. 2. 2002, StuB 2002 S. 344). Auf die Erläuterungen in Tz. 28 ff. des BMF-Schreibens v. 8. 12. 2011 (BStBl 2011 I S. 1279) anhand mehrerer Beispiele wird hingewiesen.
972Stille Reserven sind nach § 6 Abs. 5 Satz 6 EStG dann rückwirkend auf den Zeitpunkt der Überführung des Wirtschaftsguts aufzudecken, soweit sie innerhalb von sieben Jahren auf eine Körperschaft oder dgl. übergehen. Dies wäre z. B. der Fall, wenn im Beispiel 68, Sachverhalt a), innerhalb dieses Zeitraums der X-GmbH & Co. KG eine Kapitalgesellschaft als weitere Kommanditistin beitreten würde. Entsprechendes hat zu gelten, wenn sich innerhalb des Siebenjahreszeitraums der Anteil einer Kapitalgesellschaft an den stillen Reserven durch Änderung der Beteiligungsverhältnisse erhöht. Mit diesen Regelungen soll erreicht werden, dass keine stillen Reserven auf die Kapitalgesellschaft übergehen, die bei einer wie auch immer gearteten Aufdeckung in die nur teilweise Besteuerung nach § 3 Nr. 40 EStG einfließen könnten.
973Für geringwertige Wirtschaftsgüter, d. h. einer selbständigen Nutzung fähigen abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Zugangswerte bestimmte Schwellenwerte nicht übersteigen, kann eine Bewertungsfreiheit unter den folgenden Voraussetzungen beansprucht werden:
 | Bei einem Zugangswert von nicht mehr als 250 € ist statt der Vornahme der AfA nach § 7 EStG der sofortige Abzug als Betriebsausgaben zulässig. Die Aufnahme in das Inventarverzeichnis oder weitergehende Aufzeichnungen sind nicht erforderlich (§ 6 Abs. 2 EStG). | |||
 | Bei einem Zugangswert von mehr als 250 € aber nicht mehr als 800 € ist statt der Vornahme der AfA nach § 7 EStG der sofortige Abzug als Betriebsausgaben zulässig. Für diesen Fall sind die Wirtschaftsgüter unter Angabe des Tags des Zugangs und des Zugangswerts in einem besonderen Verzeichnis auszuweisen, sofern diese Angaben nicht aus der Buchführung ersichtlich sind (§ 6 Abs. 2 EStG). | |||
 | Bei einem Zugangswert von mehr als 250 € aber nicht mehr als 1 000 € ist statt der Vornahme der AfA nach § 7 EStG die Aufnahme in einen Sammelposten möglich, der im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils 1/5 gewinnmindernd aufzulösen ist. Für diesen Fall können die Aufwendungen für Wirtschaftsgüter mit einem Zugangswert von mehr als 250 € aber nicht mehr als 800 € nicht als sofort abziehbare Betriebsausgaben behandelt werden (§ 6 Abs. 2a EStG). | |||
Das danach bestehende Wahlrecht kann für die Zugänge eines Wirtschaftsjahres nur einheitlich ausgeübt werden (R 6.13 Abs. 5 EStR).
Im Rahmen der Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft nach Durchschnittssätzen gem. § 13a EStG wird für nach dem 30. 12. 2015 endende Wirtschaftsjahre die Anwendung von § 6 Abs. 2 und 2a EStG durch § 13a Abs. 3 EStG ausdrücklich ausgeschlossen.
974–975 Einstweilen frei
976Für im Privatvermögen zur Einkunftserzielung genutzte Wirtschaftsgütern, z. B. zur Erzielung von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung, ist der Höchstwert von 800 € maßgebend (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG).
977Die vorstehend erörterten Regelungen sind ausnahmslos auf bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzungsfähig sind, anwendbar. Nicht darunter fallen unbewegliche Wirtschaftsgüter und immaterielle Wirtschaftsgüter. Wegen Einzelheiten vgl. dazu R 6.13 Abs. 1 EStR sowie die in H 6.13 EStH aufgeführten Beispiele, ferner BFH v. 3. 8. 2016 – IX R 14/15 (BFH/NV 2017 S. 184) zu einer Einbauküche.
978Wegen der Bestimmung des Zeitpunkts der Anschaffung oder der Herstellung vgl. Rdn. 1036 ff.
979Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind nach den allgemeinen Grundsätzen zu bestimmen (Rdn. 758 ff., 805 ff.). Der an deren Stelle tretende Wert ergibt sich nach Kürzung um die Übertragung stiller Reserven nach §§ 6b oder 6c EStG (vgl. Rdn. 1270 ff.), um den Investitionsabzugsbetrag i. S. des § 7g Abs. 2 Satz 2 EStG (vgl. Rdn. 1224 ff.), um einen Zuschuss nach R 6.5 EStR (vgl. Rdn. 1311 ff.) oder um eine Rücklage für Ersatzbeschaffung nach R 6.6 EStR (vgl. Rdn. 1262 ff.), Bei der Einlage von Wirtschaftsgütern aus dem Privatvermögen ist der nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 oder 6 EStG zu ermittelnde Wert (vgl. Rdn. 947 ff.) maßgebend.
980Wird ein Wirtschaftsgut i. S. des § 6 Abs. 2 oder 2a EStG teilweise für private Zwecke genutzt, ist für die Dauer der Privatnutzung ein entsprechender Privatanteil zu berücksichtigen (H. 6. 13 [Private Mitbenutzung] EStH).
981Fallen in einem folgenden Wirtschaftsjahr nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten an, ist zu differenzieren:
 | Wurde der Aufwand für das betreffende Wirtschaftsgut im Vorjahr in voller Höhe als Betriebsausgabe abgezogen, sind die nachträglichen Aufwendungen im Folgejahr auch dann sofort als Betriebsgaben abziehbar, wenn der Aufwand für das betreffende Wirtschaftsgut insgesamt den maßgebenden Schwellenwert überschreitet (R 6.13 Abs. 4 EStR). | |||
 | Ist der Aufwand für das betreffende Wirtschaftsgut im Vorjahr dem Sammelposten zugeführt worden, sind die nachträglichen Aufwendungen im Folgejahr auch dann dem für das Folgejahr zu bildenden Sammelposten zuzuführen, wenn der Aufwand für das betreffende Wirtschaftsgut insgesamt den maßgebenden Schwellenwert überschreitet (R 6.13 Abs. 5 EStR). Wird für die Zugänge des Folgejahres in Ausübung des ab 2010 bestehenden Wahlrechts auf die Bildung eines Sammelpostens verzichtet, ist lediglich für die nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten ein neuer Sammelposten für dieses Wirtschaftsjahr zu bilden (Rdn. 10 BMF-Schreiben v. 30. 9. 2010, BStBl I S. 755). | |||
982Der Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG ist für jedes Wirtschaftsjahr gesondert zu führen. Es handelt es sich lediglich um eine „Rechengröße”, die z. B. einer Teilwertabschreibung nicht zugänglich ist. Das vorzeitige Ausscheiden einzelner Wirtschaftsgüter aus dem Betriebsvermögen ist dementsprechend bei der Fortschreibung des Sammelpostens nicht zu berücksichtigen. Die erfolgswirksame Erfassung eines etwaigen Veräußerungserlöses oder eines Entnahmewerts wird dadurch nicht berührt. Vgl. dazu auch R 6.13 Abs. 6 EStR, Rdn. 8, 14 BMF-Schreiben v. 30. 9. 2010 (a. a. O.).
983Der Sammelposten ist im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit je 1/5 erfolgswirksam aufzulösen. Dies gilt auch für Rumpfwirtschaftsjahre. Bei Veräußerung oder Aufgabe des Betriebs mindert der zum Zeitpunkt der Veräußerung/Aufgabe ggf. noch verbliebene Sammelposten den Veräußerungs- oder Aufgabegewinn (Rdn. 15 BMF-Schreiben v. 30. 9. 2010, BStBl I S. 755). Bei einer Realteilung einer Personengesellschaft i. S. des § 16 Abs. 3 Satz 2 bis 4 EStG sind die Sammelposten des Gesamthandsvermögens entsprechend der Beteiligung am Betriebsvermögen der Mitunternehmerschaft bei den einzelnen Mitunternehmern fortzuführen. Sammelposten des Sonderbetriebsvermögens sind unmittelbar bei den einzelnen Mitunternehmern planmäßig aufzulösen.
Auf den Sammelposten sind keine Sonderabschreibungen nach § 7g Abs. 5 EStG zulässig (FG München v. 19. 12. 2013 – 10 K 1076/12, NWB DokID: XAAAE-56402).
984Bei der Übertragung des gesamten Betriebs zum Buchwert hat der übernehmende Rechtsträger die jeweiligen Sammelposten fortzuführen. Wird ein Betrieb nur teilweise übertragen, verbleiben die Sammelposten beim bisherigen Rechtsträger. Überträgt ein Stpfl. einzelne im Sammelposten erfasste Wirtschaftsgüter in einen von ihm ebenfalls geführten Betrieb, berührt dies die Führung der Sammelposten in beiden Betrieben nicht. Wegen weiterer Einzelheiten vgl. R 6.13 Abs. 6 EStR sowie Rdn. 22 ff. BMF-Schreiben v. 30. 9. 2010 (a. a. O.).
985–990 Einstweilen frei
991Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind nach § 253 Abs. 3 Satz 1 HGB mit den um die planmäßigen Abschreibungen verminderten Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bewerten. Dadurch sollen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach einem vorbestimmten Plan auf die Geschäftsjahre der voraussichtlichen Nutzung verteilt werden (§ 253 Abs. 3 Satz 2 HGB). Kann in Ausnahmefällen die voraussichtliche zeitliche Nutzung eines selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstands des Anlagevermögens nicht verlässlich geschätzt werden, sind nach der durch das BilRUG geplanten Ergänzung des § 253 Abs. 3 HGB bei Zugang des Vermögensgegenstandes nach dem 31. 12. 2015 die planmäßigen Abschreibungen über einen Zeitraum von zehn Jahren vorzunehmen. Dies soll für entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwerte, die aus Erwerbsvorgängen herrühren und in nach dem 31. 12. 2015 beginnenden Geschäftsjahren erfolgten, entsprechend gelten. Weitere Einzelheiten zur Bestimmung der planmäßigen Abschreibungen sowie den dabei zulässigen Methoden enthalten die handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften nicht. Insoweit sind die nicht kodifizierten GoB maßgebend.