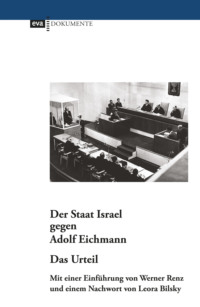Kitabı oku: «Der Staat Israel gegen Adolf Eichmann. Das Urteil», sayfa 7
Aber das Volk ist ein Volk, und das Verbrechen ist ein Verbrechen. Das dem Angeklagten zur Last gelegte Verbrechen ist »die Tötung von Millionen Juden mit dem Vorsatz, das jüdische Volk zu vernichten.« Sowohl der heute im Staate Israel ansässige jüdische Jischuv wie auch der seinerzeit in Palästina (»Erez Israel«) ansässige jüdische Jischuv bildet einen Teil des jüdischen Volkes, das der Angeklagte, gemäß der Anklageschrift, auszurotten bestrebt war. Mag auch dieser Teil des Volkes gerettet worden sein, so war auch er in Gefahr, ausgerottet zu werden. Die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs haben das bewiesen. Jedenfalls war die Vernichtung der europäischen Juden, die mit dem Vorsatz der Vernichtung des jüdischen Volkes ausgeführt wurde, nicht nur gegen die Juden gerichtet, die tatsächlich vernichtet wurden, sondern gegen das gesamte jüdische Volk, einschließlich den jüdischen Jischuv in Palästina. Um ein Gleichnis zu benutzen: Wer einem Baum Wurzel und Zweige absägt, wollte er dann dem Stamme sagen: Nicht Dich habe ich verletzt?
Dieses Verbrechen verletzte die »vitalen Interessen« des Staates Israel, und aufgrund des »Schutzprinzips« ist der Staat Israel zuständig, die Verbrecher zu bestrafen. Ferner, die in diesem Gesetz des Staates Israel behandelten Taten gehen ihn mehr an als andere Staaten (Dahm), und daher besteht ein »Anknüpfungspunkt« auch nach Auffassung dieses Verfassers. Die Bestrafung der nationalsozialistischen Verbrecher hat ihren Ursprung nicht in der Willkür eines Staates, der seine Hoheitsgewalt mißbraucht, sondern in der rechtmäßigen und vernünftigen Ausübung seiner Strafhoheit.
Ein Volk, das straflos ausgerottet werden kann, ist gefährdet, und man braucht nicht »seine Ehre und seine Autorität« (Grotius) zu erwähnen. Das war ja der Fluch der Diaspora und des Fehlens der Hoheitsgewalt des jüdischen Volkes, daß jeder Verbrecher es überfallen konnte, ohne befürchten zu müssen, daß er von dem betroffenen Volk bestraft werde. Hitler und seine Helfer nützten die wehrlose Situation des zerstreuten jüdischen Volkes aus, um es kaltblütig zu vernichten. Auch damit wenigstens etwas das furchtbare Unrecht der Katastrophe wiedergutgemacht werde, wurde auf Empfehlung der Vereinten Nationen der souveräne Judenstaat gegründet, und dieser gibt dem »Rest der Geretteten« die Möglichkeit, mit staatlichen Mitteln seinen Fortbestand zu behaupten. Eines dieser Mittel ist die Bestrafung der Mörder, die Hitlers Arbeit getan haben. Zu diesem Zweck wurde das vorliegende Gesetz erlassen.
36. Der Verteidiger behauptete, daß das Schutzprinzip auf dieses Gesetz nicht anwendbar sei, da dieses Prinzip nur bestehende Staaten, ihre Existenz und Interessen, schütze und da zur Zeit der Ausführung der vorliegenden strafbaren Handlungen der Staat noch nicht bestanden habe. Dasselbe gilt auch, seiner Behauptung zufolge, in bezug auf das Prinzip der passiven Personalität, das vom Schutzprinzip abgeleitet ist und einer Anzahl Staaten zum Schutze ihrer im Ausland befindlichen Angehörigen durch ihre Strafgesetzgebung dient. Der Verteidiger weist darauf hin, daß angesichts des Nichtbestehens eines unabhängigen jüdischen Staates zur Zeit der Katastrophe die Opfer der Nationalsozialisten zur Zeit ihrer Ermordung nicht israelische Staatsangehörige waren.
Wir sind der Auffassung, daß der Verteidiger sich irrt, wenn er das Schutzprinzip in diesem rückwirkenden Gesetz gemäß dem Zeitpunkte der Begehung der strafbaren Handlungen prüft, wie es im Falle eines gewöhnlichen Gesetzes üblich ist. Dieses Gesetz wurde im Jahre 1950 erlassen mit der Maßgabe, daß es Anwendung finde auf einen bestimmten Zeitabschnitt, der 5 Jahre vor seinem Erlasse abgelaufen war. Das Schutzinteresse des Staates, das durch das Schutzprinzip anerkannt ist, ist in diesem Falle das zur Zeit des Erlasses des Gesetzes bestehende Interesse. Wir haben bereits die bedeutende Aufgabe hervorgehoben, die dieses Gesetz sowohl vom moralischen, wie auch vom Sicherheitsstandpunkte im Staate Israel zu erfüllen hat.
37. Die rückwirkende Anwendung des Gesetzes auf einen Zeitabschnitt vor der Staatsgründung stellt in bezug auf den Angeklagten (und das bezieht sich auf jeden Angeklagten aufgrund dieses Gesetzes) kein Problem dar, das in irgendeiner Weise von der üblichen Retroaktivität verschieden ist, und das Problem haben wir bereits früher behandelt. Goodhart »The legality of the Nürnberg Trials«, Juridical Review, April 1946, sagt unter anderem (Seite 8):
»Many of the national courts now functioning in the liberated countries have been established recently, but no one has argued that they are not competent to try the cases that aróse before their establishment… No defendant can complain that he is being tried by a Court which did not exist when he committed the act.«
Was hier über ein zur Zeit der Begehung der strafbaren Handlung noch nicht bestehendes Gericht gesagt wurde, gilt auch für einen Staat, der zur Zeit der Ausführung noch nicht unabhängig war. Der gesamte politische Aspekt des okkupierten europäischen Kontinents hat sich nach dem Kriege grundlegend geändert. Die Grenzen änderten sich, und auch die Identität der bestehenden Staaten änderte sich. Aber all das betrifft den Angeklagten nicht.
38. Aber ist (von dem Angeklagten abgesehen) ein neuer Staat überhaupt zuständig, Verbrechen abzuurteilen, die vor seiner Gründung verübt wurden? Die Antwort auf diese Frage wurde im Strafberufungsfall Katz-Cohn gegen den Generalstaatsanwalt (Strafberufungsfall 3/48, Pesakim Band 2, S. 225) erteilt. Es wurde dort entschieden, daß die israelischen Gerichte volle Zuständigkeit haben, strafbare Handlungen abzuurteilen, die vor Staatsgründen begangen wurden, und daß »Kontinuität des Rechts trotz des Hoheitswechsels« bestehe; »es ist nicht zu ersehen«, sagt der Präsident Smoira, »warum die Bevölkerung eines Landes, gegen die ein Verbrechen verübt wurde, nicht die Bestrafung des Verbrechers verlangen könnte, weil bezüglich derselben Bevölkerung inzwischen die israelische Regierung an Stelle der der Mandatsregierung getreten ist.« Diese Worte bezogen sich auf eine strafbare Handlung, die hierzulande begangen wurde, es besteht jedoch kein Grund zur Annahme, daß das Recht in bezug auf eine ausländische strafbare Handlung anders sein sollte. Falls der mandatorische Gesetzgeber seinerzeit ein extraterritoriales Gesetz zur Bestrafung der Kriegsverbrecher erlassen hätte (wie es z. B. der australische Gesetzgeber im Kriegsverbrechergesetz des Jahres 1945 – siehe besonders Paragraph 12 – getan hat, würde es selbstverständlich sein, daß das israelische Gericht zuständig ist, aufgrund eines solchen Gesetzes Verbrechen, die im Auslande noch vor Staatsgründung begangen wurden, abzuurteilen. Das Kontinuitätsprinzip findet auch auf die legislatorische Zuständigkeit Anwendung. Der israelische Gesetzgeber ist berechtigt, retroaktive Mandatsgesetzgebung abzuändern oder zu vervollständigen durch Erlaß von Gesetzen, die auf strafbare Handlungen, die vor der Staatsgründung ausgeführt worden sind, Anwendung finden sollen.
Dieses retroaktive Gesetz verfolgt den Zweck, eine Lücke in den mandatspalästinensischen Gesetzen auszufüllen, und das durch dieses Gesetz geschützte Interesse bestand auch zur Zeit des Nationalheims. Die Balfour-Deklaration und das Palästina-Mandat, das Großbritannien vom Völkerbund verliehen wurde, stellten eine internationale Anerkennung des jüdischen Volkes dar (siehe N. Feinberg: »The Recognition of the Jewish People in International Law« Jewish Yearbook of International Law 1948, Seite 15 und die dort angegebenen Quellen) wie auch eine Anerkennung der historischen Verbindung des jüdischen Volkes mit Erez Israel (Palästina) und die Anerkennung seines Rechts, sein Nationalheim in diesem Lande wieder aufzubauen. Das jüdische Volk hat dieses Recht de facto ausgeübt, und das Nationalheim wuchs und entwickelte sich, bis es den Souveränitätsstatus erreichte. Im Zeitabschnitt vor der Gründung des unabhängigen Staates konnte das Nationalheim als »nasciturus pro jam nato habetur« angesehen werden (siehe Feinberg ibid.). Der jüdische Jischuv in Erez Israel (Palästina) stellte zu jener Zeit einen »Staat im Werden« dar, der zum gegebenen Zeitpunkt den Souveränitätsstatus erreichte. Der Mangel der Souveränität ermöglichte es dem jüdischen Jischuv im Lande nicht, ein Strafgesetz gegen die Verbrechen der Nationalsozialisten zu erlassen, als diese Verbrechen verübt wurden; aber die Verbrechen waren auch gegen diesen Jischuv gerichtet, der einen integralen Bestandteil des jüdischen Volkes bildete. Der rückwirkende Erlaß des vorliegenden Gesetzes durch den Staat Israel entsprach der bereits vorher vorhandenen Notwendigkeit.
Die geschichtlichen Tatsachen erhellen den Hintergrund dieser Gesetzgebung. Vom rechtlichen Standpunkte aus sind wir jedoch der Auffassung, daß die legislatorische Zuständigkeit des neuen Staates zu retroaktiver Gesetzgebung nicht nur speziell von diesem Hintergründe abhängt und nicht einmal von der Rechtskontinuität zwischen Palästina und Israel bedingt ist. Wir wollen ein krasses Beispiel geben und annehmen, daß die übriggebliebenen Zigeuner, eine ethnische Gruppe oder ein Volk, welches, gleichfalls, dem jüdischen Volke ähnlich, ein Opfer des Verbrechens des »Völkermords« war, hätten sich nach dem Kriege gesammelt und in irgendeinem Teile der Welt einen unabhängigen Staat gegründet. Es will uns scheinen, daß kein Grundsatz des Völkerrechtes dem neu gegründeten Staate die natürliche Zuständigkeit der Aburteilung der Vernichter ihres Volkes, soweit er ihrer habhaft werden könnte, abgesprochen hätte. Die Strafhoheit der verletzten Gruppe rührt unmittelbar, wie von Grotius (infra) erklärt, aus den gegen sie vom Täter begangenen Verbrechen her und nur der Mangel der Souveränität entzieht ihr die Aburteilungs- und Bestrafungszuständigkeit. Wenn die verletzte Gruppe oder das verletzte Volk nachher politische Unabhängigkeit in irgendeinem Territorium erlangt, ist es berechtigt, seine Hoheitsgewalt anzuwenden, um die ihm von Natur aus zustehende Strafhoheit gegenüber dem Täter, der es verletzt hat, auszuüben.
Dies bezieht sich auf das Verbrechen des Völkermordes (einschließlich des Verbrechens gegen das jüdische Volk), das zwar durch Tötung von Individuen ausgeführt wurde, jedoch mit dem Vorsatz, das Volk als eine Gruppe auszurotten. Gemäß der mörderischen Rassentheorie Hitlers sonderten die Nazis in allen Ländern unter ihrer Herrschaft die jüdischen Einwohner von der nichtjüdischen Bevölkerung ab und führten die Juden zum Tod lediglich wegen ihrer rassischen Zugehörigkeit. Genauso, wie das jüdische Volk das Objekt bildete, gegen welches das Verbrechen gerichtet war, ist es heute zuständig, diejenigen, die durch ihre Gewalttaten seine Existenz bedrohten, vor Gericht zu stellen. Die Tatsache, daß das Volk erst nach der Katastrophe aus einem Objekt zu einem Subjekt wurde und aus einem Opfer eines Rasse-Verbrechens zum Träger der Strafhoheit, ist eine große, nicht zu verneinende historische Errungenschaft.
Der Staat Israel, der souveräne Staat des jüdischen Volkes, erfüllt durch diese Gesetzgebung die Mission, die Strafhoheit des jüdischen Volkes gegen die Verbrecher auszuüben, die seine Söhne und Töchter mit dem Vorsatz getötet haben, der Existenz dieses Volkes ein Ende zu bereiten. Wir sind überzeugt, daß diese Strafhoheit mit den Grundsätzen des bestehenden Völkerrechts in Einklang steht. Aufgrund dessen haben wir den ersten Einwand des Verteidigers gegen die Zuständigkeit des Gerichts zurückgewiesen.
39. Es ist hinzuzufügen, daß das bekannte Urteil des Permanenten Internationalen Gerichtshofes im Haag in Sachen Lotus entschied, daß das Territorialitätsprinzip die Zuständigkeit eines Staates nicht einschränkt, strafrechtliche Gerichtsbarkeit auszuüben, und daß vielmehr derjenige, der die Zuständigkeit bestreitet, auf eine besondere die Zuständigkeit ausschließende Regel des Völkerrechts hinweisen muß. Wir haben uns nicht auf diese Rechtsprechung gestützt, die quasi die Beweislast demjenigen auferlegt, der die Zuständigkeit bestreitet, sondern haben es vorgezogen, uns auf positive Gründe für das Bestehen der Zuständigkeit des Staates Israel zu stützen.
40. Das zweite Argument des Verteidigers geht dahin, daß die Gestellung des Angeklagten vor ein Gericht in Israel infolge seiner Entführung aus einem anderen Staate dem Völkerrechte widerstrebe und daß der Angeklagte, der sich unter falschem Namen in Argentinien aufhielt, am 11.5. 1960 von Agenten des Staates Israel entführt und, gegen seinen Willen, nach Israel gebracht wurde. Der Angeklagte beantragte die Einvernahme von Zeugen zwecks Beweis seiner Behauptung, daß die Entführer des Angeklagten aufgrund von Weisungen seitens der Israel-Regierung oder ihrer Vertreter gehandelt hätten. Dies betonte der Verteidiger besonders, um darzutun, daß der Angeklagte in den Hoheitsbereich Israels durch Verletzung des Völkerrechts gebracht wurde. Es sei nicht zulässig, so resümierte der Verteidiger seine Argumente, daß das Gericht sich auf eine unrechtmäßige Staatshandlung stütze, und der Staat Israel sei nicht zuständig, den Angeklagten unter diesen Umständen vor Gericht zu stellen.
Demgegenüber behauptete der Generalstaatsanwalt, daß die Zuständigkeit des Gerichtes in dem Gesetz zur Bestrafung der Nazis und ihrer Helfer begründet sei, welches auf den Angeklagten und auf die ihm in der Anklageschrift zur Last gelegten Handlungen Anwendung findet. Es sei Sache des Gerichts, lediglich diese Verbrechen zu behandeln und aufgrund der Rechtsprechung der Gerichtshöfe in England, in den Vereinigten Staaten und in Mandatspalästina stehe es dem Gericht nicht zu, in die Klärung der Frage einzugehen, unter welchen Umständen der Angeklagte festgenommen und in den Hoheitsbereich des Staates überführt wurde; das wären Fragen, die nicht die Zuständigkeit des Gerichtes berührten, den Angeklagten wegen der strafbaren Handlungen abzuurteilen, deretwegen er vor Gericht gestellt wurde, sondern gehen lediglich die außenpolitischen Beziehungen des Staates Israel an. Der Generalstaatsanwalt fügte hinzu, daß im Zusammenhang mit der Inhaftnahme des Angeklagten und seiner Überführung nach Israel seinerzeit die argentinische Republik Beschwerde beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erhoben hätte, der am 23. 6. 1960 folgenden Beschluß gefaßt hätte: (Urkunde S 4349, Beweisstück T/1)
»The Security Council:
Having examined the complaint that the transfer of Adolf Eichmann to the territory of Israel constitutes a violation of the sovereignty of the Argentine Republic,
Considering that the violation of the sovereignty of a Member State is incompatible with the Charter of the United Nations,
Having regard to the fact that reciprocal respect for and the mutual protection of the sovereign rights of States are an essential condition for their harmonius co-existence,
Noting that the repetition of acts such as that giving rise to this situation would involve a breach of the principles upon which international order is founded, creating an atmosphere of insecurity and distrust incompatible with the preservation of peace,
Mindful of the universal condemnation of the persecution of the Jews under the Nazis and of the concern of people in all countries that Eichmann should be brought to appropriate justice for the crimes of which he is accused,
Noting at the same time that this resolution should in no way be interpreted as condoning the odious crimes of which Eichmann is accused,
Declares that acts such as that under consideration, which affect the sovereignty of a Member State and therefore cause international friction, may, if repeated, endanger international peace and security;
Requests the Government of Israel to make appropriate reparation in accordance with the Charter of the United Nations and the rules of international law;
Expresses the hope that the traditionally friendly relations between Argentina and Israel will be advanced.«
Infolge des obigen Beschlusses kamen die beiden Regierungen zu einem Übereinkommen über die Beseitigung der Meinungsverschiedenheit und veröffentlichten am 3. 8. 1960 folgende gemeinsame Erklärung: (T/4)
»Los Gobiernos de la República Argentina é Israel, animandos por el proposito de dar cumplimiento a la resolución del Consejo de Seguridad del dia 23 de Junio de 1960 en cuanto expresa la esperanza de que mejoren las relaciones tradicionalmente amistosas entre ambos países, resuelven considerar concluido el incidente originado en la acción cometida por nacionales israelitas en perjuicio de derechos fundamentales del Estado argentino.«
Mit Beschluß No. 3 vom 17. 4. 1961 (Sitzung 6) haben wir die Einwände des Verteidigers gegen die Zuständigkeit des Gerichtes zurückgewiesen und haben festgestellt, daß es unnötig ist, die im Zusammenhang mit seinem zweiten Argument vorgeladenen Zeugen zu vernehmen. Wir geben nachstehend die Begründung unseres Beschlusses bekannt:
41. Es ist in der Rechtsprechung anerkannt, daß eine Person, die vor einem Gericht wegen strafbarer Handlungen gegen die Staatsgesetze angeklagt ist, nicht berechtigt ist, der Zuständigkeit des Gerichts wegen der Unrechtmäßigkeit ihrer Inhaftnahme oder der Unrechtmäßigkeit der zu ihrer Überführung in das Hoheitsgebiet des Staates angewandten Mittel zu widersprechen. Die Gerichte in England, in den Vereinigten Staaten und in Mandatspalästina haben in ständiger Rechtsprechung entschieden, daß die Umstände der Inhaftnahme und die Art der Überführung des Angeklagten in den Staatsbereich im Strafverfahren unwesentlich sind, und weigerten sich in allen Fällen konsequent, in die Klärung dieser Umstände einzugehen.
Dieser Grundsatz wurde erstmalig in Ex parte Susannah Scott (1829) 9 B. et C. 446; 109 E.R. 106 festgelegt.
Die Antragstellerin wurde in England des Vergehens (misdemeanour) des Falscheids beschuldigt. Ein britischer Polizeibeamter, aufgrund eines vom Lord Chief Justice Lord Tenterden an ihn adressierten Haftbefehls, verhaftete die Antragstellerin in Belgien. Die Antragstellerin wandte sich an den britischen Gesandten in Belgien, der Intervention verweigerte, und der Polizeibeamte führte sie nach England. Dort wurde ein Haftbefehl gegen sie bis zur Verhandlung erlassen. Sie beantragte ihre Befreiung durch habeas corpus. Der Lord Chief Justice Lord Tenterden lehnte den Antrag ab, mit der Begründung
»I consider the present question to be the same as if the party were now brought into Court under the warrant granted for her apprehension… The question, therefore, is this, whether if a person charged with a crime is found in this country, it is the duty of the Court to take care that such a party shall be amenable to justice, or whether we are to consider the circumstances under which she was brought here. I thought and still continue to think, that we cannot unquire into them. If the act complained of were done against the law of a foreign country, that country might have vindicated its own law. If it gave her a right of action, she may sue upon it… For these reasons, I am of opinion that the rule must be discharged.
In seiner Zusammenfassung im Verfahren R. v. Nelson and Brand (1867), (der im Aufsatz von O’Higgins »Unlawful Seizure and Irregular Extradition« 36, British Yearbook of International Law, 1960, auf Seite 285 zitiert wird) sagte der Lord Chief Justice Sir Alexander Cockburn unter anderem den Geschworenen:
»Suppose a man to commit a crime in this country, say murder, and that before he can be apprehended he escapes into some country with which we have not got an extradition treaty, so that we could not get him delivered up to us by the authorities, and suppose that an English police officer were to pursue the malefactor, and finding him in some place where he could lay his hands upon him, and from which he could easily reach the sea, got him on board a ship and brought him before a magistrate, the magistrate could not refuse to commit him. If he were brought here for trial, it would not be a plea to the jurisdiction of the Court that he had escaped from justice, and that by some illegal means he had been brought back. It would be said: Nay, you are here, you are charged with having committed a crime, and you must stand your trial. We leave you to settle with the part who may have done an illegal act in bringing you into this position; settle that with him.«
In Ex parte Elliott (1949) 1 ALL E.R. 373, wurde ein habeas corpus Antrag eines britischen Soldaten behandelt, der von seiner Einheit im Jahre 1946 desertierte und im Jahre 1948 in Belgien von zwei englischen Militäroffizieren, die von zwei belgischen Polizeibeamten begleitet waren, verhaftet wurde. Er wurde seitens der britischen Militärbehörden nach England überführt und dort bis zu dem Verfahren gegen ihn wegen Desertion eingesperrt. Der Vertreter des Antragstellers behauptete, inter alia, daß die englischen Behörden in Belgien nicht berechtigt waren, den Antragsteller zu verhaften und daß er entgegen den Bestimmungen der belgischen Gesetze verhaftet wurde. Lord Goddard lehnte den Antrag ab und führte in seinem Urteil aus: (Seite 376)
»The point with regard to the arrest in Belgium is entirely false. If a person is arrested abroad and he is brought before a court in this country charged with an offence which that court has jurisdiction to hear, it is no answer for him to say, he being then in lawful custody in this country: ›I was arrested contrary to the laws of the State of A or the State of B where I was actually arrested.‹ He is in custody before the court which has jurisdiction to try him. What is it suggested that the court can do? The court cannot dismiss the charge at once without its being heard. He is charged with an offence against English law, the law applicable to the case.«
Der Chief Justice beendet seine Ausführungen in dieser Frage mit den Worten: (Seite 377)
»We have no power to go into the question, once a prisoner is in lawful custody in this country, of the circumstances in which he may have been brought here. The circumstances in which the applicant may have been arrested in Belgium are no concern of this court.«
42. Dieser Grundsatz wurde auch in der mandatspalästinensischen Rechtsprechung angenommen. In dem habeas corpus Antrag des Jitzhak Katz (für Haim Novik) gegen den Kommandanten der polnischen Streitkräfte in Palästina H.C. 71/44 (P.L.R. Band 11, Seite 55) behauptete der damalige Anwalt Olschan, daß Novik, der von einem polnischen Militärgericht wegen Desertion verurteilt wurde, vor dieses extraterritoriale Gericht gesetzwidriger Weise gestellt wurde. Novik wurde von der palästinensischen Polizei verhaftet, und ohne Beschluß eines palästinensischen Gerichts, wie es im Allied Forces Act vorgeschrieben ist, wurde er direkt den polnischen Streitkräften übergeben und abgeurteilt.
Der Chief Justice lehnte den Antrag ab mit der Begründung, daß (Seite 358):
»Provided the Court Martial is properly constituted, and provided the accused, who is before it, is subject to its jurisdiction, the circumstances in which he was arrested and arrived before the Court are not relevant to the question of the jurisdiction of the Court.«
In dem Berufungsfall Mahmud Hassan Yassin, alias Afounnah gegen den Generalstaatsanwalt (Strafberufung 14/42, P.L.R., Band 9, Seite 63) behandelte der Oberste Gerichtshof den Fall eines »Justizflüchtigen«, der von einem palästinensischen Polizeibeamten in Syrien verhaftet und gegen seinen Willen nach Palästina zurückgebracht und vom Gerichtshof zur Ahndung schwerer Verbrechen in Jerusalem zum Tode verurteilt wurde. Der Vertreter des Berufungsklägers wendete ein, daß infolge der Nichtanwendung des zwischen den beiden Staaten bestehenden Auslieferungsabkommens sowohl die Verhaftung seines Mandanten in Syrien als auch seine Überführung nach Palästina, gegen seinen Willen, unrechtmäßig wären und daß daher das Gericht in Jerusalem nicht zuständig war, ihn zu verurteilen. Der Berufungsgerichtshof wies diesen Einwand zurück:
»In our opinion, the law is correctly stated in volume 4 of Moore’s Digest of International Law, at page 311. The authority cited is an American (State) case which, of course, is not binding on this Court. Nevertheless, we adopt the language used, which is as follows:
›Where a fugitive is brought back by kidnapping, or by other irregular means, and not under an extradition treaty, he cannot, although an extradition treaty exists between the two countries, set up in answer to the indictment the unlawful manner in which he was brought within the jurisdiction of the court. It belongs exclusively to the government from whose territory he was wrongfully taken to complain of the violation of its rights.‹
Accepting that view of the law, we think that there is no substance in the extradition point.«
Der im Buch von Moore zitierte Präzedenzfall (ibid.), auf den das genannte Urteil Bezug nimmt und ihn »An American (State) Case« nennt, ist Ker. v. Illinois, 119 U.S. 436, das grundlegende Urteil des Obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten in dieser Frage. Jedenfalls sei bemerkt, daß der amerikanische Rechtsprechungsgrundsatz, wie er von Moore resümiert wurde, hier ausdrücklich vom Obersten Gerichtshof Palästinas »adoptiert« worden ist.
43. Bevor wir uns, infolge dieser »Adoption«, der Rechtsprechung der Vereinigten Staaten zuwenden, wollen wir kurz die Bedeutung der bisher von uns besprochenen Rechtsprechung vom Standpunkte des Völkerrechtes überprüfen. Die Frage, die von diesem Standpunkt aus auftaucht, ist, ob der Grundsatz in ex parte Scott und ex parte Elliott, daß der Angeklagte nicht berechtigt ist, der Gerichtsbarkeit wegen unrechtmäßiger Inhaftnahme oder Unrechtmäßigkeit der Überführung in den Hoheitsbereich zu widerstreben, auf den Fall beschränkt ist, daß die Wege aufgrund der Gesetze eines bestimmten Staates unrechtmäßig waren oder ob dieser Grundsatz generell ist und auch Anwendung findet auf die Benutzung von Mitteln, die eine Verletzung des Völkerrechtes darstellen, also eine Hoheitsverletzung eines anderen Staates. Der Analyse der Rechtsprechung, insbesondere der britischen, von diesem Standpunkte aus ist der Aufsatz von O’Higgins, der kürzlich veröffentlicht wurde, gewidmet (siehe oben). Der Verfasser kommt zu folgender Schlußfolgerung: (Seite 319)
»A British court will probably exercise jurisdiction over a criminal brought before it as the result of a violation of international law. There is, however, no precedent which binds any British court to adopt this view.«
Diese vorsichtige Abwägung der rechtlichen Situation beruht auf der Auffassung des Verfassers, daß die überwiegende Mehrzahl der britischen Präzedenzurteile eigentlich nicht Fälle von Völkerrechtsverletzungen behandeln; denn im Falle Emperor v. Vinayak Damodar Savarkar (1910), I.L.R. 35 Bombay 225 (228) wurde zwar der Grundsatz in Ex parte Scott und in R. v. Nelson and Brand auf einen Fall zur Anwendung gebracht, in welchem der Angeklagte Verletzung des Völkerrechts behauptet hatte (ibid S. 286). Andererseits jedoch wurde von Lord Reading ein Vorbehalt in dieser Frage in Sachen in R. v. Garret (1917) 86 L.J. (K.B.) 894 (898) geäußert.
44. Die amerikanische Rechtsprechung in dieser Angelegenheit ist eindeutiger (und das ist wohl auch der Grund dafür, daß der Oberste Gerichtshof Palästinas im Strafberufungsfall 14/42 (Afuna gegen den Generalstaatsanwalt) es vorzog, sich auf diese kristallisierte Rechtsprechung zu stützen, wie sie im Buche Moore’s zusammengefaßt ist und nicht auf Ex parte Scott – siehe Seite 66 des obigen Urteils. Die Rechtsprechung der Vereinigten Staaten legt ausdrücklich fest, daß es unerheblich ist, ob die Wege, auf denen der Angeklagte in den Hoheitsbereich überführt wurde, im Sinne des staatlichen Rechts oder im Sinne des Völkerrechts unrechtmäßig waren. Das Prinzip ist dasselbe: Das Gericht läßt sich in die Prüfung dieser Frage nicht ein, da sie zum Zwekke des Rechtsverfahrens gegen den Angeklagten unerheblich ist. Die prinzipielle Begründung für diesen Rechtsgrundsatz ist, daß das Recht, Hoheitsverletzung des Staates einzuwenden, das ausschließliche Recht des Staates selbst ist. Der souveräne Staat selbst ist berechtigt, diesen Einwand zu erheben oder Verzicht auf ihn zu leisten. Dem Angeklagten steht es nicht zu, die Rechte dieses Staates zu vertreten. Derselbe Grundsatz kommt auch in der englischen Rechtsprechung zum Ausdruck, und daher betrachtet die amerikanische Rechtsprechung den Fall Ex parte Scott als einen ihrer Präzedenzfälle.
Dieser Grundsatz ist von Travers, dem Verfasser des bekannten Buchs über »Droit Pénal International« in seinem Aufsatz über »Des arrestations au cas de venue involontaire sur le territoire«, 13 Revue de Droit International Privé et de Droit Pénal International (1917), 627 ff., erläutert.
Der Verfasser schließt sich dem in den Vereinigten Staaten entwikkelten Rechtsgrundsatz an und führt aus:
»Mais – et c’est un point que nous tenons à mettre en relief – si l’Etat, dont les agents ont été fautifs, peut, par courtoisie internationale et pour éviter toute tension de rapports, agir d’office, c’est-à-dire ordonner l’élargissement immédiat et exprimer des regrets; si l’Etat, dont le territoire a été violé, peut, de son côté, adresser toutes protestations et exiger toutes satisfactions, les personnes arrêtées n’ont, par contre, aucun droit de réclamation.
Elles ne peuvent se faire un titre de 1 irrégularité commise et profiter de sa perpétration pour obtenir la cessation de leur détention.
La raison en est double.
D’abord, l’individu arrêté n’a aucune qualité pour parler au nom de la souveraineté étrangère; il n’en est pas le représentant. En second lieu, l’Etat étranger qui, maître de sa souveraineté, peut faire telles concessions qu’il juge convenables, est libre de ratifier tous actes irréguliers. Son silence constitue, tout au moins, une présomption de ratification.«