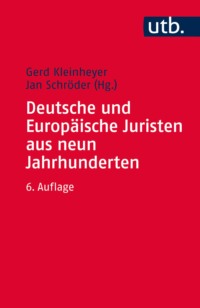Kitabı oku: «Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten», sayfa 4
[Zum Inhalt]
Andreas AlciatusAlciatus, Andreas (1492–1550)
(1492–1550)

Geb. am 8.5.1492 in Mailand als Sohn einer einflußreichen Kaufmannsfamilie; ab 1504 Einführung in die antike Kultur durch Janus Parrhasius; A. erlernt die lateinische und griechische Sprache; um 1507 Beginn des Rechtsstudiums in Pavia bei Jason de Mayno und Philippus Decius; 1511 Wechsel nach Bologna, dort Schüler von Carolus Ruinus; 1516 Promotion in beiden Rechten in Ferrara; anschließend Tätigkeit als Anwalt in Mailand; seinen ersten Publikationserfolgen verdankt er 1518 eine Professur in Avignon; 1522 Rückkehr nach Italien und erneute Tätigkeit als Anwalt; 1527 nimmt A. die Lehrtätigkeit in Avignon wieder auf; ab 1529 ist er Professor in Bourges; ab 1533 lehrt er in Pavia; 1537, möglicherweise aber auch erst 1541, Wechsel nach Bologna, in diese Zeit fällt seine Freundschaft mit dem Maler und Architekten Giorgio Vasari; die Rückkehr auf |18|den Lehrstuhl nach Pavia erfolgt noch 1541; 1542 wird er Professor in Ferrara; ab 1546 lehrt er wieder in Pavia; dort stirbt A. in der Nacht vom 11. auf den 12.1.1550.
Der italienische Renaissancejurist A. gilt als Begründer der humanistischen Jurisprudenz in ihrer philologisch-historischen Ausrichtung, und damit der Methodik, die später als mos Gallicus bezeichnet worden ist. Bis zu A.s Zeit genossen die Glossatoren und vor allem die Kommentatoren das höchste Ansehen in der Rechtswissenschaft; die Werke etwa eines → BartolusBartolus de Saxoferrato (1313/14–1357) oder eines → BaldusBaldus de Ubaldis (1319/27–1400) waren wichtiger geworden als die eigentliche Rechtsquelle, das Corpus iuris civilis. A., „der Überwinder des Bartolismus“ (Schlosser), setzte sich, wie auch → BudaeusBudaeus, Guilelmus (Guillaume Budé) (1467–1540) und → ZasiusZasius, Ulrich (1461–1535), kritisch mit dieser traditionellen Methode, dem später so genannten mos Italicus, auseinander und versuchte, sein reiches Wissen in der lateinischen und griechischen Sprache und auf dem Gebiet der antiken Kultur für eine humanistische Erneuerung der Jurisprudenz nutzbar zu machen. Im Mittelpunkt stand für ihn die textkritische Bearbeitung und, wo es nötig war, die genaue Rekonstruktion der Rechtsquellen des römischen Rechts; so unternahm A. beispielsweise in seinen „Dispunctiones“ den Versuch, die ursprünglich griechischen Einschübe in den Digesten wieder vom Lateinischen ins Griechische zurückzuübersetzen.
Ein weiteres Verdienst A.s ist es, daß er Literaturtypen, die bis dahin vor allem außerhalb der Rechtswissenschaft zu finden waren, auch für die Jurisprudenz fruchtbar gemacht hat. In der juristischen Literatur herrschte zu jener Zeit der Kommentar vor. Mit seinen Werken „Annotationes“, „Paradoxa“, „Dispunctiones“ und „Praetermissa“ führte A. demgegenüber „offene Formen“ (Troje) in die juristische Literatur ein.
Die Bedeutung von A.s philologisch-historischer Arbeitsweise lag vor allem in der Entwicklung einer neuen Methodik zur Bearbeitung der Rechtsquellen, während die Ergebnisse dieser textkritischen Forschungen selbst schnell überholt waren. Auf welche Quellen A. seine Forschungsergebnisse stützte, ist bis heute nicht völlig geklärt. Als sicher gilt, daß er zum Original der wichtigsten Digestenhandschrift, der in Florenz aufbewahrten „Florentina“, keinen Zugang hatte. Er selbst beruft sich in seinen „Dispunctiones“ auf einen „vetus codex digestorum“, dessen Existenz aber immer wieder in Frage gestellt wurde, so z.B. von → Savigny. OslerSavigny, Friedrich Carl v. (1779–1861) vertritt die Auffassung, A. habe Zugang zu einer Kopie der „Florentina“ gehabt.
Welche Wertschätzung A. bereits zu seinen Lebzeiten genoß, läßt sich z.B. daraus ablesen, daß er gemeinsam mit → BudaeusBudaeus, Guilelmus (Guillaume Budé) (1467–1540) und → ZasiusZasius, Ulrich (1461–1535) |19|zum „Triumvirat“ (Cantiuncula) der führenden europäischen Juristen gezählt wurde. Sein Ruhm gründete sich aber zu einem großen Teil auch auf seine Lehrtätigkeit. Der Höhepunkt der Universitätslehrerlaufbahn war während der Jahre in Bourges erreicht. Dorthin kamen auch Johann Calvin und Franz I., um den berühmten Italiener zu hören. Nach seiner Rückkehr an verschiedene italienische Universitäten stieß A. mit seiner neuen Methodik im noch ganz der Tradition verhafteten Italien auf weniger Verständnis als in Frankreich.
A. hat über 700 Rechtsgutachten verfaßt, die allerdings erst nach seinem Tode veröffentlicht worden sind. Besonders erwähnenswert ist ein Gutachten, das A. im Zusammenhang mit seiner Mailänder Anwaltstätigkeit in einem Hexenprozeß erstattet hat. Darin kritisierte er die „Hexenschnüffelei“ eines „Ketzermeisters“ (v. Moeller), ohne aber die Hexenverfolgung grundsätzlich abzulehnen.
Im übrigen beschäftigte sich der Humanist A. nicht nur mit der Jurisprudenz, sondern ist auch auf anderen Gebieten durch Veröffentlichungen hervorgetreten, etwa durch seine „Emblemata“ und das Lustspiel „Philargyrus“. In seiner „Epistola contra vitam monasticam“ übte er Kirchenkritik. Obwohl seine Kritik in die gleiche Richtung ging wie die Martin Luthers, schloß sich A. nicht dessen Lehren an; in dieser Hinsicht war er noch zu sehr dem traditionellen System verpflichtet (Barni).
Hauptwerke: Annotationes in tres posteriores Codicis Iustiniani libros, 1515. – Paradoxa iuris civilis, 1518. – Dispunctiones, 1518. – Praetermissa, 1518. – De verborum significatione, 1530. – Emblemata, 1531. – Parerga, 1538. – Contra vitam monasticam ad Bernardum Mattium epistola, 1695 (Erstveröffentlichung). – Opera omnia, 1547–1551 (weitere Ausgaben: 1557/58 (Nachdruck 2004), 1571, 1582, 1616/17).
Literatur: G. Barni: Andrea Alciato, giureconsulto milanese e le idee della Riforma protestante, in: Rivista di storia del diritto italiano 21 (1948), 169–209. – E. Cortese: Le grandi linee della storia giuridica medievale, 22002, 403–405. – P.M. Daly: Andrea Alciato in England: aspects of the reception of Alciato’s emblems in England, 2013. – H. de Giacomi: Andreas Alciatus, 1934. – M. Gilmore: Humanists and Jurists, 1963. – A. Grimaldi: Oratio funebris (hrsg. v. Green), 1871. – J.F. Jugler: Andreas Alciat, in: J.F. Juglers Beyträge zur juristischen Biographie, Teil 3, 1777, 14–43. – G. Kisch: Erasmus und die Jurisprudenz seiner Zeit, 1960, 304–316. – J. Köhler: Der „Emblematum liber“ von Andreas Alciatus (1492–1550), 1986. – S. Langer: Rechtswissenschaftliche Itinerarien, 2000, 114–117 u. 149–157. – K. Luig: Staat und Recht in den Emblemen von Andrea Alciato (1492–1550), in: FS f. B. Großfeld, 1999, 727–744. – D. Maffei: Gli inizi dell’umanesimo giuridico, 1956. – G. Mazzuchelli: Alciati, in: ders.: Gli scrittori d’Italia I.1, 1749, 354–371. – J.G. Meusel (Hrsg.): Anekdoten von dem Rechtsgelehrten Andreas Alciat, von der Verfassung der italiänischen Universitäten und von der Ungezogenheit der italiänischen Studenten im XVI. |20|Jahr hundert, in: Johann Georg Meusels historisch-litterarisch-biographisches Magazin, Stück 2, 1790, 104–112. – E. v. Moeller: Andreas Alciat, 1907. – D. Osler: Graecum legitur: A star is born, in: Rechtshistorisches Journal 2 (1983), 194–203. – Ders.: Developments in the text of Alciatus Dispunctiones, in: Ius Commune 19 (1992), 219–235. – Ders.: Andreas Alciatus (1492–1550) as philologist, in: A Ennio Cortese III (2001), 1–7. – J. Otto: Zwang zur Ehe, Andreas Alciat (1492–1550) und die klandestine Ehe, Diss. jur. Frankfurt a.M., 1987. – Ders.: Einleitung, in: A. Alciatus: Opera Omnia, 2004, VII-L. – V. Piano Mortari: Pensieri di Alciato sulla giurisprudenza, in: Studia et documenta historiae et iuris 33 (1967), 210–220. – B. Podestà: Andrea Alciati lettore nello studio di Bologna anni 1537–41, in: Archivio giuridico 3 (1869), 347–355; 4 (1869), 199–208; 11 (1873), 84–92. – A. u. S. Rolet (Hrsg.): André Alciat (1492–1550) un humaniste au confluent des savoirs dans l’Europe de la Renaissance, 2014. – F. Schaffstein: Zum rechtswissenschaftlichen Methodenstreit im 16. Jahrhundert, in: FS f. H. Niedermeyer, 1953, 195–214. – H. Schlosser: Grundzüge der neueren Privatrechtsgeschichte, 102005, 47 u. 71. – Società Storica Comense: Andrea Alciato umanista europeo, in: Periodico della Società Comense LXI (1999), 5–114. – H.E. Troje: Graeca leguntur (= Forsch. z. neueren Privatrechtsgesch. 18), 1971, 217–232. – Ders.: Zur humanistischen Jurisprudenz, in: FS f. H. Heimpel Bd. 2, 1972, 110–139. – Ders.: Alciats Methode der Kommentierung des „Corpus iuris civilis“, in: Der Kommentar in der Renaissance, hrsg. v. A. Beck und O. Herding (= Deutsche Forschungsgemeinschaft Kommission für Humanismusforschung, Mitteilung I), 1975, 47–61. – P. Vaccari: Andrea Alciato, in: Scritti in memoria di A. Giuffrè Bd. 1, 1967, 829–857. – P. Viard: André Alciat, 1926. – Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste (hrsg. v. J.G. Ersch und J.G. Gruber) I. 2 (1818), 418f. (Spangenberg). – DBGI I (2013), 29–32 (A. Belloni u. E. Cortese). – DBI II (1960), 69–77 (R. Abbondanza). – HRG2 I (2008), 139f. (A. Belloni). – Jur., 27–29 (J. Otto). – Jur.Univ. II, 147–150 (R.Rodriguez-Ocaña). – Bibliographie in: DBI II, 76f.
A. Krauß
[Zum Inhalt]
|21|Johannes AlthusiusAlthusius, Johannes (1557–1638)
(1563–1638)

A. ist 1563 (1557?) geboren in Diedenhausen (Grafschaft Wittgenstein). Im Jahre 1586 wird er, nach Studien in Basel (Dissertation bei Basilius Amerbach) und Genf (bei → Dionysius GothofredusGothofredus, Jacobus (Jacques Godefroy) (1587–1652)), erster Rechtslehrer am akademischen Gymnasium Herborn. 1604 folgt er einem Ruf als Syndikus der Stadt Emden und bleibt in dieser Stellung bis zu seinem Tode am 12.8.1638.
A.s erste bedeutende Schrift, die „Jurisprudentiae romanae libri duo“, gehört zu den frühesten Versuchen, ein nicht der „Legalordnung“ der Digesten verhaftetes Rechtssystem aufzustellen. Die ramistische Methode (so benannt nach ihrem Begründer Pierre de la Ramée, lat. Ramus), d.h. Ableitung aller Einteilungen aus fortschreitender Spaltung der Begriffe, ist hier erstmals Grundlage eines Rechtssystems. Der Stoff ist in einen allgemeinen und einen besonderen Teil gegliedert: das erste Buch behandelt das ius primum (materielles Recht), das zweite das ius ortum de primo (Verfahrensrecht). A. hat diese Ansätze weiter ausgebaut in der „Dicaeologica“, die ein vollständiges System des gesamten geltenden Rechts enthält. Der allgemeine Teil behandelt die Begründung des Rechts: Das natürliche Recht wird von der recta ratio communis nach den allgemeinen Bedürfnissen der menschlichen Gesellschaft aufgestellt. Das positive Recht wird von der recta ratio specialis nach den besonderen Bedürfnissen einer örtlich begrenzten Gemeinschaft erzeugt. Grundsätzlich muß das positive Recht mit den obersten Prinzipien des Naturrechts in Einklang stehen, jedoch sind Abweichungen zur Regelung der konkreten Verhältnisse möglich. Der besondere Teil gliedert sich in die Dicaeodotica, die Lehre von der Zuteilung der Rechte an den Menschen, und die Dicaeocritica, die Lehre vom streitig gewordenen Recht, enthält also das Prozeßrecht. – A.s Systematisierungsbemühungen führen auch zu einer Reihe neuartiger, die Kasuistik der römischen Quellen überwindender, Lösungen einzelner zivilrechtlicher Probleme: |22|So versteht er etwa die Haftung für Mängel der verkauften Sache als Ausdruck der allgemeinen kaufvertraglichen Pflichten des Verkäufers (und nicht mehr als eine dem Käufer erst durch besonderen Rechtsbehelf gewährte Vergünstigung), gibt Ansätze zu einer selbständigen Erfassung der verschuldensunabhängigen Haftungstatbestände und fundiert den Persönlichkeitsschutz in einem subjektiven Persönlichkeitsrecht. Häufig berühren sich die Lösungen A.s mit Gedanken des 30 Jahre älteren französischen Juristen → Hugo DonellusDonellus, Hugo (Doneau, Hugues) (1527–1591).
Das Schwergewicht liegt in der „Dicaeologica“ beim Privatrecht, unter dessen Kategorien auch öffentliches und Strafrecht eingeordnet werden. Die tiefere Begründung für dieses Verfahren findet sich in der Gesellschaftslehre, die A. in den „Politica“, seinem wohl bedeutendsten Werk, vierzehn Jahre vorher dargelegt hatte.
A. will mit diesem Werk die Politik als eine selbständige Gesellschaftswissenschaft neben Rechtslehre, Ethik, Theologie, Physik und Logik aufbauen. Seine Darstellung ruht auf der calvinistischen Lehre von der göttlichen Prädestination alles gesellschaftlichen und staatlichen Lebens; in Konsequenz dieser Auffassung hat der Staat für A. weltliche und geistliche Aufgaben zu erfüllen, eine Trennung von Staat und Kirche (wie in Luthers „Zwei-Reiche-Lehre“) kennt A. nicht. Dieser religiöse Hintergrund darf bei Würdigung der Einzelheiten in den „Politica“ nicht außer acht gelassen werden.
Ausgangspunkt ist eine von A. durchaus als Beschreibung der Wirklichkeit verstandene „Vertragslehre“, die z.T. wohl an die spanische Schule von Salamanca (Covarruvias, Vazquez) anknüpft: Die menschliche Gesellschaft beruht auf einem Vertrag, der entweder stillschweigend oder ausdrücklich geschlossen ist. Den Zusammenschluß bewirkt ein natürliches Bedürfnis der Menschen, das zu seiner Erfüllung den Gesetzen des Verkehrs, der Leitung und der Verwaltung untersteht und zu den Formen der Familie, der Genossenschaft, der Gemeinde, der Provinz und des Staates führt. Alles Recht der Gemeinschaft wird aus dem angeborenen Recht des Individuums hergeleitet. Dieses individualistische Grundprinzip wird von der naturrechtlichen Schule in ihre Staatslehre aufgenommen (Grotius) und taucht von da an in zahlreichen Variationen bei allen einflußreichen naturrechtlichen Theoretikern wieder auf.
Neben dem Gesellschaftsvertrag besteht ein Herrschaftsvertrag. Er hat jedoch nur den Wert eines Anstellungsvertrages, Geschäftsherr ist das Volk, der Herrscher ist nur Beamter. Hier ist die Brücke zu A.s Lehre von der Volkssouveränität.
|23|In der Auseinandersetzung mit dem Souveränitätsbegriff Bodins findet A. zu einer eigenen Definition und baut dabei wiederum auf den Lehren von Covarruvias und Vazquez auf. Er übernimmt den Souveränitätsbegriff der Absolutisten – die absolute Unteilbarkeit, Unveräußerlichkeit und Unverjährbarkeit der Majestätsrechte – und überträgt ihn auf die Volkssouveränität. Alle Souveränität bleibt beim Volk, eine Souveränität des Herrschers, wie Bodin behauptet hatte, kann es nicht geben, da nur eine Souveränität im Staate möglich ist. Zur Wahrung der Volksrechte räumt A. den gewählten Repräsentanten (eine antike Bezeichnung wiederaufnehmend, nennt er sie „Ephoren“) bzw. der Volksversammlung nicht nur eine ständige Mitregierung und Kontrolle, sondern in den wichtigsten Dingen die alleinige Beschlußfassung und die Verpflichtung des Regenten zur Ausführung der ihm übermittelten Beschlüsse ein. Nur in einem wichtigen Punkt korrigiert A. den Souveränitätsbegriff des Bodin: Es gibt für ihn keine potestas absoluta, und folglich ist die souveräne Gewalt nicht nur durch göttliches und natürliches Recht, sondern ebenso durch die positiven Gesetze und vor allem durch die Verfassungsgesetze gebunden. Damit wird ein Rechtsbereich für die legitim konstituierte Gewalt geschaffen.
Charakteristisch für A.s System ist die allseitige Durchführung des Repräsentationsprinzips. Das Prinzip der Volkssouveränität wird dadurch nicht beeinträchtigt, da die Repräsentanten, die Ephoren, nur gewählte Verwalter sind. Die herrschende ständische Gliederung ist als Grundlage der Repräsentantenversammlung anzusehen, doch ist für A. weniger die ständische Gliederung als das Prinzip der korporativen Delegation bestimmendes Element der Konstitution politischer Vertretungskörper.
Während im Mittelalter und bei Bodin gerade der Begriff der Souveränität der Stärkung aller zentralistischen Bestrebungen diente, baut A.s System auf einem verschärften Souveränitätsbegriff in Verbindung mit einer föderativen Struktur auf. Das ist nur möglich durch das Zusammenspiel des Gedankens der Volkssouveränität mit einem rein naturrechtlichen Gesellschaftsaufbau, der vom Individuum ausgehend erst über Familie – Genossenschaft – Gemeinde – Provinz zum Staat führt. Die Staatsgewalt wird durch das Recht der engeren Verbände beschränkt, aus denen sie sich aufbaut. Das ist eine Umkehrung der bisher herrschenden romanistisch-kanonistischen Korporationslehre, A. wird so auch zum Schöpfer eines neuen Korporationsbegriffes. Mit der Durchführung seines Systems des Gesellschaftsvertrages wird alles öffentliche Recht in Privatrecht aufgelöst und damit eine Grundlage für die weitere Entwicklung föderalistischer Ideen geschaffen, etwa den |24|Begriff vom zusammengesetzten Staat oder die Entstehung der Idee der Gemeinde- und Genossenschaftsfreiheit aus der naturrechtlichen Gesellschaftslehre (→ GierkeGierke, Otto v. (1841–1921)).
Die Idee des Rechtsstaates durchzieht das ganze Werk. Es gibt keine potestas legibus soluta, auch das Volk als Souverän ist an die positiven Gesetze gebunden. Widerstand ist nicht möglich gegen einen legitimen Herrscher und gegen das souveräne Volk. Dem einzelnen steht nur ein Notwehrrecht gegen die Staatsgewalt zu. Ein Widerstandsrecht steht jedoch dem Volk in seiner Gesamtheit und in dessen Stellvertretung den Ephoren zu. Die Ephoren haben sogar die Pflicht, dem vertragsbrüchigen Herrscher Widerstand zu leisten, notfalls auch durch Abtrennung von Staatsteilen. Damit gibt A. kein Revolutionsrecht, sondern ein streng formelles und allseitig bindendes Verfassungsrecht.
Von A.s Werken haben wohl die „Politica“ die größte Wirkung ausgestrahlt. Sie gewannen über → ArumaeusArumaeus, Dominicus (1579–1637) und → LimnaeusLimnäus, Johannes (1592–1663) Einfluß auf die juristische Konstruktion der deutschen Reichsstaatsgewalt. Einfluß auf Rousseaus „contrat social“ ist aus der gleichartigen Behandlung der Souveränitätslehre zu schließen. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts verdammt neben vielen anderen vor allem → ConringConring, Hermann (1606–1681) das Werk des A. als Aufruhrdoktrin und zählt ihn zu den gefährlichsten Monarchomachen. Unter dem Eindruck der englischen und französischen Parolen von der Volkssouveränität (→ LockeLocke, John (1632–1704), → HobbesHobbes, Thomas (1588–1679), Rousseau) gerieten das Werk und sein Autor bald in Vergessenheit. Erst → Otto von GierkeOtto (1815–1867); bayer. Prinz, König v. Griechenland machte 1880 wieder auf A. aufmerksam.
Hauptwerke: Juris Romani (ab 2. Aufl. 1589: Jurisprudentiae Romanae) libri duo, ad leges methodi Rameae conformati, 1586, 21588 (1589, 1592), 51623. – Politica, methodice digesta et exemplis sacris et profanis illustrata, 1603, 21610, 31614 (Ndr. 1961, 1980, dt. Übers. von H. Janssen: Politik, in Auswahl hrsg. v. D. Wyduckel, 2003), 51654. – Dicaeologicae libri tres, totum et universum ius, quo utimur, methodice complectentes, 1617, 21649 (Ndr. 1967). Bibliographie: U. Scheuner/H.U. Scupin (Hrsg.): Althusius-Bibliographie, bearb. v. D. Wyduckel, 2 Bde., 1973, 1–9; Wolf: Rechtsdenker, 216.
Literatur: H. Antholz: Die politische Wirksamkeit des Johannes Althusius in Emden, 1955. – P. Blickle u.a. (Hrsg.): Subsidiarität als rechtlichen und politisches Ordnungsprinzip in Kirche, Staat und Gesellschaft, 2002. – E. Bonfatti u.a. (Hrsg.): Politische Begriffe und historisches Umfeld in der Politica methodice digesta des Johannes Althusius, 2002. – W. Buchholz: Rousseau und Althusius. Eine staatsrechtliche Untersuchung, Diss. jur. Breslau 1922. – L. Calderini: La politica di Althusius tra rappresentanza e diritto di resistenza, 1995. – F.S. Carney u.a. (Hrsg.): Jurisprudenz, politische Theorie und Politische Theologie, 2004. – K.-W. Dahm/W. Krawietz/D. Wyduckel (Hrsg.): Politische Theorie des Johannes Althusius (= Rechtstheorie, Beiheft 7), |25|1988. – H. Dreitzel: Neues über Althusius, in: Ius Commune 16 (1989), 275–302. – R. v. Friedeburg u.a (Hrsg.): Recht, Konfession und Verfassung im 17. Jh., 2015. – C.J. Friedrich: Johannes Althusius und sein Werk im Rahmen der Entwicklung der Theorie von der Politik, 1975. – O. v. Gierke: Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien, 1880, 31913, 71981 (unv.). – H. Hofmann: Repräsentation. Studien zur Wort und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jh. (= Schr. z. Verfassungsgesch., 22), 1974, 358–374. – T.O. Hüglin: Sozietaler Föderalismus. Die politische Theorie des Johannes Althusius, 1991. – Ders.: Early Modern Concepts for a Late Modern World. Althusius on Community and Federalism, 1999. – H. Janssen: Die Bibel als Grundlage der politischen Theorie des Johannes Althusius, 1992. – P.A. Knöll: Staat und Kommunikation in der Politik des Johannes Althusius, 2011. – C. Malandrino (Hrsg.): Politisch-rechtliches Lexikon der Politica des Johannes Althusius, 2010. – E. Reibstein: Johannes Althusius als Fortsetzer der Schule von Salamanca, 1955. – Stintzing-Landsberg: GDtRW 1, 468–477. – Stolleis: Gesch., I, 106–109; – Wieacker: PRG, 286f. – P.J. Winters: Die „Politik“ des Johannes Althusius und ihre zeitgenössischen Quellen, 1963. – P.J. Winters: Johannes Althusius, in: Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert, hrsg. v. M. Stolleis, 21987, 29–51. – Wolf: Rechtsdenker, 177–219. – ADB 1 (1875), 367 (R. v. Stintzing). – HRG2 I (2008), 196–199 (D. Wyduckel). – Jur., 31–33 (U. Speck). – Jur.Univ. II, 316f. (J. Abellán). – NDB 1 (1953), 224f. (H. Mitteis). – StL 1 (1957), 284–286 (E. Reibstein). Bibliographie: Althusius-Bibliographie (s.o.), 19–26; Wolf: Rechtsdenker, 216–219.
H.