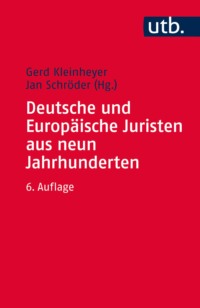Kitabı oku: «Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten», sayfa 6
[Zum Inhalt]
|36|AzoAzo (vor 1190–1220)
(vor 1190–1220)
A. entstammt einer Bologneser Familie niederen Standes. Sein Vater Soldanus ist nur als Vater seines berühmten Sohnes bekannt. Angaben jüngerer Quellen, wonach A. in Montpellier bzw. Casalmaggiore bei Cremona geboren worden sein soll, haben sich als Irrtümer erwiesen. Urkundlich ist A. vom 23. Nov. 1190 bis zum 15. Juli 1220 bezeugt. Neben „A.“ finden sich in diesen Urkunden die Namensformen Azzo und Azzolinus, gelegentlich wird der Vatername hinzugefügt (Azzo Soldani). Andere zuweilen angeführte Bei- bzw. Vornamen entbehren der historischen Grundlage (Dominicus), beruhen auf Verwechslung (de Ramenghis) oder sind, wenngleich früh bezeugt, fraglich (Porcus, Porchus, Portius). A. studierte in Bologna unter Johannes Bassianus Zivilrecht und lehrte dort spätestens seit 1190. 1191 trafen er und Lotharius Cremonensis mit Kaiser Heinrich VI. bei dessen Aufenthalt in Bologna zusammen. Mit diesem Treffen verbindet sich die berühmte Anekdote vom geschenkten Pferd (in einigen Quellen fälschlich auf Barbarossa sowie Bulgarus und Martinus Gosia bezogen): Während Lothar die Frage Heinrichs, wem das imperium merum gebühre, ausschließlich zugunsten des Kaisers beantwortete und dafür ein Pferd erhielt, ging A., nach dessen Ansicht das imperium merum auch anderen höheren Obrigkeiten zukam, leer aus („licet ob hoc amiserim equum, quod non fuit aequum“, Summa codicis, ad. Cod. 3,13, n. 17). Als Rechtsgelehrter und Lehrer errang A. schon bald legendären Ruf und hatte großen Zulauf. Zu seinen Schülern zählen die Legisten → AccursiusAccursius (um 1185–1263), Bernardus Dorna, Jacobus Balduini, Martinus de Fano und Roffredus de Epiphanis, die Kanonisten Goffredus de Trano und Johannes Teutonicus sowie der Feudist Jacobus de Adrizone. Die Berichte jüngerer Quellen, A. habe zuweilen an die 10000 Hörer gehabt und auf offener Straße lesen müssen, beruhen jedoch auf Mißverständnissen der Autoren.
Neben der Glossatoren- und Lehrtätigkeit wirkte A. als Rechtsberater in privaten und öffentlichen Angelegenheiten. Zwischen 1198 und 1220 war er ausweislich der überlieferten Urkunden mehrfach an Vertragsschlüssen Bolognas mit anderen italienischen Städten beteiligt bzw. Mitglied Bologneser Gesandtschaften. Nach der Chronik Alberichs von Troisfontaines ist er im Jahr 1220 gestorben, wofür spricht, daß er seit dem 15. Juli d.J. nicht mehr in Erscheinung tritt. Die These → SavignysSavigny, Friedrich Carl v. (1779–1861), A. sei frühestens im Jahr 1230 gestorben, ist inzwischen widerlegt (der von A. erwähnte Genueser Podestá Jacobus ist nicht, |37|wie Savigny annahm, der dort für das Jahr 1229 als Podestá bezeugte Jacobus Balduini, sondern der Mailänder Jacobus Manieri, der 1195 das Amt innehatte). Zu den vielen Legenden, die sich um A. ranken, gehört die bis in das 14. Jh. zurückreichende Behauptung, A. sei wegen der Ermordung seines Kollegen Hugolinus hingerichtet worden. Sie findet in zeitgenössischen Quellen keine Stütze und beruht wahrscheinlich auf einer Verwechslung mit seinem Sohn Ameus, der 1243 hingerichtet wurde. Neben Ameus sind vier weitere Söhne A.s bezeugt. Seine Nachkommenschaft läßt sich bis zum Ende des 14. Jh. verfolgen. Bedeutung und Einfluß hatte die Familie nach A. nicht mehr.
Als Hauptwerke A.s sind seine in über dreißig Handschriften überlieferten, größtenteils noch unedierten Glossenapparate (durchlaufende Kommentierungen) zu allen Teilen des Corpus iuris civilis zu betrachten. Entgegen früherer Ansicht war A. nicht der erste, der solche Apparate zusammengestellt hat, vielmehr wurden in den letzten Jahrzehnten mehrere sehr alte identifiziert, und es ist wahrscheinlich, daß bereits → IrneriusIrnerius (vor 1100–1125) sich nicht auf Einzelglossen beschränkte. Unter A. setzt sich allerdings mit den sogen. Apparatus maiores ein neuer Apparatetyp durch. Während die älteren (Apparatus minores) durch kurze, nach einzelnen Glossentypen klar voneinander abgegrenzte Kommentierungen gekennzeichnet sind, die sich ohne weiteres in den Satzbau und Gedankengang des glossierten Quellentextes einbauen lassen, wachsen die Glossen in den Apparatus maiores A.s nach Zahl und Umfang durch die Berücksichtigung älterer und zeitgleicher Literatur und die Aufnahme von Argumenten und Gegenargumenten, Allegationen und Lösungen beträchtlich an, wobei sich die Unterschiede der einzelnen Glossentypen nivellieren und an ihre Stelle ein einheitlicher Typ langer „diskursiver“ Glossen tritt. Zum Digestum vetus und zum Codex soll A. neben Apparaten des neuen auch solche des älteren Typs verfaßt haben. Zum Digestum novum ist lediglich ein Apparatus minor überliefert. Der wissenschaftliche Rang der großen Apparate ist umstritten. Während sie einerseits als Werke gefeiert werden, in denen die wissenschaftliche Methode des Glossierens ihren Höhepunkt erreicht, werden sie andererseits als Plagiate großen Stils abgetan. In der Tat hat A. in seinen Glossen über weite Strecken fremdes Gedankengut, insbesondere seines Lehrers Johannes Bassianus verarbeitet, ohne dies sonderlich kenntlich zu machen, wie überhaupt die Arbeit A.s und seines Schülers → AccursiusAccursius (um 1185–1263) im wesentlichen darin bestand, Vorgefundenes in neue Formen zu gießen. Gleichwohl geht der Vorwurf des Plagiats zu weit, weil er moderne Maßstäbe in die Vergangenheit projiziert. Ist |38|es schon an sich eine bedeutende Leistung, den innerhalb des 12. Jh. immens angewachsenen Stoff zu sichten und für den Unterricht bzw. die Praxis (→ AccursiusAccursius (um 1185–1263)) verfügbar zu machen, so wird außerdem zu recht darauf verwiesen, daß Kompilation als solche noch keinen Plagiator macht und daß es den Zeitgenossen selbstverständlich war, im Werk eines Autors das Werk seiner Vorgänger und Lehrer rezipiert und tradiert zu sehen. A.s Apparatus maiores bildeten denn auch die wichtigste Quelle für die berühmte Glossa ordinaria seines Schülers → AccursiusAccursius (um 1185–1263) und wurden schließlich wie die übrigen voraccursischen Glossen völlig von ihr verdrängt.
Von bleibendem, über Jahrhunderte unangefochtenem Einfluß waren demgegenüber die zw. 1208 und 1210 entstandenen Summen A.s zum Codex und zu den Institutionen, die sich ausweislich des Vor- und Nachworts als ein Werk verstehen und denen später häufig eine nicht allein von ihm stammende Digestensumme angefügt wurde. Auch Summen – es handelt sich dabei um lehrbuchartige Gesamtdarstellungen eines Titels des Corpus iuris bzw. aller Titel eines Rechtsbuchs – sind bereits vor und gleichzeitig zu A. geschrieben worden. A. erfüllte den Zweck dieser Literaturgattung jedoch so glänzend, daß nach ihm keine Codexsumme mehr verfaßt und die seine lediglich noch mit Additiones versehen wurde. In der Folge wurden die Summen A.s zum Lehr- und Handbuch des römischen Rechts schlechthin: → BractonBracton, Henry de (1200/1210–1268) benutzte sie ausgiebig bei der Abfassung seines berühmten Tractats „De legibus et consuetudinibus Angliae“. Aus der Zeit von 1482 bis 1610 sind bislang 35 Druckausgaben bekannt (die erste stammt aus Speyer), und wie Autoren des 15. und 16. Jh. berichten, war der Besitz der Summen A.s in mehreren italienischen Städten Voraussetzung für die Aufnahme in das Richterkollegium, was seinen Niederschlag in dem Sprichwort „Chi non ha Azzo non vada a Palazzo“ gefunden hat.
A. verfaßte ferner ein Commentum (d.h. an der Textfolge orientierte Erklärungen zusammengehöriger Stellen) zum Digestentitel „De diversis regulis iuris antiqui“ (D. 50,17) und Distinctiones (→ IrneriusIrnerius (vor 1100–1125)) – beide Werke bislang unediert – ferner Brocarda (Sammlung verallgemeinerungsfähiger Rechtsgedanken) und Quaestiones (Fallsammlung nebst Lösungen). In letzteren findet sich erstmals der Satz: „Quilibet rex hodie videtur eandem potestatem habere in terra sua, quam imperator“, der in anderen Worten A.s bereits vor Heinrich VI. vertretene Auffassung zum Ausdruck bringt, daß das imperium merum auch anderen Obrigkeiten als dem Kaiser zukommt, und später in |39|modifizierter Form immer wieder zur Umschreibung der Landeshoheit angeführt wird (Dominus imperator in territorio).
Wahrscheinlich aus den letzten Lebensjahren A.s stammt die recht genaue Mitschrift seiner Vorlesung zum Codex aus der Hand seines Schülers Alexander de Sancto Egidio (sog. Codex-Kommentar des A.). Das Werk ist zum einen durch seine zahlreichen Hinweise auf die Meinungen anderer Autoren dogmen- und literaturgeschichtlich und zum anderen als Quelle für die Erforschung der Unterrichtsmethode A.s und seiner Kollegen von großer Bedeutung. Es relativiert zudem durch seine nicht seltenen Hinweise auf das Decretum Gratiani, einzelne Dekretalen und die Meinungen von Decretisten sowie auf den Gerichtsgebrauch der römischen Kurie die Aussage des Odofredus, A. sei im kanonischen Recht nicht sonderlich bewandert gewesen. Berichte jüngerer Quellen, er sei gegen Ende seines Lebens vollends zum Kanonisten und sogar Priester geworden, entbehren jedoch jeder Grundlage und beruhen auf Verwechslung.
Die schon zitierte Auffassung A.s zum imperium merum findet ihre Entsprechung in seiner Position zur Frage nach dem Verhältnis zwischen der Gesetzgebungsgewalt des Kaisers und der consuetudo populi. Im Gegensatz zu → IrneriusIrnerius (vor 1100–1125) und den älteren Glossatoren gestehen die jüngeren, darunter A., den consuetudines die Fähigkeit zu, kaiserliche Gesetze außer Kraft zu setzen, weil das Volk seine Gesetzgebungsgewalt nicht völlig auf den Kaiser übertragen habe. Lediglich ein ausdrückliches Gesetz könne gewohnheitsrechtliche Regeln derogieren. Damit ist Raum für die Geltung des Statutarrechts der Städte (es zählt nach damaligem Begriff zu den consuetudines) neben dem kaiserlichen Recht geschaffen und die Grundlage für das Nebeneinander von Partikularrecht und ius commune gefunden.
Hauptwerke: Summa Azonis cum emendatione … Papie 1506 (Ndr.: Azonis Summa super Codicem, Instituta, Extraordinaria, 1966 [Corpus glossatorum iuris civilis, 2]). – Azonis Summa aurea, Lugduni 1557 (Nachdruck: 1968), weitere Summenausgaben bei Savigny: GRRM V, 33–38 und Weimar, in: Coing, Hdb. I, 203, N. 5. – Azonis ad singulas leges XII librorum Codicis Justinianei commentarius et magnus apparatus, Parisiis 1577 (Ndr.: Azonis lectura super codicem … 1966 [Corpus glossatorum juris vivilis 3]), weitere Ausgaben, Savigny: GRRM V, 19. – Brocardia aurea D. Azonis Boniensis …, Neapoli 1568 (Nachdruck: Azonis Brocarda, 1967 [Corpus glossatorum juris civilis 4,3]), weitere Ausgaben, Savigny: GRRM V, 39f. – Die Quaestiones des Azo, hrsg.v. E. Landsberg, 1888. – S. Carpioli u.a. (Hrsg.): Reliquie preaccursiane, I: Duecentotre glosse dello strato azzoniano alle Istituzioni, 1978.
|40|Literatur: W.M. d’Ablaing: Zur „Bibliothek der Glossatoren“, in: ZRG (RA) 9 (1888), 13–42. – A. Alberti: Scuole italiane e giuristi italiani nello sviluppo storico del diritto inglese, 1937. – A. Belbni: Azzone e il diritto canonico, in: ZRG, KA 114 (1997). – G. Chevier: Sur l’art de l’argumentation chez quelques romanistes médiévaux au XIIe et au VIIIe siècle, in: Archives de philosophie du droit. XI La logique du droit, 1966. – L. Chiapelli/L. Zdekauer: Un consulto d’Azone dell’anno 1205, 1888. – C. Dolani: Due glossi di Azone e Accursio a una legge di Teodosio II e Valentiano III (429) sul limite del potere, in: Università e studenti a Bologna, 1988, 105–109. – G. Dolezalek: Azos Glossenapparat zum Infortiatum, in: Ius Commune 3 (1970), 186–208. – Ders.: Azos verschollener Glossenapparat zu den Tres Partes, in: ZRG (RA) 84 (1967), 403–413. – Ders.: Neue Handschriftenfunde aus Modena, in: TRG 34 (1966), 407–409. – J. Fried: Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jh., 1974. – E. Genzmer: Die justianische Kodifikation und die Glossatoren, in: Atti del congresso internaz. di diritto romano, I, 1934, 345–430. – Ders.: Gli Apparati di Azzone al Digestum Novum 50, 17, 1, in: Annali de storia del diritto 1 (1957), 7–11. – J. Hallebeek: A commentary of Azo Authentica Sacramenta puberum, in: TRG 60 (1992), 289–310. – H.H. Jakobs: De similibus ad similia bei Bracton und Azo (Jus commune, Sonderhefte, 87), 1996. – Ders.: Studien zur Geschichte der glossa ordinaria, in: Festgabe für W. Flume z. 90. Geburtstag, 1998, 99–154. – Ders.: Petitorium et possessionum in eodem libello intendere. D. 5,1,37 und C. 3, 32, 13 in der Lectura des Odofredus, bei Azo und in der Glossa ordinaria, in: ZRG, RA 115 (1999), 323–354. – Ders.: Or signori! Die accursische Glosse als apparatus Ioannis et Azonis in Odofredus’ Lectura super Digesto veteri, in ZRG, RA 110 (2000), 311–423. – Ders.: Odofredus und die Glossa ordinaria, in: FS für G. Kleinheyer, hrsg. v. F. Dorn u. J. Schröder, 2001, 271–352. – Ders.: Magna Glossa. Textstufen der legistischen Glossa ordinaria (Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, N.F., Bd. 114), 2006; dazu J. Hallebeek, in: TRG 75 (2007), 409–411. – H. Kantorowicz: Studies in the glossators of the roman law, 1938. – Ders.: The Quaestiones disputatae of the glossators, in: TRG 16 (1939). – E. Landsberg: Das Madrider Manuscript von Azos Quaestiones, in: ZRG (RA) 10 (1889), 145. – Lange, 255–271. – E. Lauglois: La Somme Acé, in: Mélanges d’archéologie et d’histoire V (1885), 110–114. – F.W. Maitland: Select passages from the workes of Bracton and Azo, 1895. – E.M. Meijers: Sommes, lectures et commentaires (1100 à 1250), in: Ders.: Etudes d’histoire du droit, III, 1, 1959, 211–260. – A. Padovani: Il titulo De Summa Trinitate et fide catholica (C. 1.1) nell’esegesi die glossatori fino ad Azzone. Con tre interludi su Irnerio in: M. Ascheri, G. Colli (Hrsg.): Manoscritti editoria e biblioteche dal medioevo all’ età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei III, 2006, 1075–1123. – G. Post: Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State, 1100–1322, 1964. – N. Sarti: Una inedita quaestio azzoniana sulla restitutio in integrum del minore soccombente in possessorio […], in: Rivista di storia del diritto italiano. 69 (1992), 107–144 = Dies.: Tre itinerary di storia giuridica: I manuscritti, I giuristi, gli istituti, 2007, 89–136. – E. Seckel: Azos Bearbeitung der Codexsumme des Johannes Bassianus, in: Sitzungsberichte der Kgl. Preuß. Akad. d. Wiss. 1918. – Ders.: Distinctiones Glossatorum. Studien zur Distinktionen-Literatur der romanist. Glossatorenschule, verbunden mit Mitteil. unedierter Texte, FS Martitz, 1911, 277–436, rez. v. G. Pescatore, in: ZRG (RA) 33 (1912), 519–546. – R. Weigand: Die Naturrechtslehre der Legisten und |41|Dekretisten von Irnerius bis Accursius und von Gratian bis Johannes Teutonicus, 1967. – P. Weimar: Die legistische Literatur und die Methode des Rechtsunterrichts der Glossatorenzeit, in: Ius Commune 2, 43–83. – Ders.: Die legistische Literatur der Glossatorenzeit, in: Coing, Hdb. I, 129–260. – Ders.: Quelques remarques sur les Summae Digestorum d’Azon, in: RHDF 51 (1973), 720f. – Ders.: Zur Entstehung der Azoschen Digestensumme, in: ders.: Zur Renaissance der Rechtswissenschaft im Mittelalter, 1997, 239–260. – F. de Zulueta: Footnotes to Savigny on Azo’s „Lectura in Codicem“, in: Studi in onore di P. Bonfante, III, 1930, 261–270. – DBI IV (1962), 774–781 (P. Fiorelli). – DBGI I (2013), 137–139 (E. Conte, L. Laschiavo). – HRG 2 I (2008), 395f. (A. Deutsch). – Jur., 53f. (P. Weimar). – Jur.Univ. I, 380 (H. Lange). – LexMA I (1980), 1317 (P. Weimar). – Savigny: GRRM V, 1–44.
F. Dorn
[Zum Inhalt]
Baldus de UbaldisBaldus de Ubaldis (1319/27–1400)
(1327–1400)

Geb. wahrscheinlich 1327 in Perugia als Abkömmling des Peruginer Adelsgeschlechts der de Ubaldis; seine Brüder Angelus und Petrus werden später ebenfalls berühmte Rechtsgelehrte; in Perugia und Pisa studiert er römisches Recht bei Johannes Pagliarensis, Franciscus de Tigrinis und → Bartolus de SaxoferratoBartolus de Saxoferrato (1313/14–1357) und kanonisches Recht bei Federicus Petrucius; er soll sehr früh mit dem Studium begonnen und bereits mit 15 Jahren eine Repetitio abgehalten haben, auch hat er angeblich in einer Vorlesung des → BartolusBartolus de Saxoferrato (1313/14–1357) diesen durch eine Zwischenfrage in schwere Bedrängnis gebracht; 1344 erhält er den Doktortitel und nimmt gleich im Anschluß daran seine Tätigkeit als Rechtslehrer auf; bis etwa 1347 ist er Professor in Bologna; anschließend wirkt er bis 1357 als Rechtslehrer in Perugia; 1357 geht er für ein Jahr nach Pisa und übt dann von 1358 bis 1364 sein Lehramt in Florenz aus; dann erneut in Perugia (1364–1376); zwischen 1376 und 1379 lehrt er in Padua und zwischen 1379 und 1390 wieder in Perugia; 1390 tritt er schließlich eine Professur in Pavia an; die berühmtesten Schüler seiner langen Rechtslehrerlaufbahn sind: Petrus Belforte |42|(später Papst Gregor XI.), Petrus Ancharanus und Paulus de Castro. Am 28.4.1400 stirbt B. an den Folgen des Bisses seines Schoßhundes.
B., „der höchstbezahlte“ und „einer der angesehensten Juristen des ausgehenden 14. Jahrhunderts“ (Walther), ist nach seinem Lehrer → BartolusBartolus de Saxoferrato (1313/14–1357), dem er an Vielseitigkeit um nichts nachsteht, der zweite herausragende Vertreter der Schule der Kommentatoren. Seinen Lehrer schätzte er sehr, scheute aber auch vor Kritik nicht zurück. Später standen sich die beiden Rechtsgelehrten des öfteren als Anwälte gegenüber.
Eine zentrale Stellung nehmen im Werk des B. die Kommentare ein, die aus seinen Vorlesungen hervorgegangen sind. Seine umfangreichen Kommentare zu verschiedenen Teilen des Corpus iuris civilis sind allerdings teilweise recht lückenhaft. Darüber hinaus kommentierte B. auch die vom langobardischen Recht geprägten „Libri feudorum“, den Konstanzer Frieden von 1183 und die ersten 3 Bücher der Dekretalen Papst Gregors IX. Auch unter seinen weit über 2000 Consilien sind bedeutende Werke zu finden, wie etwa die 1378 und 1380 entstandenen Gutachten zum Schisma, in denen B. für die Gültigkeit der Wahl Urbans VI. zum Papst eintritt. Aber nicht nur als Rechtslehrer und Autor erwarb sich B. Ruhm, sondern auch durch sein Auftreten als Gesandter verschiedener Städte und als Rechtsberater einiger Zünfte.
Wie für → BartolusBartolus de Saxoferrato (1313/14–1357), so spielten auch für B. die handels- und kollisionsrechtlichen Probleme der oberitalienischen Handelsstädte eine große Rolle. In zwei Gutachten von 1381 und 1395 widmete er sich dem Wechselrecht und betrat damit juristisches Neuland. Das Problem des kanonischen Zinsverbots behandelte er in etwa 70 Gutachten, dabei akzeptierte er es zwar grundsätzlich, stellte sich aber den zahlreichen – von den praktischen Bedürfnissen des Handelsverkehrs hervorgerufenen – Umgehungsversuchen nicht in den Weg. Nicht zu unterschätzen ist die Bedeutung des B. auch für die Entwicklung des internationalen Privatrechts und des Rechts der Handelsgesellschaften.
In seiner Zeit in Pavia ab 1390 schrieb B. unter anderem auch Gutachten auf Bitten von Giangaleazzo Visconti, des Herzogs von Mailand, die sich mit lehnsrechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Herrschaft des Herzogs befassten. Der Herrscher, der auch Pate von B.s Kindern war, bewunderte den berühmten Juristen.
Auch auf dem Gebiet des Strafrechts und des Strafprozeßrechts sind zahlreiche Consilien des B. überliefert. Sie zeichnen sich durch eine Tendenz zur Milderung und Humanisierung aus; so stellt B. z.B. hohe Anforderungen an den Einsatz der Folter. → Hermann KantorowiczKantorowicz, Hermann (1877–1940) hat B. als „den größten Strafrechtler des alten Italien“ bezeichnet, der für |43|die Entwicklung der „subjektiven Schuldtheorie“ von großer Bedeutung gewesen sei und darüber hinaus die „subjektiven Tatbestandsmerkmale“ entdeckt habe.
Darüber hinaus hatte B. aber auch, was in der Kommentatorenschule eher ungewöhnlich ist, historische und philosophische Interessen. In der verschollenen Schrift „De commemoratione famosissimorum doctorum in utroque iure“ behandelt er die Geschichte der Rechtsschulen und der Rechtslehrer und gehörte damit zu den ersten, die sich mit der Rechtsgeschichte wissenschaftlich auseinandersetzten. Eine große Rolle spielt in seinem Werk die Philosophie. So lassen sich in seinen Schriften Gedanken von Autoren wie Aristoteles, Seneca, Albertus Magnus und Thomas von Aquin nachweisen; des öfteren entscheidet er Rechtsprobleme an Hand von philosophischen Erwägungen anstatt durch Anwendung des Gesetzes. Nicht zu Unrecht wird er daher der „philosophische Kopf der mittelalterlichen Juristen“ (Lange) genannt. Horn hat auf die große Bedeutung der „aequitas“ bei B. hingewiesen.
An B. wurde immer wieder scharfe Kritik geübt. Bemängelt wurden seine zahlreichen Fehlzitate, seine unhistorische Arbeitsweise, seine spekulative Veranlagung und sein schlechtes Latein. Des Weiteren wurde ihm vorgeworfen, er neige zu Abschweifungen und sei an den entscheidenden Stellen zu knapp (Mazzuchelli). Zum Teil sind das Vorwürfe, die man später allen Kommentatoren gemacht hat, zum Teil erklären sie aber wohl auch, warum B. den Ruhm seines Lehrers → BartolusBartolus de Saxoferrato (1313/14–1357) nicht ganz erreichen konnte. Ein weiterer Grund hierfür dürfte in den Widersprüchen zu suchen sein, die zwischen seinen Consilien, in denen er praktischen Erfordernissen folgte, und seinen theoretischen Werken bestehen.
Trotzdem genoß auch B. in der Rechtswissenschaft eine außerordentliche Wertschätzung. Seine Rechtsansichten hatten großes Gewicht in der Rechtspraxis und der Rechtswissenschaft und ab 1449 galten seine Lehrmeinungen in Spanien, gemeinsam mit denen des → BartolusBartolus de Saxoferrato (1313/14–1357), bei Schweigen des Gesetzes als verbindlich. Das größte Verdienst von B., → BartolusBartolus de Saxoferrato (1313/14–1357) und den übrigen Kommentatoren ist aber darin zu sehen, daß es durch sie zu einer Synthese von langobardischem Recht, den Statuten der oberitalienischen Städte, dem kanonischen Recht und dem justinianischen Recht kam. Durch ihre (zum Teil auch rechtsschöpferische) Arbeit mit den verschiedenen Rechtsquellen konnte das römische Recht das Recht der Praxis werden. Sie haben damit die „Schätze“ des römischen Rechts zu einem Bestandteil des Rechts ihrer Zeit gemacht, die Rechtseinheit Italiens im Privatrecht |44|vorangetrieben und das von ihnen bearbeitete Recht zu einem „ius commune“ werden lassen, das seine Wirkungen weit über Italien hinaus entfaltete (Koschaker).
Hauptwerke: Gesamtausgaben: Lyon 1585; Venedig 1615–1616. Angaben zu Einzelausgaben finden sich in: Novissimo Digesto Italiano II, 205 und in: LexMA I, 1376.
Literatur: Associazione Universitaria di Perugia (Hrsg.): Quinto centenario di Baldo, 1900. – J. Canning: The political thought of Baldus de Ubaldis, 1987. – E. Cortese: Le grandi linee della storia giuridica medievale, 22002, 389–393. – W. Engelmann: Die Schuldlehre der Postglossatoren und ihre Fortentwicklung, 21965. – J. Gordley: The Achievement of Baldus de Ubaldis (132?–1400), in: ZEuP 2000, 820–836. – M. Gutzwiller: Aus den Anfängen des zwischenstaatlichen Erbrechts: ein Gutachten des Petrus Baldus de Ubaldis um 1375, in: Zum schweiz. Erbrecht, FS f. P. Tuor, 1946, 145–178. – N. Horn: Philosophie in der Jurisprudenz der Kommentatoren: Baldus philosophus, in: Ius Commune 1 (1967), 104–149. – Ders.: Aequitas in den Lehren des Baldus, 1968. – H. Kantorowicz: Baldus de Ubaldis and the Subjective Theory of Guilt, in: ders.: Rechtshistorische Schriften, 1970, 299–309. – P. Koschaker: Europa und das Römische Recht, 1947, 87–105. – H. Lange: Die Consilien des Baldus de Ubaldis (†1400), 1974. – Lange/Kriechbaum, 749–795. – A. Laufs: Rechtsentwicklungen in Deutschland, 62006, 64f. – S. Langer: Rechtswissenschaftliche Itinerarien, 2000, 84–86 u. 94–98. – D. Maffei: Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento, 1979, 19–34 u. 71–74. – G. Mazzuchelli: Baldo, in: ders.: Gli scrittori d’Italia II.1, 1758, 146–155. – K. Pennington: Allegationes, Solutiones, and Dubitationes: Baldus de Ubaldis’ Revisions of his Consilia, in: M. Bellomo (Hrsg.): Die Kunst der Disputation (= Schriften des Historischen Kollegs: Kolloquien 38), 1997, 29–72. – V. Piano Mortari: I commentatori e la scienza giuridica medievale, 1964/65, 262–264. – H. Schlosser: Neuere Europäische Rechtsgeschichte: Privat- und Strafrecht vom Mittelalter bis zur Moderne, 22014, 75f. – W. Ullmann: Baldus’s conception of law, in: The Law Quarterly Review 58 (1942), 386–399. – H.G. Walther: Baldus als Gutachter für die päpstliche Kurie im Großen Schisma, in: ZRG KA 92 (2006), 393–409. – Wesenberg: PRG, 28–39. – Wieacker: PRG, 80–96. – Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste (hrsg. v. J.G. Ersch und J.G. Gruber) I.7 (1821), 231 (Spangenberg). – DBGI I (2013), 149–152 (E. Cortese). – Enciclopedia Italiana V (1930), 944f. (G. Ermini). – HRG2 I (2008), 410–412 (P. Weimar). – Jur., 58f. (P. Weimar). – Jur.Univ. I, 530–534 (M.J. García Garrido). – LexMA I (1980), 1375f. (P. Weimar). – Novissimo Digesto Italiano II (1957), 204f. (M.A. Benedetto). – Savigny: GRRM VI, 208–248 u. 512f.
A. Krauß