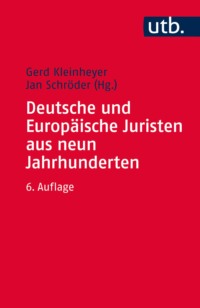Kitabı oku: «Deutsche und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten», sayfa 7
[Zum Inhalt]
|45|Bartolus de SaxoferratoBartolus de Saxoferrato (1313/14–1357)
(1313/14–1357)

Geb. 1313 oder 1314 in Ventura bei Sassoferrato; seine erste Ausbildung erhält er bei dem Franziskaner Petrus de Assisi; ab 1327 Studium des Zivilrechts in Perugia bei Cinus de Pistoia; 1333 Wechsel nach Bologna, wo Jacobus Buttrigarius, Rainerius de Forli und Oldradus de Ponte seine Lehrer sind; in Bologna folgt 1334 die Promotion zum „doctor iuris civilis“; in der Zeit zwischen seiner Promotion und dem Beginn seiner Zivilrechtslehrertätigkeit in Pisa 1339 widmet er sich vermutlich schwerpunktmäßig der praktischen Jurisprudenz; nachweisen läßt sich seine Arbeit als Assessor in Todi, Cagli und Pisa; 1343 (oder bereits im Herbst 1342) beginnt seine Lehrtätigkeit in Perugia; hier gehören zu seinen Schülern → BaldusBaldus de Ubaldis (1319/27–1400), Angelus und Petrus de Ubaldis; 1348 wird B. gemeinsam mit seinem Bruder Bonaccursius das Ehrenbürgerrecht der Stadt Perugia verliehen; Kaiser Karl IV. macht ihn 1355 in Pisa, wo er als Gesandter Perugias auftritt, zum „consiliarius et familiaris domesticus commensalis“, verleiht ihm ein Familienwappen und gesteht ihm und seinen Nachfahren das Privileg zu, Schüler zu legitimieren und für volljährig zu erklären. B. stirbt im Juli 1357 in Perugia.
B. ist der berühmteste und wohl auch bedeutendste Vertreter der Schule der Kommentatoren (früher eher abwertend als „Postglossatoren“ bezeichnet), die vom späten 13. bis zum Ende des 15. Jh.s auf die Glossatorenschule folgte. Den Namen erhielt diese Schule von der in ihr vorherrschenden Literaturgattung, dem Kommentar, der breit angelegten Erläuterung des Rechtssatzes als Ganzes. Die Wurzeln dieser Schule sind bei Rechtsgelehrten wie Jacobus de Ravanis, Petrus de Bellapertica und Johannes Faber, den sogenannten „doctores ultramontani“, in Orléans und Toulouse zu suchen; ihre Lehren wurden den italienischen Juristen vor allem durch Cinus de Pistoia, den Lehrer des B., vermittelt. Oft bezeichnet man die Kommentatoren auch als Konsiliatoren, um ihre Praxisnähe im Gegensatz zu den Glossatoren |46|hervorzuheben; indessen ist zweifelhaft, ob darin wirklich das unterscheidende Merkmal liegt.
Ein Grund für den großen Ruhm, der B. aus der Menge der Rechtsgelehrten seiner Zeit hervorhebt, liegt in seiner Vielseitigkeit. Seine Werke behandeln Themen aus dem Zivilrecht, dem Strafrecht und dem öffentlichen Recht, aber auch das internationale Privatrecht, das internationale Strafrecht und völkerrechtliche Probleme. In Anbetracht seines nur etwa 43 Jahre dauernden Lebens hat B. ein sehr umfangreiches literarisches Werk hinterlassen. Hierzu gehören Kommentare zu allen Teilen des Corpus iuris civilis (die Institutionen ausgenommen), zahlreiche Traktate zu juristischen Einzelfragen, des weiteren Repetitiones und Quaestiones und schließlich beinahe 400 Rechtsgutachten. Viele dieser Werke gehen auf die Unterrichtstätigkeit des B. zurück. Die außerordentliche Popularität des B. war aber auch der Grund dafür, daß ihm viele Werke zugeschrieben wurden, die gar nicht aus seiner Feder stammten; bis heute ist bei zahlreichen Werken, wie z.B. bei dem Traktat „Quaestio inter virginem Mariam et diabolum“, die Frage der Urheberschaft des B. nicht restlos geklärt. Auch inhaltlich kommt B.s Schriften große Bedeutung zu. Häufig wird die gedankliche Schärfe und die Kürze seiner Werke gelobt; demgegenüber hat die Kritik am schlechten lateinischen Stil des B. seinem Ruhm kaum geschadet.
Große Bedeutung hatten B. und die anderen Kommentatoren für die Herausarbeitung einer Theorie des internationalen Privatrechts und des internationalen Strafrechts, einer Theorie, die wegen der Rechtszersplitterung in Italien aufgrund der unterschiedlichen Statuten der einzelnen Städte erforderlich war. Nach Auffassung der Kommentatoren hatte das jeweilige Recht der Städte zwar den Vorrang vor dem römischen Recht, gleichwohl wurden die Statuten durch B. und die anderen Kommentatoren romanisiert, zumal sie eng ausgelegt und die so entstandenen Lücken dann mit Hilfe des römischen Rechts geschlossen werden sollten. Die Fragen, die durch das Aufeinandertreffen der verschiedenen örtlichen Statuten entstanden, wurden ebenfalls diskutiert und durch Einzelfallösungen beantwortet. B. hat es sogar zu einem „kleinen System des internationalen Strafrechts“ (Meili) gebracht; auf Widerspruch stieß in diesem Zusammenhang jedoch seine These, daß ein Dieb, der eine auswärts gestohlene Sache in ein Staatsgebiet hineinbringt, dem internen Strafrechtsstatut unterworfen sei. Nach verschiedenen Überlieferungen soll diese Auffassung Tausenden von Dieben das Leben gekostet haben.
|47|Besonders wichtig war B. für das Zivilrecht, das er über die Rechtsquellen und die Glosse hinaus weiter entwickelte. Bemerkenswert ist schon die Interpretationsmethode, derer sich B. bei seiner Arbeit an den Quellentexten bediente: Er ging, ebenso wie → BaldusBaldus de Ubaldis (1319/27–1400), bei seinen Analogiebildungen bisweilen so weit, daß er eine Vorschrift aus ihrem Zusammenhang nahm und zu einem allgemein geltenden Rechtsgedanken entwickelte. B.s rechtsschöpferische Fähigkeiten zeigen sich in vielen seiner Lehren. So hat er z.B. die Theorie von der rückwirkenden Kraft der Bedingung entwickelt, die sich bis in das 19. Jh. hinein behauptet hat. Zum kanonischen Zinsverbot fand B. eine praktikable Zwischenlösung (Lange): Er erkannte es zwar grundsätzlich an, sah aber auch, daß seine strikte Durchführung nicht mit der damaligen Wirtschaftspraxis vereinbar war, und erklärte deshalb, daß gesetzliche Ansprüche durch das Zinsverbot nicht ausgeschlossen und Verzugszinsen daher zulässig seien. Von einiger Bedeutung ist auch die Schrift „De fluminibus seu Tyberiadis“, worin B. die mit den Flüssen in Zusammenhang stehenden Eigentumsfragen untersucht; dieses Werk weist ihn als einen profunden Kenner der Geometrie aus. Schließlich muß auf die schadensersatzrechtliche Interessenlehre des B. hingewiesen werden, die dem Geschädigten unter gewissen Umständen auch den Ersatz des Affektionsinteresses gewährte.
Wichtige Anstöße hat B., wie überhaupt die Schule der Kommentatoren, für die Entwicklung des Handelsrechts und der damit zusammenhängenden Materien gegeben, die für die aufstrebenden oberitalienischen Handelsstädte, in denen die Kommentatoren zunächst hauptsächlich wirkten, von großer Bedeutung waren. Zum Beispiel setzt sich B. in dem Traktat „De insigniis et armis“ (ca. 1355) unter anderem mit dem Problem der Schutzmarken auseinander, wobei für ihn der Verbraucherschutz ganz im Mittelpunkt steht.
Schließlich war B. auch einer der Ersten, der sich mit Fragen des öffentlichen Rechts und des Völkerrechts systematisch beschäftigte. So interessierte ihn z.B. das Problem, wie weit die Jurisdiktionsgewalt eines Staates auf das offene Meer hinausreiche. In seinem Traktat „De Tyrannia“ befaßt er sich ausführlich mit der Frage der Legitimität von Herrschaftsmacht. Allerdings besteht über die staatsrechtliche und politische Grundeinstellung B.s keine Einigkeit. Zum Teil sieht man ihn, der in seiner Geisteshaltung den Franziskanern nahestand, noch ganz dem mittelalterlichen Denken verpflichtet (Chiappelli); gestützt wird diese Ansicht auf die theokratischen Aspekte des Staates und der Gesellschaft im Werk des B. und auf einen gewissen Mystizismus, der |48|sich bei ihm finden läßt. Andere Autoren (z.B. Woolf) finden bei B. aber auch modernere Züge.
Die Vielseitigkeit des B. und die inhaltliche Bedeutung vieler seiner Schriften machen seinen enormen Ruhm verständlich. Schon bald wurde der Name des „Principe de’giureconsulti“ in einem Atemzug mit Homer, Cicero und Virgil genannt. Der Satz „nemo bonus iurista nisi bartolista“ zeigt die Wertschätzung, die man B. in der Folge entgegenbrachte. Seine Lehrmeinungen wurden in vielen Fällen zur alleinentscheidenden Ansicht; in Spanien und Portugal hatten sie sogar Gesetzeskraft. Das größte Verdienst des B. und der anderen Kommentatoren ist darin zu sehen, daß durch ihre Arbeit dem römischen Recht der Siegeszug durch die gesamte europäische Rechtswissenschaft ermöglicht wurde. Eine kritische Sicht der Kommentatorenschule, ihrer Werke und ihrer Arbeitsweise setzte erst mit der humanistischen Rechtswissenschaft ein (→ AlciatusAlciatus, Andreas (1492–1550), → BudaeusBudaeus, Guilelmus (Guillaume Budé) (1467–1540), →Zasius).
Hauptwerke: Gesamtausgaben: Basel 1588–1589, 10 Bde.; Venedig 1590; Venedig 1603; Venedig 1615; München 1845–1846, 8 Bde. Eine ausführliche kritische Aufstellung der Werke findet sich in: DBI VI, 644–663, ein Verzeichnis zahlreicher Gesamtausgaben bei van de Kamp (s.u.), 109–119.
Literatur: G. Barni: Bartolo da Sassoferrato ed il problema della giurisdizione sul mare, in: Rivista di storia del diritto italiano 24 (1951), 185–195. – Centro italiano di studi sul basso medioevo u. Accademia Tudertina (Hrsg.): Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società, 2014. – F.J. Cesar: Popular Autonomy and Imperial Power in Bartolous of Saxoferrato: An Intrinsic Connection, in: Journal of the History of Ideas Volume 65 (2004), 369–381. – L. Chiappelli: Le idee politiche del Bartolo, in: Archivio Giuridico 27 (1881), 387–439. – E. Cortese: Le grandi linee della storia giuridica medievale, 22002, 385–389. – H. Dilcher: Zur Einführung – Romanistische Mediävistik, in: JuS 1966, 387–392. – W. Engelmann: Die Schuldlehre der Postglossatoren und ihre Fortentwicklung, 21965. – J.L.J. van de Kamp: Bartolus de Saxoferrato 1313–1357, 1936. – P. Koschaker: Europa und das Römische Recht, 1947, 87–105. – Lange/Kriechbaum, 682–733. – S. Langer: Rechtswissenschaftliche Itinerarien, 2000, 78–84 u. 93–98. – A. Laufs: Rechtsentwicklungen in Deutschland, 62006, 63f. – S. Lepsius: Der Richter und die Zeugen (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte Bd. 158), 2003. – Dies.: Von Zweifeln zur Überzeugung (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte Bd. 160), 2003. – Dies.: Bartolus von Sassoferrato und das europäische Ius commune, in: ZEuP 2015, 313–334. – G. Mazzuchelli: Bartolo, in: ders.: Gli scrittori d’Italia II.1, 1758, 460–468. – F. Meili: Bartolus als Haupt der ersten Schule des internationalen Strafrechts, 1908. – P. Melanchthon: De Irnerio et Bartolo iurisconsultis oratio, 1537. – V. Piano Mortari: I commentatori e la scienza giuridica medievale, 1964/65, 259–262. – A.T. Sheedy: Bartolus on social conditions in the fourteenth century, 1967. – G. Schiemann: Pendenz und Rückwirkung der |49|Be dingung, 1973, 29–35 u. 146f. – H. Schlosser: Neuere Europäische Rechtsgeschichte: Privat- und Strafrecht vom Mittelalter bis zur Moderne, 22014, 74–76. – F. Sturm: Wie leitete Bartolus seine Ausführungen zur Statutenlehre ein?, in: Liber amicorum f. C. Krampe, 2013, 223–333. – Università degli Studi di Perugia (Hrsg.): Bartolo da Sassoferrato, studi e documenti per il VI centenario, 2 Bde., 1962. – P. Weimar: Bartolus de Saxoferrato, in: ders.: Zur Renaissance der Rechtswissenschaft im Mittelalter 1997, 338–350. – Wesenberg: PRG, 28–39. – Wieacker: PRG, 80–96. – C.N.S. Woolf: Bartolus of Sassoferrato – his position in the history of medieval political thought, 1913. – Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste (hrsg. v. J.G. Ersch und J.G. Gruber) I.7 (1821), 457 (Spangenberg). – DBGI I (2013), 177–180 (S. Lepsius). – DBI VI (1964), 640–669 (F. Calasso), mit weiteren Literaturangaben. – Enciclopedia Italiana VI (1930), 251f. (F. Ercole). – HRG2 I (2008), 450–453 (S. Lepsius). – Jur., 67f. (P. Weimar). – Jur.Univ. I, 524–530 (M.J. García Garrido). – LexMA I (1980), 1500f. (P. Weimar). – Novissimo Digesto Italiano II (1957), 279f. (M.A. Benedetto). – Savigny: GRRM VI, 137–184 u. 510f.
A. Krauß
[Zum Inhalt]
Jeremy BenthamBentham, Jeremy (1748–1832)
(1748–1832)

B. wird als ältestes von sieben Kindern eines wohlhabenden Londoner Attorneys am 15.2.1748 in London geboren, gilt als „Wunderkind“ und studiert bereits 1760 am Queen’s College in Oxford, ab 1763 in Lincoln’s Inn, London, Philosophie und Rechtswissenschaft. Er ist Zuhörer in der King’s Bench Division des High Court, wo er den Verhandlungen von Chief Justice Lord Mansfield folgt. 1763 hört er → BlackstonesBlackstone, Sir William (1723–1780) Vorlesungen über englisches Recht. 1767 wird er als Barrister (Lincoln’s Inn) zugelassen. Er nimmt aber keine praktische Tätigkeit auf, sondern wendet sich der Untersuchung der theoretischen Grundlagen von Recht und Gesetzgebung zu und wird zum „great questioner of all things established“ (John Stuart Mill). Fasziniert von den naturwissenschaftlichen Entdeckungen und Erkenntnissen der Zeit will B. der Newton der Gesetzgebung werden.
|50|Seine erste größere Arbeit, „A Comment on the Commentaries“ (1775), wagt er nicht zu veröffentlichen, da er in ihr → BlackstoneBlackstone, Sir William (1723–1780) und das System des Common Law insgesamt angreift und beiden Reformfeindlichkeit und Selbstgefälligkeit vorwirft. Die Vorwürfe kehren in abgemilderter Form wieder in „A Fragment on Government“ (1776), das zunächst anonym erscheint und großes Aufsehen erregt. 1787 veröffentlicht B. „Defence of Usury“ (dt. „Vertheidigung des Wuchers“, 1788), das ihn als Anhänger der Lehren Adam Smiths ausweist, eine Position, die er in späteren Jahren aufgibt. 1780 fertig gestellt erscheint 1789 B.s Hauptwerk „An Introduction to the Principles of Morals and Legislation“. Ursprünglich gedacht als Einführung in das Projekt eines neuen Strafgesetzbuches, entwickelt B. in diesem Werk die Grundlagen des Utilitarismus. Er untersucht, welche Handlungen nach utilitaristischen Grundsätzen als Straftaten aufzufassen seien, und wie sie bestraft werden sollen. Strafe ist ein Übel und daher grundsätzlich abzulehnen. Sie ist nur gerechtfertigt, wenn sie größeres Übel in Form anderer Straftaten verhindert. In der Folgezeit führen B. verschiedene Reisen insbesondere nach Frankreich, wo er mit Ideen der französischen Aufklärung in Berührung kommt. 1792 verleiht ihm die französische Nationalversammlung die Ehrenbürgerwürde. Von großer Bedeutung wird die Freundschaft mit Étienne Dumont, der seine Werke in eine lesbare Form bringt, in Frankreich herausgibt und damit in Europa bekannt macht und B.s Ansehen als einer der großen Denker der neuen Zeit begründet.
Als zweiter Band der „Introduction“ konzipiert, entsteht 1782 das unveröffentlichte „Of Laws in General“, ein „Meisterwerk analytischer Jurisprudenz“ (H.L.A. Hart), das erst 1945 im Nachlass entdeckt wird. B. entwickelt darin eine neue Form von Logik im Rahmen einer allgemeinen Rechtslehre („the logic of the will“). Recht ist danach der direkte oder indirekte Ausdruck des Willens eines souveränen Gesetzgebers („Every law is a command or its opposite“). Wie für → HobbesHobbes, Thomas (1588–1679) ist auch für B. Gesetzgeber nicht derjenige, durch dessen Autorität Gesetze ursprünglich entstanden sind, sondern derjenige, durch dessen Autorität sie fortbestehen. Die Geltungsdauer des Rechts beruht auf der Tatsache des Gehorsams, der gewohnheitsmäßig einem Souverän entgegengebracht wird.
In den folgenden Jahren befasst sich B. hauptsächlich mit dem Problem einer Kodifikation als einer abschließenden und erschöpfenden Gesetzgebung, die selbstredend „according to the circumstances of all countries and governments“ sein soll, so wie es auch die |51|naturwissen schaftlichen Erkenntnisse sind. Trotz vielfältiger Bemühungen gelingt es ihm in den folgenden Jahren nicht, mit der Ausarbeitung einer Kodifikation beauftragt zu werden. Enttäuscht von der Aufnahme seiner Arbeiten und von der Reformunwilligkeit des englischen Parlaments, beschäftigt sich B. nach Bekanntschaft mit dem radikalen Demokraten James Mill mit Fragen der Politik und der Parlamentsreform in England. 1817, im selben Jahr in dem er zum bencher (governor) in Lincoln’s Inn ernannt wird, veröffentlicht er „A Catechism of Parliamentary Reform“ (bereits 1809 verfasst). Er schlägt jährliche Wahlen in etwa gleich großen Stimmbezirken, ein weitgehend gleiches Wahlrecht und geheime Stimmabgabe vor. Die Gesetzgebung soll Instrument zur Verwirklichung gesellschaftspolitischer Ziele, der Ersetzung der überkommenen Ordnung durch eine auf den Grundsätzen des Utilitarismus beruhende, sein. In den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts bildet sich in London ein Kreis von Anhängern und Schülern B.s, dem u.a. James und John Stuart Mill sowie Charles, Sarah und → John AustinAustin, John (1790–1859) angehören. Von 1823–26 gibt dieser Kreis die Westminster Review heraus, um die Grundsätze des „philosophical radicalism“ zu verbreiten. Der Einfluss dieser Gruppe führt zur Gründung des ersten säkularen Zweigs der University of London, dem University College. Nach B.s Tod in London am 6.6.1832 werden seine sterblichen Überreste seinen Anordnungen gemäß im Beisein seiner Freunde seziert, das Skelett wieder zusammengesetzt und mit seinen Kleidern und einem Wachskopf versehen in einer Glasvitrine im University College aufgestellt („Auto-Icon“). Der mumifizierte Kopf wird dem University College zu Forschungszwecken überlassen.
B. ist der bedeutendste Vertreter des englischen Utilitarismus des 18./19. Jahrhunderts, einer Morallehre, die alles Handeln unabhängig vom Motiv daran misst, inwieweit es geeignet ist, das Glück des Individuums im Rahmen des Wohlergehens aller zu fördern und in diesem Sinne nützlich zu sein („principle of utility“). Der Mensch ist nach B. durch die beiden Triebkräfte geprägt, Glück zu erlangen und Schmerz zu vermeiden. „His only object is to seek pleasure and to shun pain … These eternal and irresistible sentiments ought to be the great study of the moralist and the legislator. The principle of utility subjects everything to these two motives.“ B. erklärt, das englische Parlament verfolge „the greatest happiness of the ruling few“. Sein Ziel ist die Erreichung des größtmöglichen Glücks für die größtmögliche Anzahl („the greatest happiness of the greatest number“). Mit Hilfe der Gesetzgebung soll dies erreicht werden. Im historisch gewachsene Common |52|Law mit seinen unübersehbaren Präzedenzfällen sei der Bürger der Willkür von Richtern und Advokaten schutzlos preisgegeben. Diesen Zuständen soll mit einer Kodifikation des gesamten Common Law abgeholfen werden. Da nicht alle Einzelfälle erfasst werden können, soll sich die Kodifikation auf Generalklauseln stützen. „Whatever is not in the code of laws, ought not to be law … it is not possible to foresee every case which can happen … but they may be foreseen in their species.“ B.s Ideal ist die Lückenlosigkeit des Codex und damit die Gleichstellung von Gesetz und Recht. Für Gewohnheits- und Richterrecht ist dann kein Platz mehr. Die Kodifikation muss „complete“ und „cognoscible“ sein. Dazu ist eine klare und präzise Formulierung, und die Anordnung des Stoffes auf eine natürliche Art („natural order“), vergleichbar dem chemischen Periodensystem, erforderlich. Die Motive des Gesetzgebers müssen veröffentlicht werden. Durch die Schaffung einer solchen Kodifikation werde jeder Staatsbürger in die Lage versetzt, sein Gesetzbuch in der Tasche zu tragen und bei Bedarf zu benutzen. Der Richter werde auf die ihm zustehende Rolle bloßer Gesetzesanwendung beschränkt. Im Gegensatz zu → MontesquieuMontesquieu, Charles de Secondat, Baron de la Brède et de M. (1689–1755) geht B. davon aus, dass es das Utility-principle ermögliche, ein Gesetzbuch unabhängig von nationalen und kulturellen Besonderheiten und von Zeit und Ort zu schaffen. Der Inhalt dessen, was Glück und Wohlergehen seien, ist für B. einem Naturgesetz ähnlich für alle Menschen zu allen Zeiten gleich. Deshalb kritisiert B. auch die Historische Schule, insb. → G. HugoHugo, Gustav (1764–1844) und → F.C. v. SavignySavigny, Friedrich Carl v. (1779–1861) scharf. Sie würden die Rechtsgeschichte an die Stelle des Rechts setzen. Auch die moderne Naturrechtslehre lehnt B. ab. Im Rahmen seines naturwissenschaftlichen Ansatzes und seiner imperativen Rechtstheorie ist kein Raum für vorstaatliche Menschenrechte („nonsense upon stilts“), denn der Gesetzgeber allein ist berufen, mit positivem Recht „the greatest happiness of the greatest number“ sicherzustellen. Einschränkungen sind nicht vorgesehen, B.s Anspruch ist total („totality of any science“ schreibt B. in der Introduction). Eines Naturrechts als Gegenpol zum positiven Recht oder zu dessen Legitimation bedarf es nicht.
B. hinterließ ein umfangreiches Werk mit vielen unvollendeten und teilweise bis heute unveröffentlichten Schriften. Neben dem bisher angeführten enthalten seine Arbeiten umfangreiche Abhandlungen zum Beweis- und Strafprozessrecht, vielfältige Reformvorschläge, wie etwa der vieldiskutierte Entwurf für ein Modellgefängnis mit totaler Überwachung („Panopticon“), bis hin zu Themen wie Homosexualität, Geburtenkontrolle und Tierschutz. Einfluss auf das Zeitgeschehen hatte |53|B. über seine Schriften und über seine Schüler. „Kein Englischer Jurist hat die Nothwendigkeit einer umfassenden neuen Gesetzgebung mit solchem Feuer und so erfolgreich vertheidigt, als es Bentham getan hat,“ notierte → K.J. A MittermaierMittermaier, Karl Josef Anton (1787–1867) 1829. B.s Reformvorschläge führten etwa zur Reform des Straf- und Beweisrechts ab 1827. Seine allgemeine Rechtslehre und seine Abneigung gegen die neuzeitliche Naturrechtsidee beherrschten lange die Rechtswissenschaft in England und im Commonwealth. Wenn es ihm auch nicht gelang, selbst mit der Ausarbeitung einer Kodifikation beauftragt zu werden, konnte er doch ein allgemeines Bewusstsein für die Notwendigkeit von Reformen wecken und v.a. mit kleineren Monographien beachtliche Akzente in der rechtspolitischen Diskussion setzen. Auch deutsche Juristen wie → R. v. MohlMohl, Robert v. (1799–1875), → K.J. A MittermaierMittermaier, Karl Josef Anton (1787–1867) oder L. Warnkönig beriefen sich häufig auf ihn, wenn es um die Frage ging, wie die Gesetzgebung auf die dramatischen Veränderungen der Zeit zwischen 1750 und 1850 reagieren könne.
Hauptwerke: A Comment on the Commentaries (1775), erstmals 1928 von C.W. Everett veröffentlicht. – A Fragment on Government, 1776. – Defence of Usury, 1787 (deutsch: Vertheidigung des Wuchers, hrsg. v. J.A. Eberhardt, 1788). – An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1789 (deutsch: Eine Einführung in die Prinzipien der Moral und Gesetzgebung, 2013). – Panopticon; or, The Inspection House, 1791 (deutsch: Panoptikum oder das Kontrollhaus, 2013, hrsg. v. C. Welzbacher). – Traités des Législation civile et pénale, hrsg. von É. Dumont, 1802 (deutsch: Grundsätze der Civil- und Criminal-Gesetzgebung aus den Handschriften des englischen Rechtsgelehrten Jeremias Bentham, hrsg. v. F.E. Beneke, 1830). – Théorie des Peines et des Récompenses, hrsg. v. É. Dumont, 1811. – Tactique des Assemblées Législatives, hrsg. v. É. Dumont, 1816 (deutsch: Tactik oder Theorie des Geschäftsganges in deliberirenden Volksständeversammlungen, 1817). – A Catechism of Parliamentary Reform, 1817. – Codification Proposal, 1822. – The Rationale of judicial Evidence, 1827 (deutsch: Theorie des gerichtlichen Beweises, 1838). – Constitutional Code, 1830. – On the Anti-Codification, alias the Historical School of Jurisprudence 1830 (engl. u. deutsch: Ueber die Antikodificisten, alias die Historische Schule der Jurisprudenz, in: Denkschriften und Briefe zur Charakteristik der Welt und Litteratur, hrsg. v. W. Dorow, Bd. IV, 1840, 254ff.). – Deontology, or The Science of Morality, hrsg. v. J. Bowring, 1834 (deutsch: Deontologie oder die Wissenschaft der Moral, 1834). – Auto-Icon, or Farther Uses of the Dead to the Living, 1842 (engl. u. deutsch in: Auto-Ikone oder Weitere Verwendungsmöglichkeiten von Toten zum Wohle der Lebenden, hrsg. v. M. Hellenthal, 1995). – Principles of International Law in: J. Bowring (Hrsg.), Works II, 535ff. (deutsch: Jeremy Benthams Grundsätze für ein künftiges Völkerrecht und einen dauernden Frieden, hrsg. v. O. Kraus, 1915). – Of Laws in General (hrsg. v. H.L.A. Hart, 1970), erstmals 1945 unter dem Titel „The Limits of Jurisprudence Defined“ veröffentlicht. – J. Bowring |54|(Hrsg.): The Works of Jeremy Bentham, 11 vols., 1838–1843 (Ndr. 1962). – J.H. Burns, J.R. Dinwiddy, F. Rosen (Hrsg.): The Collected Works of Jeremy Bentham, 1968ff. – The Correspondence of Jeremy Bentham, hrsg. von T.L.S. Sprigge, I.R. Christie, A.T. Milne, J.R. Dinwiddy, S. Conway, 1968ff. – Bibliographie bei S. Ikeda, M. Otonash, T. Shigemori (Hrsg.) A Bibliographical Catalogue of the Works of Jeremy Bentham, 1989.
Literatur: O. Asbach: Vom Nutzen des Staates. Staatsverständnisse des klassischen Utilitarismus: Hume – Bentham – Mill, 2009. – C. Blamires: The French Revolution and the Creation of Benthamism, 2008. – C. Chaffee: Ist nicht Gleichheit der Ähnlichkeit vorzuziehen? Jeremy Bentham’s Auto-Ikone, in: J. Gerchow, Ebenbilder. Kopien von Körpern – Modelle des Menschen, 2002, 125ff. – H. Coing: Rudolf v. Ihering und Bentham: in: G. Weick (Hrsg.): 375 Jahre Rechtswiss. in Gießen, 1982, 1ff. – Ders.: Benthams Bedeutung für die Entwicklung der Interessenjurisprudenz und der allgemeinen Rechtslehre, in: Gesammelte Aufsätze II, 1986, 177ff. – J.E. Crimmins: On Bentham, 2004. – J.R. Dinwiddy: Bentham, 1989. – R. Harrison: Bentham, 22010. – H.L.A. Hart: Essays on Bentham. Studies in Jurisprudence and Political Theory, 1982. – J. Hatschek: Bentham und die Geschlossenheit des Rechtssystems, in: AöR 24 (1909), 442ff.; 26 (1910), 458ff. (dagegen: J. Lukas: Benthams Einfluß auf die Geschlossenheit der Kodifikation, in: AöR 26 [1910], 67ff.; 465ff.). – O. Höffe: Einführung in die utilitaristische Ethik, 52013. – W. Hofmann: Politik des aufgeklärten Glücks. Jeremy Benthams philosophisch-politisches Denken, 2002. – G. Hoogensen: International relations, security and Jeremy Bentham, 2005. – O. Hottinger: Eigeninteresse und individuelles Nutzenkalkül in der Theorie der Gesellschaft und Ökonomie von Adam Smith, Jeremy Bentham und John Stuart Mill, 1998. – A. Jung: Jeremy Bentham et les mesures de sûreté en droit actuel, 2008. – H. Jung: Ein Blick in Benthams „Panopticon“, in: Gefängnis u. Gesellsch. Gedächtnisschr. f. A. Krebs, hrsg. v. M. Busch u.a., 1994, 34ff. – P.J. Kelly: Utilitarianism and Distributive Justice. Jeremy Bentham and the Civil Law, 1990. – P.J. King: Utilitarian jurisprudence in America: the influence of Bentham and Austin on American legal thought in the 19th century, New York 1986. – G. Kramer-McInnis: Der „Gesetzgeber der Welt“. Jeremy Benthams Grundlegung des klassischen Utilitarismus unter besonderer Berücksichtigung seiner Rechts- und Staatslehre, 2008. – W. Koch: Jeremy Bentham als Steuer-Philosoph, in: FS Franz Böhm, 1975, 285ff. – D. Liebermann: From Bentham to Benthamism, in: Historic Journal 28 (1985), 199ff. – Ders.: The province of legislation determined. Legal theory in eighteenth-century Britain, 1989, 217ff. – J. de Lucas: Die Institutionalisierung des Öffentlichkeitsprinzips bei Bentham und in der französischen Kodifizierung, in: Rechtstheorie 21 (1990), 283ff. – S. Luik: Die Rezeption Jeremy Benthams in der deutschen Rechtswissenschaft, 2003. – D. Lyons: In the Interest of the Governed. A Study in Bentham’s Philosophy of Utility and Law, 21991. – M.P. Mack: Jeremy Bentham. An Odyssee of Ideas, 1962. – J.-C. Marschelke: Jeremy Bentham – Philosophie und Recht, 2008. – J. Oldham: From Blackstone to Bentham: common law versus legislation in eighteenth-century Britain, in: Michigan Law Review 89 (1990/91), 1637ff. – F. Rosen: Jeremy Bentham and Representative Democracy: A Study of the Constitutional Code, 1983. – G.J. Postema: Bentham and the Common Law Tradition, 1986. – N.L. Rosenblum: Bentham’s Theory of the Modern State, 1978. – P. Schofield: Utility and democracy: The political thought of |55|Jeremy Bentham, 2006. – J. Semple: Bentham’s Prison. A Study of the Panopticon Penitentiary, 1993. – A. Siegwart: Benthams Werke und ihre Publikation, in: Politisches Jahrbuch der Schweizerischen Eidgenossenschaft 24 (1910), 285ff. – J. Steintrager: Bentham (Political Thinkers Vol. 5, hrsg. v. G. Parry), 2004. – W. Teubner: Kodifikation und Rechtsreform in England, 1972, 132ff. – C. Welzbacher: Der radikale Narr des Kapitals. Jeremy Bentham, das „Panoptikum“ und die „Auto-Ikone“, 2011. – Jur., 79–81 (K. Lerch). – Jur.Univ. II, 751–755 (J.J. Moresco). – online: www.ucl.ac.uk/Bentham-Project und www.centrebentham.fr.
S. Luik