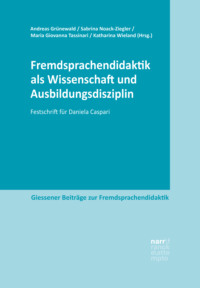Kitabı oku: «Fremdsprachendidaktik als Wissenschaft und Ausbildungsdisziplin», sayfa 6
4 Fazit
Anhand der nicht extensiven, aber an diversen Ankerbeispielen erfolgten qualitativen Analyse von Grammatikübungen in insgesamt 6 Lehrwerksgenerationen ist das Ergebnis ein eher ernüchterndes. Gewiss ist die formale Grammatikarbeit zugunsten eines an Fertigkeiten ausgerichteten Übens von Strukturen teils in den Hintergrund geraten, wie bei einer quantitativen Betrachtung gezeigt werden kann. Grammatikstrukturen sind im Laufe der Zeit vermehrt in textliche Zusammenhänge eingebettet worden. Ein wesentlicher Aspekt lernförderlicher Grammatikdarbietung in Übungszusammenhängen, der der Kohärenz, wird jedoch kaum zur Kenntnis genommen. Viele Übungen ziehen sich in nahezu identischer Konfektionierung von ein paar Aufhübschungen abgesehen über die Jahre hinweg durch die Lehrwerke. Bisweilen hat man den Eindruck, als ob das visuelle und methodische Gewand einer Grammatikübung und nicht die Klärung der Frage, wozu die grammatische Struktur, die es zu erlernen gilt, eigentlich dient, im Zentrum des Interesses steht. Waren die Impulse des kommunikativen Ansatzes in die Lehrwerke der 1980er bis 2000er Jahre deutlich, wenn auch nicht immer überzeugend, eingeflossen, so wenig scheint gegenwärtig der Übergang in das aufgabenorientierte Paradigma gelungen. Weiterhin sind Grammatikübungen nicht mehr als Vorstufen zu traditionellen Anwendungs- und Transferausgaben (vgl. Caspari, 2013, S. 6) und konzeptuell immer noch der ‹schwachen› Form des kommunikativen Unterrichts verpflichtet.
Grammatikerwerb im aufgabenorientierten Unterricht bedeutet die punktuelle, aber zielgerichtete Planung von Phasen, in denen der Sprachbedarf der Schüler/innen thematisiert, erkannt, benannt und beschrieben wird sowie, letztlich, verstanden und anwendbar wird. Diese Schritte leiten sich aus dem jeweiligen kommunikativen Bedarf heraus ab und führen im Rahmen einer fokussierten Lernaufgabe, bei der eine spezifische grammatische Struktur zur Bearbeitung erforderlich ist (siehe hierzu auch Caspari, 2013, S. 6-8; Ellis, 2001), zu einem Sprachstruktur bezogenen Übungsparcours. So kann Grammatik, um die Worte von Cuq/Gruca zu verwenden, zu «une sorte d’échafaudage qui aide à la construction de la compétence linguistique» (2005, S. 285f.) werden, die aber nicht Sprachwissen, sondern Einsicht in die Leistung von Sprache und Befähigung zu deren Anwendung in einem Sinnzusammenhang bedeutet. Was den kompetenzorientierten Fremdsprachenunterricht eigentlich ausmacht, darauf hat Daniela Caspari seit Jahren in vielen Beiträgen klar, deutlich und unmissverständlich hingewiesen. Sie muss und wird das Wort noch manches weitere Mal erheben müssen, wenn für Grammatikübungen etwas anderes gelten soll als die Devise der französischen Hauptstadt: Fluctuat nec mergitur!
Literatur
Alamargot, Gérard, Bruckmayer, Birgit, Darras, Isabelle, Koesten, Léo, Kunert, Dieter, Mühlmann, Inge, Nieweler, Andreas & Prudent, Sabine (2005). Découvertes 2. Stuttgart: Klett.
Bernklau, Simone, Boivin, Laure, Darras, Isabelle, Fischer, Grégoire, Lange, Ulrike C., Mischke, Christopher & Putnai, Marceline (2020). Découvertes 1. Stuttgart: Klett.
Beutter, Monika, Kaup, Lothar, Koesten, Léo, Leidinger, Günter, Müller, Andreas, Spengler, Wolfgang & Wolff, Udo (Hrsg.) (1994). Découvertes 1. Série verte. Stuttgart: Klett.
Beutter, Monika, Kaup, Kahl, Detlev, Koesten, Léo, Kunert, Dieter, Kunert, Ulrike, Leidinger, Günter, Müller, Andreas, & Spengler, Wolfgang (Hrsg.) (1995). Découvertes 2, Série verte. Stuttgart: Klett.
Bruckmayer, Birgit, Darras, Isabelle, Koesten, Léo, Mühlmann, Inge, Nieweler, Andreas & Prudent, Sabine (2004). Découvertes 1. Stuttgart: Klett.
Bruckmayer, Birgit, Jouvet, Laurent, Lange, Ulrike C., Nieweler, Andreas, Prudent, Sabine & Putnai, Marceline (2012). Découvertes 1. Série Jaune. Stuttgart/Leipzig: Klett.
Bruckmayer, Birgit, Jouvet, Laurent, Lange, Ulrike C., Nieweler, Andreas, Prudent, Sabine & Putnai, Marceline (2013). Découvertes 2. Série Jaune. Stuttgart/Leipzig: Klett.
Bürgel, Christoph & Reimann, Daniel (Hrsg.) (2017a). Sprachliche Mittel im Unterricht der romanischen Sprachen. Aussprache, Wortschatz und Morphosyntax in Zeiten der Kompetenzorientierung. Tübingen: Narr.
Bürgel, Christoph & Reimann, Daniel (2017b). Zum Stellenwert der sprachlichen Mittel im kompetenzorientierten Fremdsprachenunterricht. In Christoph Bürgel & Daniel Reimann (Hrsg.) Sprachliche Mittel im Unterricht der romanischen Sprachen. Aussprache, Wortschatz und Morphosyntax in Zeiten der Kompetenzorientierung 2017a (S. 7-16). Tübingen: Narr.
Caspari, Daniela (2013). Aufgaben im kompetenzorientierten Fremdsprachenunterricht. Praxis Fremdsprachenunterricht 4, 5-8.
Christ, Herbert (2000). Grammatische Instruktion an historischen Beispielen: Veneroni, Meidinger und Ploetz. In Henning Düwell, Claus Gnutzmann & Frank G. Königs (Hrsg.) Dimensionen der Didaktischen Grammatik. Festschrift für Günther Zimmermann zum 65. Geburtstag (S. 1-26). Bochum: AKS-Verlag.
Cuq, Jean-Pierre & Gruca, Isabelle (2005). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.
Ellis, Rod (2001). The metaphorical constructions of second language learners. In Michael P. Breen (Hrsg.) Learner contributions to language learning. New directions in research (S. 65-85). Harlow: Pearson Education.
Erdle-Hähner, Rita & Klein, Hans-Wilhelm (unter Mitwirkung von Charles Muller) (Hrsg.) (1971). Etudes Françaises, Ausgabe B, Teil 1. Stuttgart: Klett.
Gnutzmann, Claus (32019). Sprachliche Strukturen und Grammatik. In Wolfgang Hallet & Frank G. Königs (Hrsg.) Handbuch Fremdsprachendidaktik (S. 111-115). Seelze: Kallmeyer.
Göller, Alfred, Grunwald, Bernd, Lamp Monique und Reinhard & Rolinger, Hermann (Hrsg.) (1985). Etudes Françaises Echanges. Ausgabe Baden-Württemberg. Edition longue 2. Stuttgart: Klett.
Grunwald, Bernd, Lamp, Monique und Reinhard & Rolinger Hermann (Hrsg.) (1981). Etudes Françaises Echanges. Ausgabe Baden-Württemberg. Edition longue 1. Stuttgart: Klett.
Habermas, Jürgen (1971). Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz. In Jürgen Habermas & Niklas Luhmann (Hrsg.) Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie.Was bietet die Systemforschung? (S. 101-141). Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Halliday, Michael Alexander Kirkwood & Hasan, Ruqaiya (1976). Cohesion in English. London: Longman.
Klippel, Friedrike & Ruisz, Dorottya (2020). Historisch forschen in der Fremdsprachendidaktik. Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 31 (1), 7-21.
Koch, Corinna (2015). Dienen, nicht dominieren. Ein Plädoyer für die Instrumentalisierung von Grammatik im Französischunterricht. Der fremdsprachliche Unterricht Französisch 135, S. 2-9.
Legutke, Michael (32019). Kommunikative Kompetenz und Diskursfähigkeit. In Wolfgang Hallet & Frank G. Königs (Hrsg.) Handbuch Fremdsprachendidaktik (S. 70-75). Seelze: Kallmeyer.
Meidinger, Johann Valentin (1797; 1985). Praktische Französische Grammatik wodurch man diese Sprache auf eine ganz neue und sehr leichte Art in kurzer Zeit gründlich erlernen kann. 13. Ausgabe. Frankfurt.
Mertens, Jürgen (2006a). Sprechabsichten und kommunikative Ziele – A nos actes de parole. In Andreas Nieweler (Hrsg.) Fachdidaktik Französisch. Tradition – Innovation – Praxis (S. 167-173). Stuttgart: Klett.
Mertens, Jürgen (2006b). Grammatik – la grammaire est une chanson douce. In Andreas Nieweler (Hrsg.) Fachdidaktik Französisch. Tradition – Innovation – Praxis (S. 190-205). Stuttgart: Klett.
Mertens, Jürgen (2009). Geteiltes Wissen – doppelter Erfolg? Grammatik sprachenübergreifend lehren und lernen. französisch heute 40, 53-59.
Mertens, Jürgen (2013). Mets-toi à l’écoute! – Französischerwerb ganz privat …. Praxis Fremdsprachenunterricht 1, 4-6.
Mertens, Jürgen (2017). Aufgabenorientiertes Arbeiten. In Carola Surkamp (Hrsg.) Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik. Ansätze – Methoden – Grundbegriffe (S. 9-12). Stuttgart: Metzler.
Mertens, Jürgen (2018). Formen und Funktionen von Vokabelverzeichnissen in Lehrwerken der (neo-)kommunikativen Ära. In Hélène Martinez & Franz-Joseph Meissner (Hrsg.) Fremdsprachenunterricht in Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Marcus Reinfried (S. 245-274). Tübingen: Narr.
Mertens, Jürgen (2019). «Gut gebrüllt, Löwe!» – Konflikte erleben im Französischunterricht. Praxis Fremdsprachenunterricht – Französisch 3, 4-7.
Mindt, Dieter (1992). Zeitbezug im Englischen. Eine didaktische Grammatik des englischen Futurs. Tübingen: Narr.
Müller-Hartmann, Andreas & Schocker-von Ditfurth, Marita (32019). Task-Based Language Learning und Task-Supported Language Learning. In Wolfgang Hallet & Frank G. Königs (Hrsg.) Handbuch Fremdsprachendidaktik (S. 203-207). Seelze: Kallmeyer.
Nunan, David (1998). Teaching Grammar in Context. ELT Journal 52(2), 101-109.
Reinfried, Marcus (2001). Neokommunikativer Fremdsprachenunterricht: ein neues methodisches Paradigma. In Franz-Joseph Meissner & Marcus Reinfried (Hrsg.) Bausteine für einen neokommunikativen Französischunterricht. Lernerzentrierung, Ganzheitlichkeit, Handlungsorientierung, Interkulturalität, Mehrsprachigkeitsdidaktik (S. 1-20). Tübingen: Narr.
Schäfer, Elena (2017). Grammatik visuell. Mit grammatischen Erklärfilmen zu Ökonomie und Lernerfolg? In Christoph Bürgel & Daniel Reimann (Hrsg.) Sprachliche Mittel im Unterricht der romanischen Sprachen. Aussprache, Wortschatz und Morphosyntax in Zeiten der Kompetenzorientierung (S. 265-287). Tübingen: Narr.
Schumann, Adelheid (22017). Kommunikativer Fremdsprachenunterricht. In Carola Surkamp (Hrsg.) Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik (S. 163-166). Stuttgart: Metzler.
Segermann, Krista (2005). Schreiben wollen und schreiben können – Der bewusste Einsatz von lexikogrammatischen Bausteinen im fremdsprachlichen Lernprozess der Sekundarstufe I. französisch heute, 3, 241-254.
Siepmann, Dirk & Bürgel, Christoph (2015). L’élaboration d’une grammaire pédagogique à partir de corpus: l’exemple du subjonctif. In Thomas Tinnefeld (Hrsg.) Grammatikographie und didaktische Grammatik. Gestern – heute – morgen. Gedenkschrift für Hartmut Kleineidam anlässlich seines 75. Geburtstags (S. 159-185). Saarbrücken: htw saar.
Siepmann, Dirk (2016). Korpus, Konkordanz, Konstruktion: Was die Wortschatz- und Grammatikforschung dem Französischlerner und -lehrer heute zu bieten hat. französisch heute 4, 19-28.
Van den Branden, Kris (Hrsg.) (2006). Task-Based Language Education. Cambridge: CUP.
Weinrich, Harald (1982). Textgrammatik der französischen Sprache. Stuttgart: Klett.
Zimmermann, Günther (1969). Integrierungsphase und Transfer im neusprachlichen Unterricht. Praxis des neusprachlichen Unterrichts 16, 3, 245-260.
Grammatik und Kompetenzorientierung: une mésentente cordiale?
Elisabeth Kolb
Grammatik im Fremdsprachenunterricht mag gegenwärtig nicht das zentrale Thema des fremdsprachendidaktischen Diskurses sein. Aber es handelt sich sicher um das Thema, das periodisch immer wieder Kontroversen, Unsicherheiten oder Vorgaben auslöst. Schlaglichtartig wird hier beleuchtet, wie Bildungsadministration, Unterrichtsmaterialien und Fremdsprachendidaktik vor dem Hintergrund des aktuell dominanten Paradigmas der Kompetenzorientierung das Verhältnis von Grammatik und Kommunikation konzeptuell bestimmen und praktisch umsetzen.
1 Impressionen eines Missverhältnisses oder Missverständnisses
Grammatik als Teil von Sprache ist in allen Ansätzen des Fremdsprachenlehrens und -lernens ein Dreh- und Angelpunkt, ob sie nun als zentraler Inhalt und Ziel des Unterrichts angesehen oder ob ihr eher eine unter- oder nachgeordnete Bedeutung beigemessen wird. Verkompliziert wird die Diskussion um die Rolle von Grammatik dadurch, dass es neben dem unterschiedlichen Gewicht von Grammatik auch verschiedene, nicht immer klar ausgesprochene Vorstellungen gibt, was darunter überhaupt zu verstehen ist: Besonders mit der allmählichen Durchsetzung des Kommunikativen Ansatzes ab den 1970er Jahren werden formale und funktionale Grammatik, linguistische und didaktische Grammatik gegenübergestellt, und insbesondere wird „kommunikative Grammatik“ eingefordert (vgl. Rösler, 2007). Gerade bei dieser Bezeichnung bleibt offen, ob damit kommunikative Grammatik als Unterrichtsinhalt oder ein auf Kommunikation basierender Unterricht der grammatischen Inhalte gemeint ist (vgl. Rösler, 2007, S. 45). Die Verweise auf die „dienende Funktion“, die Piepho (1974, S. 61) der Grammatik hinsichtlich der Kommunikationsfähigkeit der Lernenden schon in der Mitte der 1970er Jahre zuwies, haben sich bis in das zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts erhalten.
Interessant ist nun, dass im Anschluss an die Etablierung des Kommunikativen Ansatzes in den 1970er und 1980er Jahren eine längere Diskussion zustande kam, die Grammatik und Kommunikation als Gegenpole darstellte (vgl. Rösler, 1983). Ab den 1990er Jahren scheint in Deutschland in der Fremdsprachendidaktik und Sprachlehrforschung weder diese stark vereinfachende Gegenüberstellung noch die Grammatikvermittlung als generelle Herausforderung eine große Rolle zu spielen (vgl. Königs, 2011). Gleichzeitig wirkt die Grundannahme einer Unterordnung von Korrektheit der Formen unter freie, selbstbestimmte Kommunikation (vgl. Gnutzmann, 2005) auf der Ebene der Unterrichtspraxis weiter. Diese liegt beispielsweise einigen der Fragen zugrunde, die von Referendar/innen gemeinsam mit ihren Seminarlehrkräften in einem Forschungsprojekt formuliert wurden: „Ist ein kognitives Erarbeiten der isolierten Formen in einem kompetenzorientierten Unterricht zeitgemäß? […] Welchen Stellenwert haben einfache, geschlossene Aufgaben gegenüber offenen, kreativen Aufgaben?“ (Kolb & Angelovska, 2017, S. 328). Diese Fragen spiegeln viele Unsicherheiten über die Rolle von Grammatik im Fremdsprachenunterricht wider. Einige Facetten der gegenwärtigen Diskussion sollen im Folgenden für Englisch und Französisch als den beiden Fremdsprachen der Bildungsstandards gemeinsam angeschnitten werden. Zu vielen der ausgewählten Teilaspekte hat Daniela Caspari wichtige Impulse für den Französischunterricht, aber auch für den Fremdsprachenunterricht insgesamt gegeben.
2 Sprachliche Mittel bei der Kompetenzorientierung in administrativen Dokumenten
Die Fremdsprachendidaktik setzt sich inzwischen stark mit Kompetenzorientierung als dem dominanten Paradigma des Fremdsprachenunterrichts zu Beginn des 21. Jahrhunderts auseinander. Dies ist auch verständlich, denn der Kommunikative Ansatz und kompetenzorientierter Fremdsprachenunterricht weisen große Überschneidungen auf. Dennoch ist Kompetenzorientierung – ohne hier ihre Genese oder die Debatten darum nachvollziehen zu wollen – v. a. in bildungspolitischen und -administrativen Dokumenten verankert. Besonders starke Wirkung geht dabei aufgrund der Vereinheitlichungsbestrebungen im föderalen Bildungswesen von den Bildungsstandards für den Hauptschulabschluss, den Mittleren Schulabschluss und die Allgemeine Hochschulreife aus. Genau dort findet sich auch wiederholt und explizit das Schlagwort von der „dienenden Funktion“ der sprachlichen Mittel, d. h. von Wortschatz, Grammatik, aber auch Intonation und Orthographie (vgl. KMK, 2003, S. 14; 2004, S. 13; 2012, S. 18).
Die Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife formulieren für die sprachlichen Mittel als untergeordnetem Teilbereich der funktionalen kommunikativen Kompetenz Kompetenzerwartungen wie „[d]ie Schülerinnen und Schüler […] können ein gefestigtes Repertoire der grundlegenden grammatischen Strukturen für die Realisierung ihrer Sprech- und Schreibabsichten nutzen“ (KMK, 2012, S. 18). Damit wird der Fokus auf die Sprachverwendung gelegt. Für die Unterrichtsebene bleibt aber die Frage nach dem konkreten Repertoire offen. Ebenso unbeantwortet ist die Frage nach dem Stellenwert korrekter Formbildung, die in der Unterrichts- und Prüfungspraxis immer die Gemüter bewegt, denn es herrscht weder Konsens darüber, was „gefestigt“ bedeutet noch ob und wie die kommunikativen Absichten tatsächlich verwirklicht werden. Die Hinweise auf „gelingende Kommunikation“ (KMK, 2012, S. 18) oder auf das Ziel von „differenziertem kommunikativem Sprachhandeln“ (KMK, 2012, S. 15) können und wollen diese Fragen nicht beantworten.
Ähnlich gehen die Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss und den Hauptschulabschluss vor. Während auch dort erfolgreiches kommunikatives Handeln als Ziel zugrundeliegt, werden Kann-Beschreibungen formuliert, indem Satztypen wie Fragen, Aufforderungen, inhaltliche Kriterien wie zeitliche, örtliche oder logische Bezüge, aber auch einzelne grammatische Strukturen wie Aktiv/Passiv oder indirekte Rede und deren Funktion gelistet werden (vgl. KMK, 2003, S. 15; 2004, S. 14). Somit ist die Aussage, dass keine Listen angeführt werden (vgl. KMK, 2003, S. 14; 2004, S. 13) nicht ganz zutreffend, auch wenn die Bestimmung konkreter Grammatikinhalte den Ländern übergeben wird. Andererseits wird ein indirekter Versuch gemacht, auch Korrektheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, indem auf den GeR verwiesen wird (vgl. KMK, 2003, S. 14; 2004, S. 13). Dort wird zwar eine individuelle Entscheidung auf Anwendungsebene empfohlen, da eine grammatische Progression, die für alle Sprachen zuträfe, nicht möglich sei, gleichzeitig aber z. B. für B1 neben einem angemessenen Repertoire häufiger Strukturen auch Folgendes genannt: „reasonable accuracy“, „generally good control“ und „errors […] but it is clear what he/she is trying to express“ (Council of Europe, 2001, S. 114). Somit wird das Dilemma der grammatischen Progression (vgl. Barkowski, 2006) – sie ist oft de facto durch die Verwendung von Lehrwerken gesetzt und folgt oft eher Traditionen oder subjektiven Einschätzungen als spracherwerbstheoretischen Erkenntnissen oder linguistischen Überlegungen – an die einzelnen Lehrpläne weitergegeben. Verschiedene deutsche Länder bilden die in den Bildungsstandards propagierte „dienende Funktion“ der Grammatik daher auch unterschiedlich ab.
So führt der bayerische LehrplanPLUS für alle Schulformen und alle Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I Listen von konkreten Grammatikphänomenen auf. In diesem Lehrplan werden grammatische Strukturen und ihre Funktionen bzw. Intentionen auf Deutsch beschrieben und im Anschluss die zugeordneten Phänomene in der Fremdsprache genannt, z. B.:
beschreiben Handlungen, Abläufe und Gewohnheiten in der Gegenwart und sprechen über Vergangenes:Hilfs- und Modalverben: be, have (got), do; can, must, needn’t, mustn’tpresent tense simple / present tense progressivesimple past (BY, 2017/18)
Ganz ähnlich geht der Kernlehrplan in Nordrhein-Westfalen vor, allerdings ist hier eine größere Offenheit dadurch gegeben, dass lediglich Kompetenzerwartungen für das Ende der Sekundarstufe I formuliert werden, die als fachliche Konkretisierung einzelne Strukturen nennen (vgl. NW, 2019). Im Berliner und Brandenburger Rahmenplan, der für alle Fremdsprachen gemeinsam gilt, wird die größtmögliche Öffnung präsentiert, indem lediglich angelehnt an die GeR-Stufen Kann-Beschreibungen auf verschiedenen Anforderungsstufen formuliert werden wie: „in vertrauten Alltagssituationen und zu bekannten Themen erfolgreich sprachlich agieren und bei der Verwendung eines größer werdenden Repertoires sprachlicher Mittel zunehmend Sicherheit erlangen [orientiert an A2/GeR]“ (BE & BB, 2015, S. 29). Konkretere Bestimmungen werden den schulinternen Curricula und den Lehrwerken überlassen. In allen Beispielen wird versucht, die Funktion von Grammatik für die Kommunikation darzustellen. Durch das Aufführen von Kann-Beschreibungen wird angedeutet, dass Sprachkönnen vor Sprachwissen und eigenständige Anwendung vor angeleitetes Lehren gestellt wird, während Inventare in Listenform dieser Schwerpunktsetzung nur unzureichend entsprechen.