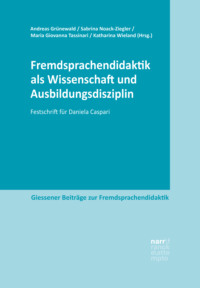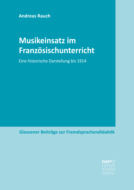Kitabı oku: «Fremdsprachendidaktik als Wissenschaft und Ausbildungsdisziplin», sayfa 7
3 Lösungsvorschläge auf der unterrichtlichen Ebene
Administrative Dokumente können nicht mehr als generelle Leitlinien bieten, nicht aber auf die Fragen eingehen, die sich viele Lehrkräfte in Bezug auf Ziele, Inhalte, Methoden und Materialien des Grammatikunterrichts stellen. Somit mag man sich eher aus aktuellen Lehrbüchern Antworten auf das Verhältnis zwischen Grammatik und kompetenzorientiertem Fremdsprachenunterricht erhoffen. Dabei zeigt bereits ein Blick in die Inhaltsverzeichnisse einiger Englisch- und Französischlehrbücher, die ab dem zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts erschienen sind, dass der schon in der Vorgängergeneration gewählte funktional-notionale Ansatz fortwirkt. Dabei ist es unerheblich, ob die Spalten im Inhaltsverzeichnis mit „Kommunikation“, „(Kommunikative) Kompetenzen“, „Kommunikative Schwerpunkte“ oder „(Lern-)Inhalte“ überschrieben sind: Alltägliche Situationen, angenommene Kommunikationsbedürfnisse, Sprachfunktionen und grammatische Strukturen werden einander mehr oder weniger deutlich zugeordnet. So ist die Verbindung von der Vorstellung einer Familie und der Einführung von Possessivpronomen noch recht einsichtig. Weniger kommunikativ überzeugend ist die Einführung von Mengenangaben bei der Beschreibung des Wohnortes oder die Verbindung von Modalverben mit der Planung einer Geburtstagsfeier. Über den konkreten, im Lehrbuch gewählten Zusammenhang hinaus lässt sich mit derartigen Zuordnungen recht wenig über das Verhältnis von Grammatik und Kommunikation aussagen.
Sobald es an die Begegnung mit bzw. den Erwerb von neuen grammatischen Strukturen geht, setzen sich ebenfalls bekannte Traditionen der Grammatikvermittlung fort. In den Lektionen der aktuellen Lehrbücher der Schulbuchverlage wird anhand eines konstruierten Textes die neue Struktur eingeführt. Deren Form und Funktion soll von den Lernenden meist induktiv erschlossen werden, ggf. folgt ein etwas deutlicherer Fokus auf die Form. Es schließen sich geschlossene Übungen an, z. B. Satzumformungen oder Lückentexte, die eine einzige Form zulassen. Gelegentlich finden sich offenere Lückentexte oder Texte, in denen Fehler korrigiert werden müssen. Während all diese Formate oft auf der Stufe des reproduzierenden Übens angesiedelt sind, gibt es auch freiere Angebote, welche die Lernenden als sie selbst sprechen oder schreiben lassen, z. B. indem die Lernenden Dialoge über persönliche Themen führen, bei denen sie eine bestimmte Struktur verwenden müssen. Es scheint sich um bewährte Formate zu handeln, die von Lehrkräften gewünscht werden und die für Lernende nachvollziehbar sind. Somit zeigt sich, dass relativ explizite, formfokussierte Grammatikvermittlung immer noch ein Angebot an die Praxis ist.
Im Unterschied zu den Vorgängerlehrbüchern der Schulbuchverlage finden sich gegen Ende der einzelnen Lektionen eine oder mehrere Lernaufgaben. Selbst wenn diese, wie in manchen Lehrbüchern üblich, bereits zu Lektionsbeginn unter Nennung möglicher sprachlicher Mittel angekündigt werden, bleibt meist offen, ob ganz bestimmte Strukturen verwendet werden müssen oder lediglich verwendet werden können. Letzteres entspräche dem realistischen, außerschulischen Sprachgebrauch, in dem Themen, Absichten oder Sprechakte auf unterschiedliche Weise versprachlicht werden können. So scheinen die neuen, der Kompetenzorientierung verpflichteten Schulbücher viel deutlicher als Werke der kommunikativen Ära die Prinzipien der An- und Verwendung von Sprache zu realisieren und somit Grammatik der Kommunikation unterzuordnen. Gleichwohl kann eine gewisse Beliebigkeit der Lernaufgaben, die sich nicht immer konsequent aus der Lektion ergeben, sowie ihre Position am Ende der Lektionen ihre eigentlich wichtige Bedeutung wieder einschränken. Lehrkräfte und Lernende können sich fragen, ob es sich um eine schöne Zusatzaktivität handelt, die bei freier Zeit durchgeführt werden kann bzw. inwieweit die Lerninhalte der Lektion für die Bewältigung der Aufgabe überhaupt nötig und relevant sind.
Diese Unsicherheit kann verstärkt werden, wenn sprachliche Mittel nicht mehr explizit und separat in Leistungserhebungen geprüft werden, sondern die Verwendung der sprachlichen Mittel lediglich eine Teilbewertung bei den produktiven Kompetenzen erfährt. Ein Beispiel dafür sind die Musteraufgaben für Englisch in der Sekundarstufe I aus Niedersachsen, in denen die Überprüfung sprachlicher Mittel in dem Kapitel „Mündliche und andere fachspezifische Leistungen“ (NI, 2020, S. 206) am Ende des Materialbandes nur gestreift wird, während die Formate, welche die fünf kommunikativen Kompetenzen abprüfen, ausführlich dargestellt werden. Dass die Beherrschung dieser Kompetenzen das Unterrichtsziel ist, dürfte unstrittig sein. Der Weg dorthin ist für Lehrende – und vielleicht auch für Lernende – so jedoch nur schwer erkennbar, besonders wenn die Lehrwerke weiterhin dem traditionellen Dreischritt Einführung – Übung – Anwendung verhaftet bleiben.
Dagegen setzt es sich eine Handreichung aus Berlin und Brandenburg explizit zum Ziel, Grammatik und Kommunikation gleichermaßen zu berücksichtigen. Sie geht davon aus, dass die „dienende Funktion der Grammatik […] am deutlichsten im Stellen einer Aufgabe, zu deren Bearbeitung die Schüler/innen bestimmte grammatikalische Kenntnisse […] benötigen“ (LISUM, 2011, S. 9), umgesetzt wird. Für Französisch bezieht sich der Unterrichtsvorschlag auf die Stellung und Deklination von Adjektiven, die in eine Teilnahme an einer Modenschau integriert ist (vgl. LISUM, 2011, S. 13). Dabei erfolgt zuerst die inhaltliche Auseinandersetzung mit dieser fiktiven Situation, indem die Lernenden einen anspruchsvollen authentischen Text lesen und Fragen zum Leseverstehen beantworten, die sie auf die Aufgabe einstimmen. Anschließend erarbeiten sie sich mithilfe weiterer authentischer Texte induktiv und auf Deutsch die Regeln für die Stellung von Adjektiven und die verschiedenen Genus- und Numerus-Formen (vgl. LISUM, 2011, S. 13). Zuletzt sollen die Lernenden ihre neu erworbenen grammatischen Erkenntnisse bei der inhaltlichen und sprachlichen Bewältigung der Aufgabe – Entwurf und Beschreibung eines Outfits – verwenden. In dieser schüler/innennahen und altersgerechten Aufgabe wird versucht, Grammatik dem durchgängigen thematischen Fokus unterzuordnen. Bei diesem relativ eindeutigen Aspekt der Grammatik ist dies recht leicht zu bewerkstelligen. Bei einem schwierigeren grammatischen Phänomen wäre allerdings vielleicht der Schritt von der Bewusstmachung zur freien Anwendung etwas groß. Auch schwankt das Raster für die Einschätzung der Leistung zwischen inhaltlichen Kriterien (z. B. „explique le style“ oder „décrit tous les vêtements et accessoires“), offenen sprachlichen Kriterien („utilise des adjectifs“) und recht restriktiven sprachlichen Kriterien („respecte les règles pour la position et la forme des adjectifs“ bzw. „n’a pas fait de fautes d’orthographe“) (LISUM, 2011, S. 32). An dieser Stelle wäre zumindest ein Hinweis zur Gewichtung hilfreich.
4 Einige Impulse aus der deutschen Fremdsprachendidaktik
Wenn sich nun in den Dokumenten und Materialien, auf die sich Lehrkräfte in ihrer Praxis direkt beziehen, verschiedene Ansätze nebeneinander finden, so kann es interessant sein, in der Fremdsprachendidaktik nach weiteren Erkenntnissen zu suchen. Wie schon im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre festgestellt wurde, ist Grammatik – abgesehen von einer Vielzahl an konkreten Unterrichtsvorschlägen – in der deutschen Fremdsprachendidaktik oft ein eher zurückhaltend behandeltes Thema (vgl. Rösler, 2007; Königs, 2011). Einige, durch die relativ geringe Zahl umso hervorstechendere Positionen sollen im Folgenden herausgegriffen werden, wobei sich durchaus unterschiedliche Tendenzen in der Englisch- und Französischdidaktik zeigen.
4.1 Appelle an die „dienende Funktion“ der Grammatik
Besonders auffällig ist, dass das Schlagwort von der „dienenden Funktion“ der Grammatik vorwiegend in der Französischdidaktik verwendet wird (z. B. Caspari, 2009; Schmelter, 2013; Koch, 2015). Oft wird auch eine Erklärung mitgeliefert, warum eben diese untergeordnete, unterstützende Funktion so explizit dargestellt wird: Französisch steht noch immer im Ruf, ein grammatiklastiges, schwieriges Schulfach zu sein, was möglicherweise die hohe Zahl an Lernenden erklärt, die Französisch nach der Pflichtbelegung abwählen (vgl. Caspari, 2009, S. 74). Daher mag es für den Französischunterricht immer noch eher geboten erscheinen, der Grammatikvermittlung in Anlehnung an Tendenzen im Englischunterricht weniger Bedeutung zuzuweisen: Er erhält traditionell aufgrund des Formenreichtums der französischen Sprache und des großen Gewichts der Sprachnorm im Französischen, aber auch aufgrund einer gewissen Klarheit, Eindeutigkeit und Einfachheit für Unterrichts- und Prüfungsgestaltung sowieso (zu) viel Gewicht (vgl. v. a. Schmelter, 2013, S. 76f.). Stattdessen wird auf die Orientierung an „kommunikativen Absichten“ (Caspari, 2009, S. 77), die „Bewältigung kommunikativer Aufgaben“ (Schmelter, 2013, S. 78) oder die „lebensweltliche Nützlichkeit“ (Koch, 2015, S. 4) verwiesen.
Die drei hier angeführten Veröffentlichungen zeigen insofern große Parallelen, als sie die Fokussierung der Lehrbücher auf eine grammatische Progression bzw. den traditionellen Dreischritt bei der Vermittlung von Grammatik problematisieren (vgl. Caspari, 2009, S. 77; Schmelter, 2013, S. 78f.; Koch, 2015, S. 4f.). Caspari, in deren Beitrag zur Kompetenzorientierung des Französischunterrichts Grammatik nur ein Teilaspekt ist, hebt besonders auf „beiläufiges“ Lernen sprachlicher Formen im Rahmen der inhaltlichen Auseinandersetzung mit nicht-didaktisierten Texten ab und verweist dabei auf den Ansatz der Aufgabenorientierung (vgl. Caspari, 2009, S. 78). Auch Schmelter fordert „kommunikative und bedeutsame produktive Aufgaben“ (Schmelter, 2013, S. 83). Gleichzeitig mahnt er – auch unter Verweis auf empirische Studien zur Wirksamkeit von Verfahren, aber auch zu angenommenen Erwerbssequenzen – besonders im Anfangsunterricht eine Beschränkung von Grammatik und eine Toleranz gegenüber falschen Formen an (vgl. ebd., S. 84). Koch versucht noch stärker, alle Aspekte, die Lehrkräfte beschäftigen, unter einen Hut zu bringen, indem sie „Flüssigkeit, Korrektheit und Elaboriertheit“ (Koch, 2015, S. 6) gleichermaßen nennt und neben dem Ziel der inhaltsorientierten Kommunikation auch die „Verbesserung des sprachlichen Outputs“ (ebd., S. 4) durch verschiedene methodische Verfahren nennt.
4.2 Potentiale und Grenzen der Aufgabenorientierung
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Kompetenzorientierung ist die schon länger beachtete Aufgabenorientierung (vgl. Bausch et al., 2006) stärker in den Vordergrund getreten. Die Englischdidaktik (vgl. z. B. Müller-Hartmann & Schocker-von Ditfurth, 2011, S. 35-56) interessiert sich deutlich für diesen Ansatz, aber auch in der Französischdidaktik findet er in den letzten Jahren immer mehr Resonanz (vgl. z. B. Caspari, 2009, S. 77). Dabei zeigt bereits eine kursorische Durchsicht wichtiger Publikationen, dass die Diskussion in der deutschen Fremdsprachendidaktik im Vergleich zur internationalen Literatur durchaus etwas anders verläuft. Zwar läge ein Missverständnis vor, wenn man annähme, dass aufgabenorientierte Ansätze in der internationalen Literatur rein auf Sprachverwendung und Kommunikation in möglichst realitätsnahen Kontexten abzielen. Dennoch könnten die Überlegungen und Beispiele gelegentlich so wirken, als sei die Beschäftigung mit sprachlichen, grammatischen Aspekten „quite haphazard and unsystematic“, „a mere appendix“ oder sogar „superfluous“ (Niemeier, 2017, S. 35). Hauptsächlich dürfte dies daran liegen, dass meist keine oder nur wenig Diskussion darüber erfolgt, wie neue Strukturen im task cycle eingeführt bzw. erworben werden können, sondern dass implizit davon ausgegangen wird, dass die Lernenden formale Aspekte grammatischer Mittel entweder bereits beherrschen bzw. quasi nebenbei erwerben oder dass zumindest unklar bleibt, wann explizite Spracharbeit stattfinden soll.
Das Bewusstsein für diese Problematik dürfte ein Grund sein, warum in der deutschen Debatte sprachlichen Aspekten bei der Aufgabenerfüllung tendenziell mehr Gewicht eingeräumt wird als in der internationalen Literatur. So wird wiederholt angesprochen, ob bzw. dass und wann ein expliziter Fokus auf Grammatik Teil einer Aufgabe sein soll (z. B. Müller-Hartmann & Schocker-von Ditfurth, 2011, S. 220-223). Die stärkere Berücksichtigung expliziter Spracharbeit mag auch erklären, warum in der deutschen Fremdsprachendidaktik Aufgabenorientierung adaptiert wird: So wird der Ansatz des „task-supported language learning“ vertreten (Müller-Hartmann & Schocker-von Ditfurth, 2011, S. 16); es werden Übungen, gelenktere „Lernaufgaben I“ bzw. auf situative, freie Interaktion abzielende „Lernaufgaben II“ unterschieden (vgl. Leupold, 2008), oder es wird von „the two learning targets, i. e., the communicative one and the grammatical one“ (Niemeier, 2017, S. 37) gesprochen. In diesen abwägenden Positionen, die beide Aspekte beachten wollen, spiegelt sich wohl die Erkenntnis, dass beides verbunden werden sollte.
Damit diese wichtige Feststellung auch in der Praxis Wirkung entfalten kann, sind allerdings überzeugende Ausarbeitungen von Aufgaben nötig. Wenn aber – wie immer noch in manchen Lehrwerken – kein direkter Bezug zwischen Grammatik und Aufgabenerfüllung hergestellt wird, ist die Überzeugungskraft der Vorgehensweise eingeschränkt. Dasselbe trifft zu, wenn Aufgabenvorschläge auf idealisierenden Annahmen zum Ablauf verschiedener Phasen beruhen:
Whereas the pre-task phase sets the stage for the communicative topic […] and already makes the learners subconsciously and passively familiar with the grammatical phenomenon […], the task itself stays within the communicative domain but demands the learners’ active use of the grammatical construction […] and the language focus acquaints the learners in a structured and inductive way with the form as well as with the meaning of the grammatical construction they already used during the task, ideally followed by a transfer to another word field or topic. (Niemeier, 2017, S. 37)
Wenn das Beispiel für die Verbmorphologie bei der 3. Person Singular des Präsens (-s) sich darauf fokussiert, dass möglichst viele korrekte, aber extrem eng vorgegebene Sätze zu Vorlieben und Abneigungen in Bezug auf Pizzazutaten gebildet werden sollen (vgl. Niemeier, 2017, S. 88-91), dann ist zwar die Thematik schüler/innennah, so dass vielleicht ein Kommunikationsbedürfnis der Lernenden angesprochen wird. Die Durchführung erinnert aber an pattern drills der vorkommunikativen Zeit, auch wenn darüber hinaus eine Bewusstmachung der korrekten Struktur vorgesehen wird. Dies kann dann neben der völlig freien, ungehemmten Kommunikation ohne Fokus auf Korrektheit wie der andere Pol wirken, nämlich wie eine Rückkehr zu althergebrachten Verfahren, bei denen die Situation lediglich Vorwand für einen Fokus auf die korrekte Form ist.
4.3 Ein Revival der Beschäftigung mit dem Üben
In diesem Gesamtkontext ist es sehr wichtig, dass die Fremdsprachendidaktik sich der lange vernachlässigten Frage der Definition und der Rolle des Übens bzw. von Übungen beim Fremdsprachenlehren und -lernen in den letzten Jahren wieder vermehrt zugewandt hat. Besonders deutlich zeigt sich das darin, dass dieses Thema 2016 im Fokus der Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts stand (vgl. Burwitz-Melzer et al., 2016), wobei auf die Vielzahl der Aspekte hier nicht eingegangen werden kann. Besonders bedeutend erscheint allerdings im Rahmen der Kompetenzorientierung als Leitparadigma und somit auch für die Praxis der Unterrichtsplanung und -gestaltung die in vielen Beiträgen getroffene Feststellung, dass Üben als Zwischenschritt zum Fremdsprachenlernen und auch zum kompetenzorientierten Fremdsprachenunterricht gehören kann und muss. Klar tritt in vielen Beiträgen zutage, dass eine Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von unterrichtlichen Lern- und außerschulischen Verwendungssituationen nötig ist, das unausgesprochen vielen Grundannahmen zum kompetenzorientierten Unterricht ebenso wie zum Üben zugrundeliegt (vgl. auch Klippel & Caspari, 2013) und das auch die Frage des Transfers miteinschließt. Noch deutlicher wird formuliert, dass es verschiedene Vorstellungen vom Üben gibt, so dass noch eine genauere Bestimmung von Konzepten und Begriffen wie „Aufgabe“, „Übung“, „Kompetenz“, „Erwerb“, „Lernen“ oder „Anwendung“ wichtig erscheint. Casparis Fazit schneidet viele Aspekte anderer Beiträge an:
Auch beim kompetenz- bzw. aufgabenorientierten Lernen müssen Schüler/innen üben, um sich sprachlich zu verbessern. Aber anders als im PPP-Ansatz tun sie es fokussiert und systematisch auf ein ihnen von Anfang an bekanntes, vergleichsweise enges kommunikatives Ziel hin. Und da in beiden Ansätzen die Bewusstheit, welche Ziele ein Übungsangebot verfolgt und welche Funktion ihm daher im Lernprozess zukommt, den Lernerfolg erhöhen sowie differenziertes Lernen und den Erwerb von Lernerautonomie unterstützen dürfte, sollte das konkrete Übungsziel m. E. bei jedem Übungsangebot, auch jeder einzelnen Übung in Lehrwerkeinheiten, angegeben werden. (Caspari, 2016, S. 48)
5. Das Vermittlungsangebot einer multiperspektivischen Sicht auf Grammatik
In diesem letzten Zitat wird deutlich, dass eine Vielfalt an Aspekten mitspielt, wenn man sich über das Verhältnis von Grammatik und Kommunikation im Fremdsprachenunterricht äußert. Wichtig wären hierbei auch die Meinungen der Lehrkräfte und noch viel interessanter die Sicht der Lernenden nicht nur auf bestimmte Übungen oder Aufgaben, sondern auch auf die Bedeutung, die sie selbst Grammatik und ihrer Bewusstmachung zuschreiben (vgl. Gnutzmann & Bohnensteffen, 2012). Wünschenswert ist auch eine größere Anzahl an empirischen Studien zur Wirksamkeit bestimmter Verfahren der Grammatikarbeit oder zum Interface von Grammatikwissen und Sprachkönnen. Ohne Anhänger von processability- oder teachability-Theorien sein zu müssen, könnte eine Orientierung an dem, was Lernende sich im Bereich der Grammatik wünschen und gleichzeitig auch leisten können, die Debatte entspannen, indem die grammatische Progression der Lehrwerke als ein Angebot unter vielen wahrgenommen wird. Ein anderes Angebot ist es, im Sinne der Lexikogrammatik Grammatik und die deutlich weniger kontroverse – wenn auch noch weniger in der Fremdsprachendidaktik beachtete – Lexik zu integrieren.
Grammatik im Spannungsfeld von Korrektheit der Form und Relevanz für die Bewältigung von Kommunikationssituationen und Kommunikation im aktuellen Rahmen des Paradigmas der Kompetenzorientierung – dabei handelt es sich um ein Verhältnis, das immer noch offen ist. Vielleicht lässt sich diese Beziehung auch nicht endgültig klären. Zugrunde liegt ihr die Debatte über die Ziele des Fremdsprachenunterrichts, die trotz oder gerade wegen der gegenwärtig starken Setzung eines bestimmten Ansatzes nicht beendet ist und nicht vergessen werden darf. Auch wenn das Thema Grammatik wie schon in den vergangenen Jahrzehnten nicht zentral in der Fremdsprachendidaktik ist, so lassen die in den letzten Jahren etwas zahlreicheren Publikationen zu den sprachlichen Mitteln (vgl. u. a. Bürgel & Reimann, 2017) doch auf eine theoretisch fundierte und gleichzeitig praktikable Annäherung und Aushandlung zwischen Grammatik und Kommunikation hoffen. Für die alltägliche Unterrichtspraxis zentral und relevant ist dieses Verhältnis auf jeden Fall.
Literatur
Barkowski, Hans (2006). Grammatical competence and the concept of progression in the light of research on language acquisition and the working brain. In Theo Harden, Arnd Witte & Dirk Köhler (Hrsg.) The concept of progression in the teaching and learning of foreign languages (S. 45-52). Oxford: Peter Lang.
Bausch, Karl-Richard, Burwitz-Melzer, Eva, Königs, Frank G., Krumm & Hans-Jürgen (Hrsg.) (2006). Aufgabenorientierung als Aufgabe. Arbeitspapiere der 26. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen: Narr.
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus [= BY] (2017/18). LehrplanPLUS. Englisch 5 (1. Fremdsprache). www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/gymnasium/5/englisch [30.11.2020].
Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie & Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg [= BE & BB] (2015). Teil C: Moderne Fremdsprachen. Jahrgangsstufen 1-10. www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/faecher-rahmenlehrplaene/rahmenlehrplaene/ [30.11.2020].
Bürgel, Christoph & Reimann, Daniel (2017). Sprachliche Mittel im Unterricht der romanischen Sprachen: Aussprache, Wortschatz und Morphosyntax in Zeiten der Kompetenzorientierung. Tübingen: Narr.
Burwitz-Melzer, Eva, Königs, Frank G., Riemer, Claudia & Schmelter, Lars (Hrsg.) (2016). Üben und Übungen beim Fremdsprachenlernen: Perspektiven und Konzepte für Unterricht und Forschung. Arbeitspapiere der 36. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts. Tübingen: Narr.
Caspari, Daniela (2009). Kompetenzorientierter Französischunterricht: Zentrale Prinzipien und ihre Konsequenzen für die Planung von Unterricht. Französisch heute 40(2), 73-78.
Caspari, Daniela (2016). Eine oder mehrere Kompetenzen schulen? Oder: Zum Stellenwert des Übens in komplexen Lernaufgaben. In Eva Burwitz-Melzer, Frank G. Königs, Claudia Riemer & Lars Schmelter (Hrsg.) Üben und Übungen beim Fremdsprachenlernen: Perspektiven und Konzepte für Unterricht und Forschung. Arbeitspapiere der 36. Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts (S. 40-49). Tübingen: Narr.
Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. https://rm.coe.int/1680459f97 [30.10.2020].
Gnutzmann, Claus (2005). Neokommunikativer Grammatikunterricht? In Eva Burwitz-Melzer & Gert Solmecke (Hrsg.) Fremdsprachenunterricht in Schule und Erwachsenenbildung: Festschrift für Jürgen Quetz (S. 173-182). Berlin: Cornelsen.
Gnutzmann, Claus & Bohnensteffen, Markus (2012). Grammar and translation – A comeback? Anglistik 23 (1), 49-60.
Klippel, Friederike & Caspari, Daniela (2013). Übungen statt Aufgaben! Fremdsprachen Lehren und Lernen 42 (2), 129-131.
Koch, Corinna (2015). Dienen, nicht dominieren: Ein Plädoyer für die Instrumentalisierung von Grammatik im Französischunterricht. Der fremdsprachliche Unterricht Französisch 135, 2-8.
Kolb, Elisabeth & Angelovska, Tanja (2017). Forscher-Lehrkräfte-Plattform: Grammatik im kompetenzorientierten Fremdsprachenunterricht: Was und wie? In Joachim Appel, Stefan Jeuk & Jürgen Mertens (Hrsg.) Sprachen Lehren. 26. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Fremdsprachenforschung in Ludwigsburg (S. 327-329). Hohengehren: Schneider.
Königs, Frank G. (2011). Verschollen im Bermuda-Dreieck? Anmerkungen und Beobachtungen zur Rolle der Grammatikvermittlung im Zeitalter von Kompetenzorientierung, Lernerautonomie und Neuen Medien. In Barbara Schmenk & Nicola Würffel (Hrsg.) Drei Schritte vor und manchmal auch sechs zurück: Internationale Perspektiven auf Entwicklungslinien im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Festschrift für Dietmar Rösler (S. 73-83). Tübingen: Narr.
Kultusministerkonferenz [= KMK] (2003). Bildungsstandards für die erste Fremdsprache (Englisch/Französisch) für den Mittleren Schulabschluss. www.kmk.org/themen/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards.html [30.11.2020].
Kultusministerkonferenz [= KMK] (2004). Bildungsstandards für die erste Fremdsprache (Englisch/Französisch) für den Hauptschulabschluss. www.kmk.org/themen/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards.html [30.11.2020].
Kultusministerkonferenz [= KMK] (2012). Bildungsstandards für die fortgeführte Fremd-sprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife. www.kmk.org/themen/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards.html [30.11.2020].
Leupold, Eynar (2008). A chaque cours suffit sa tâche? Bedeutung und Konzeption von Lernaufgaben. Der fremdsprachliche Unterricht Französisch 96, 2-8.
LISUM (2011). Handreichung moderne Fremdsprachen Grammatik im kompetenzorientierten Fremdsprachenunterricht: Unterrichtsvorschläge für Französisch, Russisch, Spanisch, Englisch. https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/faecher/sprachen/franzoesisch/pdf/Fremdsprachen_Handreichung.pdf [30.11.2020].
Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen [= NW] (2019). Kernlehrplan für die Sekundarstufe I Gymnasium in Nordrhein-Westfalen: Französisch. www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gymnasium-aufsteigend-ab-2019-20/index.html [30.11.2020].
Müller-Hartmann, Andreas & Schocker-von Ditfurth, Marita (2011). Teaching English: Task-supported language learning. Paderborn: Schöningh.
Niedersächsisches Kultusministerium [= NI] (2020). Materialien für kompetenzorientierten Unterricht im Sekundarbereich I: Englisch. www.nibis.de/materialband-englisch-sekundarbereich-i_9046 [30.11.2020].
Niemeier, Susanne (2017). Task-based grammar teaching of English: Where cognitive grammar and task-based language teaching meet. Tübingen: Narr.
Piepho, Hans-Eberhard (1974). Kommunikative Kompetenz als übergeordnetes Lernziel im Englischunterricht. Dornburg-Frickhofen: Frankonius.
Rösler, Dietmar (1983). Endstation: integrierter FU. In Joachim Appel, Dietmar Rösler & Johannes Schumann (Hrsg.) Progression im Fremdsprachenunterricht (S. 117-172). Heidelberg: Groos.
Rösler, Dietmar (2007). Kommunikative Grammatik – ein in Ehren gescheitertes Konzept? In Ruth Eßer & Hans-Jürgen Krumm (Hrsg.) Bausteine für Babylon: Sprache, Kultur, Unterricht. Festschrift zum 60. Geburtstag von Hans Barkowski (S. 45-53). München: iudicium.
Schmelter, Lars (2013). Die ‚dienende Funktion‘ der Grammatik im Französischunterricht. In Lutz Küster & Ulrich Krämer (Hrsg.) Mythos Grammatik? Kompetenzorientierte Spracharbeit im Französischunterricht (S. 74-84). Seelze-Velber: Klett Kallmeyer.