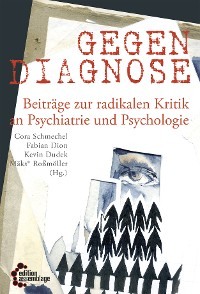Kitabı oku: «Gegendiagnose», sayfa 9
Die Konstruktion der »Anderen«
In der ständisch-traditionalen Gesellschaft erfolgte Inklusion über den sozialen Stand und nur sekundär – also standesintern – über die Geschlechtszugehörigkeit und das Alter. Doch während des Übergangs zur modernen, funktionalen Gesellschaft und durch die Aufklärung mit dem Gleichheitspostulat wurde die Legitimationsbasis der Gesellschaft gefährdet. Der Ausschluss von Frauen und Nicht-Europäer_innen vom Zugang zu bestimmten gesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten wurde durch das Gleichheitspostulat grundsätzlich in Frage gestellt und bedurfte einer neuen Legitimationsbasis (vgl. Müller 2003: 88). Die Abwendung von Gott hin zur Vernunft und »Natur«, womit die Etablierung der (Natur-)Wissenschaften einherging, ist hierbei folglich ausschlaggebend: die »Vorstellung von der Gleichheit aller Menschen machte es notwendig, soziale Ungleichheiten irgendwie neu zu legitimieren, da die alten Erklärungen der Bibel den neuen Anforderungen an ›Wissenschaftlichkeit‹ nicht mehr genügten« (ebd.: 90).
Der Kolonialismus und die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft boten die Voraussetzungen, um die soziale Ordnung anders als religiös zu definieren, sodass sich am Übergang zum 20. Jahrhundert eine weitere gesellschaftliche Strukturierungs- und Differenzierungskategorie etabliert hat. Zwar prägen rassistische Darstellungen der »Anderen« bereits seit Jahrtausenden stereotype Vorstellungen und Bilder, doch hat sich das (moderne) Konzept »Rasse« erst im Zuge der Herausbildung der Wissenschaften, insbesondere der westlichen »Rasseforschung«, also im Kontext der europäischen Moderne, formiert (vgl. Miles 1991: 19ff.). Die Strukturkategorie »Rasse« ist hierbei aber kein isolierter Mechanismus, sondern es treten Kategorien wie »Rasse«, Geschlecht, Klasse usw. gemeinsam innerhalb bestimmter Relationen zueinander in Erscheinung, überschneiden und bedingen sich. Dies zeigt sich beispielsweise, wenn wir die Hervorbringung der modernen Verständnisse von »Rasse« und Geschlecht betrachten. Beide Kategorien waren, genauso wie auch Klasse, fundamental für die Selbstdefinition des bürgerlichen Subjekts. McClintock arbeitet in ihrem Buch Imperial Leather. Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest (1995) heraus, dass Imperialismus und die Erfindung von »Rasse« fundamentale Aspekte in der westlichen industriellen Moderne waren und die Erfindung von »Rasse« sowie das Kontrollieren und Überwachen der »Gefährlichen Klassen«11 zentral für das Selbstverständnis der Mittelklasse wurden – sich die Mittelklasse über die Abgrenzung und Degradierung der »Anderen« normierte. Die Verschränkungen von »Rasse« und Geschlecht zeigen sich in der Betrachtung kolonialer Ungleichheitsstrukturen. Weiße koloniale Frauen waren in ihrer Gesellschaft benachteiligt, denn sie haben keine direkten ökonomischen oder militärischen Entscheidungen getroffen (vgl. McClintock 1995: 6). Jedoch gab ihnen das Privileg der »Rasse« die Position, über kolonisierte Männer und Frauen zu entscheiden, sodass die weiße Kolonialfrau privilegiert und begrenzt zugleich war. Dies zeigt exemplarisch, dass imperiale Macht innerhalb verschiedener Macht- und Herrschaftskonstellationen entstand, d.h. durch das Zusammentreffen verschiedener Formen von Macht und Wissen. Es zeigen sich jedoch auch zentrale Unterschiede der sich verschränkenden Kategorien. Marion Müller (2003) arbeitet dieses besondere Verhältnis von Geschlecht und »Rasse« differenziert im historischen wie interaktionistischen Kontext heraus. Anders als bei Geschlecht war für den Differenzierungsprozess entlang der Kategorie »Rasse« nicht die soziale Trennung von Menschen innerhalb eines Kollektivs, sondern die gemeinsame Abgrenzung nach außen entscheidend, um die ökonomische und politische Ressourcenkontrolle zu festigen (vgl. Müller 2003: 45). Die Kategorie »Rasse« wurde seit dem 17. Jahrhundert über zunehmende Reiseberichte zur Abgrenzung von Europa vom Rest der Welt verwendet, zugleich hergestellt, und letztendlich wurde diese Kategorie genutzt, um den Ausschluss bestimmter Menschen von den Freiheits- und Bürgerrechten zu legitimieren.
Die Differenzierungskategorien »Rasse« und Geschlecht wurden in diesem Prozess zu universell gültigen und naturalisierten Deutungsschemata. Nicht mehr der Stand war entscheidend, sondern nun wurden Geschlecht und »Rasse« zum Bestandteil einer natürlichen Ordnung (vgl. ebd.: 89). Damit stabilisierten sich seit Ende des 18. Jahrhunderts feste Zuschreibungen und Normen (z.B. Verhalten, Aussehen) entlang der Achsen von Geschlecht und »Rasse«, die den verschiedenen sozialen Positionen entsprechend hierarchisiert sind. Es können daher dieselben politischen Probleme zur Genese der Geschlechter- und »Rassen«-Differenzierung konstatiert werden. Zusammengefasst lässt sich daher festhalten, dass Frauen und Schwarze Menschen als das »Andere« markiert und der weiße, europäische Mann zur Norm wurden. Beiden, weißen Frauen und allen Schwarzen, wurde eine von der Norm abweichende Körperlichkeit konstatiert.12 Zudem wurden sie pathologisiert, indem ihnen beispielsweise eine größere Anfälligkeit für psychische Krankheiten wie Hysterie und Demenz unterstellt wurde (vgl. ebd.: 93).
Psychopathologisierung und das »Rasse«-Konstrukt
Psychopathologisierung am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert
Wie die Herausstellung von somatischen, charakterlichen und kulturellen diente auch die Zuschreibung von pathologischen Unterschieden der Konstruktion von Differenz. Hierbei waren wissenschaftliche Praktiken sowie Psychopathologien zu Beginn des 19. Jahrhunderts und zu Anfang des 20. Jahrhunderts konstitutiv für Wissen über »Rasse« und Geschlecht.13 Da Psychiatrie mit biologischen, physiologischen, verhaltens-analytischen und sozialen Dimensionen des Subjekts arbeitete, stellt es insbesondere ein wichtiges Feld zur Formung von rassistischen (und sexistischen, ableistischen etc.) Vorstellungen dar. Sie stellt das nötige Werkzeug für die Konstruktion des »Normalen« und des »Wahnsinnigen« zur Verfügung: »Above all, psychiatry offers a medical language for framing the normal and pathological subject according to social and biological criteria.« (Keller 2008: 9)14 Die Psychiatrie war folglich eine tragende Institution bei der Wissensproduktion über »Rasse«, »Ethnizität« und Differenz, was bisher jedoch nur bedingt erforscht wurde.15 Denn zwar untersuchte Frantz Fanon (2008 [1952]) bereits die Rolle von Gewalt im antikolonialen Kampf im 20. Jahrhundert und kritisierte die rassifizierte Psychiatrie und die eurozentrische Psychoanalyse vor allem französischer weißer Intellektueller. Auch analysierte Richard Keller (2008) bereits psychiatrische Institutionen, die in französischen Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent noch während der Kolonialzeit errichtet wurden. Er zeigt dabei auf, wie Psychiatrien die koloniale Dominanz stabilisierten und den »African mind« in Abgrenzung zum europäischen definierten, was in Frankreich beim Algerienkrieg sehr stark zum Tragen kommt. Dagegen gibt es aber keine Untersuchungen für Psychiatrien in deutschen Kolonien. Allerdings sei hierbei Andrea Adams´ Arbeit Psychopathologie und »Rasse« (2013) hervorgehoben, die sich mit den deutschen Diskursen (1890-1933) diesbezüglich beschäftigt. Sie stellt heraus, wie einerseits die Quantifizierung und Statistik und andererseits die Symptomorientierung und Diagnostik tragend innerhalb der zunehmenden naturwissenschaftlichen Orientierung der Psychiatrie wurde. Am Übergang des 19. zum 20. Jahrhunderts etablierte sich die wissenschaftliche Beschäftigung mit »Rasse« und Psychopathologien in Medizin und Psychiatrie, wobei der Zusammenhang von »rassischer« Differenz, Pathologie und Psyche eine tragende Rolle spielte und das Wissen über »Rasse« die Diagnostik formte (vgl. Adams 2013: 33). Denn das Wissen über körperliche, psychische und kulturelle Differenzen stellte sich durch den wissenschaftlichen Diskurs (in Publikationen von PsychiaterInnen und ÄrztInnen)16 her, die Vorstellungen von »Rassen« stabilisierte sich und beeinflusste dabei die Entstehung oder Formulierung psychischer Krankheiten.
Diskurse über »Rasse«, Geschlecht und (Homo-)Sexualität konstituierten sich im Zuge von Pathologisierungsdiskursen gegenseitig. Analog zum zeitgenössischen »Rasse«-Konzept wurde beispielsweise Geschlecht in »shades of gender« (Carpenter 1908, zit. n. Somerville 1994: 260) gedacht. Denn so wurden Frauen beschrieben, die zu einem Achtel Mann seien, was zeigt, dass hier das gleiche wissenschaftliche Modell zugrunde liegt. Zudem wurden im psychologischen Diskurs »Rassenmischung« und Homosexualität über das Modell der »abnormalen« Sexualobjektwahl verlinkt. Denn als »pervers« galt, wenn eine weiße und ein Schwarze Person Sex hatten, genauso wie gleichgeschlechtliche Sexualität – eine Gleichsetzung, die auf der Vorstellung beruht, dass sich Schwarz zu weiß wie weiblich zu männlich verhält (vgl. Somerville 1994: 260). Auch griff die Sexualwissenschaft auf das Modell des »Mischlings« aus der »Rassenforschung« zurück, um »Invertierte« zu verstehen, indem »interrassische« und gleichgeschlechtliche Sexualität als analog und unnatürlich verstanden wurden (vgl. ebd.: 265). Homosexualität als ein Konzept, bei dem Handlungen und Begehren konstitutiv für die Identität sind, entstand erst zu dieser Zeit synchron zur Reformulierung der »Rassenfrage«.17
Doch während sich hierbei das Modell von Homosexualität entwickelte (das sich über die Wahl des Sexualobjektes definiert, was bis heute in der westlichen Definition zum Tragen kommt), führte die Unschärfe des »Rasse«-Begriffs zu einer kontinuierlichen wissenschaftlichen Beschäftigung und wiederholten versuchten Fixierung des Wissens über »Rasse« (vgl. Adams 2013: 285). Dabei arbeitet Adams zwei Behauptungen heraus, die deutlich die Verknüpfung von psychiatrischer Diagnostik und Rassismus bzw. Antisemitismus aufzeigen. Denn so wurde Jüd_innen im untersuchten Zeitraum eine größere Disposition zu psychischen Erkrankungen als Nichtjüd_innen zugeschrieben. Dem entgegenstehend seien psychische Erkrankungen bei Schwarzen Menschen weitgehend abwesend (vgl. ebd.). Dabei wurden Bilder von dem_r »nervösen« oder »geisteskranken« Jüd_in und dem »gesunden Wilden« als gesichertes Wissen in Fachzeitschriften und Zeitungen dargestellt und stets wiederholt. Dieser Diskurs ist eng mit der Vorstellung verbunden, dass die moderne Lebensweise gesundheitliche Auswirkungen hat, da die Zivilisation durch Urbanisierung und Industrialisierung eine Entfremdung von einer »ursprünglichen« Lebensweise auslöse und so zu einem Anstieg psychischer Erkrankungen führe. Da dies für Kolonisierte nicht zuträfe, wurde daraus gefolgert, dass es kaum psychische Erkrankungen unter ihnen gäbe (vgl. ebd.). Adams hebt hierbei aber hervor, dass keine »rassenspezifischen« Erkrankungen festgestellt werden konnten, denn frühe Thesen zu bestimmten »Rassenkrankheiten« und »Rassenimmunitäten« wurden schnell wieder verworfen. Allerdings wurde häufig von einer geringeren oder größeren Anfälligkeit bestimmter Krankheiten für bestimmte Gruppen ausgegangen. So hielten viele ForscherInnen psychische Krankheitsbilder bei Schwarzen für weniger verbreitet, z.B. galten Wahnvorstellungen als selten und geringer ausgeprägt (vgl. ebd.: 234).18 Oder wurden beispielsweise Jüd_innen häufiger Nervenerkrankungen, Hysterie und Neurasthenie (Nervenschwäche) zugeschrieben (vgl. ebd.: 286f.).
Nicht nur wurde bestimmten Gruppen von Menschen eine höhere oder geringere Neigung für bestimmte Krankheiten diagnostiziert. Adams weist auch nach, dass Symptombeschreibungen von rassistischen Vorurteilen durchdrungen waren, denn oftmals wurden Verhaltensweisen und psychologische Erkrankungen als »rassentypisch« beschrieben (vgl. ebd.: 287). Schwarze Menschen wurden meist »als leicht erregbar, impulsiv, gewalttätig, mit geringerer Moral und in ihren Symptomen als weniger komplex« beschrieben, während »die Orientalen« als »faul und schicksalsergeben« beschrieben wurden (ebd.: 241). Hier verstanden die WissenschaftlerInnen die Symptome und ihre Beschreibungen als Kollektivsymptome einer ganzen »Rasse«. D.h. im Diskurs um »Rasse« und Psychopathologie wurde die »rassische« Differenz folglich am deutlichsten durch die Symptome hergestellt; es wurde von »rassetypischen« Symptomen ausgegangen. Beispielsweise wurde die angebliche intellektuelle Minderwertigkeit der »unzivilisierten Rassen« für das Aufzeigen von Krankheitsbildern herangezogen, die in den Augen der ForscherInnen als »weniger weit entwickelt, abgeflacht und simpler« galten (ebd.: 241). Dagegen wurde »die weiße Rasse« teils als stärker depressiv und »der nordische Mensch« häufig als »kühl, distanziert und autistisch« beschrieben (ebd.: 287).19 Hierbei fanden sich folglich in den Darstellungen die Vorstellungen der Europäer_innen wieder, die sie von den außereuropäischen »Anderen« hatten (vgl. ebd.: 241). Die Psychopathologie griff folglich einerseits auf vorhandene stereotype Bilder zurück und reproduzierte und verstärkte sie andererseits zugleich. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass die Definition von Symptomausprägungen bereits auf eurozentrische Normen und Vorstellungen ausgerichtet war. Adams weist in ihrer Arbeit jedoch auch darauf hin, dass es ebenso kritische Stimmen unter den WissenschaftlerInnen gab, wie etwa von AutorInnen aus jüdischen Familien, die zwar nicht die Statistiken bezweifelten, jedoch die vermeintlich höheren Zahlen von pathologisierten Jüd_innen weniger auf unveränderliche »Rassen«-Merkmale als vielmehr auf die vermeintlich höhere psychische Belastung von Jüd_innen zurückführten: »Juden besäßen zwar eine höhere Neigung zu psychischen Erkrankungen, so das Argument, diese Disposition habe sich jedoch lediglich durch vergangene gesundheitsschädliche Lebensumstände herausgebildet und sei kein fixes Rassenmerkmal.« (ebd.: 288)
Dass der Zeitpunkt von bestimmten Pathologisierungen keinesfalls Zufall ist, sondern als Legitimationsbasis für Herrschaft genutzt wurde, lässt sich mit der zeitlichen Einordnung des Aufkommens von Pathologisierungen aufzeigen. Rassistische und sexistische Bilder entstanden besonders in historischen Perioden, in welchen marginalisierte Gruppen Widerstand gegen ihre Marginalisierung leisteten und politische Forderungen stellten, was Sander Gilman (1984) exemplarisch am Bild des »verrückten Juden« aufzeigt. Gilman argumentiert, dass die wissenschaftliche Behauptung, dass Jüd_innen eine Prädisposition zum Wahnsinn hätten, die Gesellschaft bereits im 18. Jahrhundert ermächtigte, Jüd_innen wie vermeintlich psychische Kranke zu behandeln und zu internieren. Analog dazu wurde Schwarzen Sklav_innen eine Weglauf-Manie (Drapetomanie) diagnostiziert. So wurde Jüd_innen, Schwarzen und (weißen) Frauen, insbesondere wenn sie politische Emanzipation forderten, Wahnsinn unterstellt (vgl. Gilman 1984: 157, Showalter 1987).20 Hier zeigt sich erneut, dass die Zuschreibung von psychopathologischer Differenz als Abwehrstrategie von Widerstand genutzt und darüber Diskriminierung und gesellschaftliche Exklusion gerechtfertigt wurde. Die Vormachtstellung des weißen, christlichen Mannes legitimierte sich, indem Marginalisierten ihre Fähigkeit zur Vernunft abgesprochen wurde.
Psychopathologisierung im Nationalsozialismus
Während des Nationalsozialismus (NS) führte die Bedeutung von »Rasse« im Bereich der Erbforschung nach 1933 zur Institutionalisierung von »Rassenkunde« und »Rassenhygiene« an deutschen Universitäten. Das Besondere an dem Konzept »Rasse« im NS – was sich deutlich von der Forschung zur Jahrhundertwende abhob – war vor allem die »rassische« Optimierung der deutschen Bevölkerung. Weniger ging es nun um einen »Rassenvergleich«, wie es zuvor der Schwerpunkt war (vgl. Adams 2013: 271), sondern stand hierbei insbesondere die Erforschung von Schizophrenie und manisch-depressivem »Irrsein« im Fokus der »Rassen«-Psychiatrie. Besonders deutlich wird bei Betrachtung zeitgenössischer Schriften, wie Adams aufzeigt, die Verknüpfung der Rechtfertigung von Ungleichheit mit psychiatrischen Befunden. Beispielsweise wurden Jüd_innen in psychiatrischen Schriften nicht nur als »anders« und »fremd« beschrieben, sondern wurde zugleich auch ihr Ausschluss oder ihre Separation befürwortet (vgl. ebd.: 277). Oder es wird aus der Behauptung einer höheren Prävalenz von Jüd_innen zur Hysterie, die im medizinischen Diskurs bereits vor dem NS kursierte, der »Fakt«, dass Jüd_innen bis zu dreimal häufiger unter Geisteskrankheit litten, da sie einen weniger männlichen Charakter hätten (vgl. ebd.: 278). Hierin zeigt sich zudem erneut die Überschneidung von Rassismus bzw. Antisemitismus und Sexismus.
Bereits seit dem 19. Jahrhundert kommt es zur Infantilisierung von Wahnsinn, sodass »Verrückte« als unreife Vorstufe der »Vernünftigen« dargestellt werden. Hierbei geht es um die Vorstellung einer Umkehr der Evolution, d.h. eine Regression auf entwicklungsgeschichtliche Vorstufen. Vor allem beruht auf dieser Vorstellung eine Einstufung entlang nach Verwertbarkeit. Im Nationalsozialismus wurde auf dieser Basis »dysfunktionalen« Gruppen ein Platz in der imaginierten Hierarchie der Entwicklungsstufen und Denkleistungen zugewiesen, entlang derer Musterungen für und in Konzentrationslagern erfolgten (vgl. Heinz 1997: 33). Diese Degenerationstheorie wurde an eine Organpathologie gekoppelt, wonach »soziale Verelendung« und »moralische Verirrungen« über Generationen weitergegeben werden könnten und zu Neurosen, Alkoholismus und Suizidneigungen führen würden und in schweren Geisteskrankheiten und Schwachsinn münden könnten.21 Bei Betrachtung dieser Theorie liegt die Verknüpfung zu Rassismus nahe. Denn schnell lässt sich eine Parallele zwischen den konstruierten einfältigen stereotypen Bildern (die meist kaum trennbar von Genen gedacht wurden) und der Vorstellung einer degenerativen Anlage ziehen. Zwar wurde im Verlauf der psychiatrischen Theoriebildung zum Anfang des 20. Jahrhunderts von der Idee, dass verschiedene Krankheitsbilder durch eine einzige degenerative Anlage verursacht werden, zunehmend abgelassen, der Grundgedanke der Degenerationstheorie blieb jedoch bestehen: »nämlich die Annahme eines vererblichen Einflusses der Moderne auf die seelische Gesundheit« (ebd.: 38).
Als eine weitere wichtige Theorie ist in diesem Zusammenhang zudem Freuds Verdrängungsmodell zu nennen. Dieses geht von natürlichen Trieben aus, die bei Unterdrückung zu Kanalisationen in der Psyche führen. So führe beispielsweise die »Enttäuschung beim Weibe« zum Verdrängen der Libido, was zu Spannungen in der Psyche führe, bis die Libido wieder auf andere Objekte übertragen werden könne (vgl. ebd.: 40). Hierbei gibt es unterschiedliche Stadien, die Patient_innen durchleben und in welche sie wieder zurückfallen können, sodass diese Theorie auch als Regressionstheorie verstanden wird. Markant ist, dass Schwarze Menschen als »primitiv« gelabelt wurden, da sie den Reifezustand der Europäer_innen nicht erreicht hätten. Ihnen wurde folglich ein weniger fortgeschrittener Zustand in der eurozentrischen, linearen Vorstellung der Evolution zugewiesen. Der Regressionszustand von Patient_innen wurde daher mit zeitgenössischen »Stammesvölkern« gleichgesetzt, da diese als »Urvölker« postuliert wurden. Dieser Theorie folgend befinden sich Geisteskranke, Kinder, »Primitive«, Homosexuelle und Frauen in einem solchen Regressionszustand (vgl. ebd.: 41).22 Vor allem aber fand eine explizite Assoziation von Regression und dem Infantilen mit Zuschreibungen von Schwarzen statt. Dieses Regressionskonzept untersucht Andreas Heinz (1997) in der Schizophrenieforschung zwischen 1890 und 1980 und zeichnet hierbei nach, wie rassistische Vorstellungen in der Psychiatrie sichtbar sind und darüber eine hierarchisch gedachte Differenz hergestellt wird. Auf Grundlage der Infantilisierung und der Vorstellung von Schwarzen als »regressiv« wurde beispielsweise der Völkermord der Herero durch deutsche Truppen bereits 1904 als »Rassenkampf« gerechtfertigt, wobei von den 65.000 Herero nur 16.000 überlebten (vgl. ebd.: 44). Zur Zeit des Nationalsozialismus begründete der Vergleich von Schizophrenen mit Schwarzen schließlich die beginnende Vernichtung und Zwangssterilisation von beiden Gruppen (vgl. ebd.: 45). Im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Verwertungslogik führten solche Theorien auch zur Einordnung von »Wertungsgruppen« unter den deutschen Sinti und Roma, die unter »Eignungsprüfungen« durch die SS bestimmt wurden und entlang dieser über die Selektion (z.B. Zwangssterilisation, Zwangsarbeit, Vernichtung) entschieden wurde (vgl. Gilsenbach 1997). Die Theorien der Degeneration und der Regression waren für die Schizophreniepathologisierung sehr tragend, denn beide Theorien (egal ob aufgrund von hirnorganischen Beeinträchtigungen oder Manifestationen kranker Erbanlagen) repräsentierten den »infantilen, primitiven und weiblichen Gegenpart zur ›Rationalität‹ des westlichen Mannes« (Heinz 1997: 48). Das »Rasse«-Konzept war im NS daher besonders mit biologischer und psychischer Differenz und der damit einhergehenden Wertigkeit verbunden (vgl. Wandert/Ochsmann 2009: 306), da es eine klare hierarchische Anordnung von »Rasse« gab, die mit der Angst vor einer »Degeneration« der »höherwertigen« weißen »Rasse« zusammenfiel. Dem liegen ein lineares Zeitverständnis und die Vorstellung der Aufklärung in Verbindung mit der Evolutionstheorie zugrunde, wonach sich die menschliche »Rasse« progressiv weiterentwickle. So kritisiert auch McClintock, dass die unzähligen Kulturen der Welt durch eine retrospektive Beziehung zur linearen, europäischen Zeit markiert sind. Denn daraus ergibt sich der Rückschluss der entgegengesetzten Bewegung von weißer Erwachsenenschaft hin zum »Primitiven«, der »schwarzen Degenerierung«, ein Bild, das sich in Zuschreibungen zum Weiblichen ebenso ergibt (vgl. McClintock 1995: 9ff.). Kritik an Rassismus muss daher auch mit einer Kritik am aufklärerischen Fortschrittsgedanken (also der Idee von einer Bewegung hin zur erleuchteten Vernunft) gedacht werden. Die Kritik an der westlichen Vorstellung von Vernunft und damit einhergehend an den Praktiken der (Psycho-)Pathologisierung ergibt sich daher auch aus einer Rassismusanalyse.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.