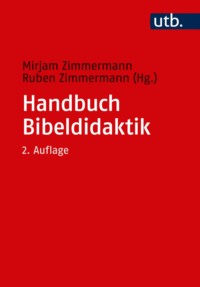Kitabı oku: «Handbuch Bibeldidaktik», sayfa 20
Leseempfehlungen
Böhnke, Michael et al., Leid erfahren – Sinn suchen. Das Problem der Theodizee. Freiburg i.Br. 2007.
Ebach, Jürgen, Hiob. In: Dressler, Bernhard/Schroeter-Wittke, Harald (Hg.), Religionspädagogischer Kommentar zur Bibel. Leipzig 2012, 158–166.
Fricke, Michael, Art. Ijob/Hiob, bibeldidaktisch, Grundschule. In: WiReLex (2016).
[http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100144/]; Zugriff am 12.12.2017.
|149|Kushner, Harold, Wenn guten Menschen Böses widerfährt. Gütersloh 41994.
Lux, Rüdiger, Hiob. Im Räderwerk des Bösen. BG 25. Leipzig 2012.
Oberthür, Rainer, Kinder fragen nach Leid und Gott. Lernen mit der Bibel im Religionsunterricht. München 1998.
Ritter, Werner H. et al., Leid und Gott. Aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen. Göttingen 2006.
Stögbauer, Eva, Art. Ijob/Hiob, bibeldidaktisch, Sekundarstufe. In: WiReLex (2016).
[http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100145/]; Zugriff am 12.12.2017.
Themenheft „Dem Leid begegnen: Theodizee“. entwurf (4/2012).
Themenheft „Theodizee“. :in Religion (1/2016).
Themenheft „Theodizee“. Rellis (3/2015).
Zimmermann, Mirjam, „Hiob reloaded“ – nach Gerechtigkeit fragen. Schülerinnen und Schüler schreiben moderne Hiob-Erzählungen. Religion 5–10 (4/2011), 28–33.
Fußnoten
1
So Wagner, David, Hiob lesen – leben lernen. Erwägungen zur gegenwärtigen Rolle der Hebräischen Bibel in Schule und Gesellschaft am Beispiel des Buches Hiob. In: Berlejung, Angelika/Heckl, Raik (Hg.), Ex oriente Lux. Studien zur Theologie des Alten Testaments. Leipzig 2012, 605–621, 610, unter Bezugnahme auf mögliche Wurzeln des Namens.
2
Vgl. Lux, 2012, 57f.
3
A.a.O., 58f.
4
Vgl. dazu die von Lux, 2012, 60–65, vorgestellten Modelle.
5
Vgl. a.a.O., 58.
6
Vgl. a.a.O., 29–52.
7
Vgl. a.a.O., 51f.
8
Wagner, 2012, 612.
9
Vgl. Dalferth, Ingolf U., Leiden und Böses. Vom schwierigen Umgang mit Widersinnigem. Leipzig 2006, 172f.
10
Vgl. Rommel, Herbert, Mensch – Leid – Gott. Eine Einführung in die Theodizee-Frage und ihre Didaktik. Paderborn 2011, 13f.
11
A.a.O., 14.
12
Nipkow, Karl Ernst, Erwachsenwerden ohne Gott? Gotteserfahrung im Lebenslauf. Gütersloh 52000.
13
Vgl. Rommel, 2011, 31.
14
Vgl. Ziebertz, Hans-Georg/Riegel, Ulrich, Letzte Sicherheiten. Eine empirische Untersuchung zu Weltbildern Jugendlicher. Gütersloh/Freiburg i.Br. 2008, 207f.
15
Ritter, 2006, 148–156.
16
Stögbauer, Eva Maria, Die Frage nach Gott und dem Leid bei Jugendlichen wahrnehmen. Eine qualitativ-empirische Spurensuche. Bad Heilbrunn 2011, gelangt zu sieben Typen „im Umgang mit der Frage nach Gott und dem Leid“ (Gottesbekenner, -sympathisanten, -neutrale, -zweifler, -relativierer, -verneiner und -polemiker), wobei die Theodizeefrage insbesondere die Jugendlichen berührt, „die sich Gott als freundlichen und hilfsbereiten Aufpasser vorstellen“ (a.a.O., 15). Die Affinität zum Theismus liegt nahe.
17
Vgl. Rommel, 2011, 36f.
18
Im Unterschied dazu hält es Schmitz, Simone, Die Leidproblematik als religionspädagogische Herausforderung. Relevanz und Vermittelbarkeit von Grenzsituationen des Lebens für den Religionsunterricht. Münster 2001, 65, für wenig sinnvoll, „schon in den Unterstufenklassen die Leidproblematik zu thematisieren“. Erst im 9./10. Schuljahr sieht sie die erforderlichen Denkvoraussetzungen und die nötige existenzielle Betroffenheit als gegeben an.
19
Vgl. Pusch, Magdalene, Gott, steh mir bei! Leiden, Trauer, Trost. Göttingen 2007, 8.
20
Vgl. aber auch das Beispiel Hanischs zum Leben des Johann Amos Comenius in Hanisch, Helmut, Die Frage nach der Theodizee bei Kindern und Jugendlichen. In: Ders./Gramzow, Christoph (Hg.), Religionsunterricht im Freistaat Sachsen. Lernen, Lehren und Forschen seit 20 Jahren. Leipzig 2012, 363–383.
21
Wagner, 2012, 618.
22
Vgl. Lux, 2012, 226–231.
23
Rommel, 2011, 220.
24
Vgl. Roth, Joseph, Hiob. Roman eines einfachen Mannes. München 82006; Sachs, Nelly, Hiob. In: Dies., Fahrt ins Staublose. Frankfurt a.M. 1961, 95; Schmitt, Eric Emmanuel, Oskar und die Dame in Rosa. Zürich 92003; Willemsen, Roger/Brandt, Sofia/Brandt, Matthias lesen: Willemsen, Roger, Das müde Glück, Eine Geschichte von Hiob. Audio-CD (ROOFMUSIC). Bochum 2012.
25
Vgl. Rommel, 2011, 16.
Psalmen
Ingo Baldermann
Im Unterricht waren die Psalmen lange zu einem Schattendasein verurteilt, obwohl sie bis heute als große Dichtungen der Weltliteratur Dichter und Komponisten inspiriert haben. Sie waren seit jeher das Gebetbuch der Kirche. Doch erst in jüngerer Zeit hat das unvergleichliche didaktische Potenzial, das in ihnen liegt, wieder Beachtung gefunden (vgl. Literaturangaben).
Die grundlegende Entdeckung ist: Mit Worten der Psalmen können schon Kinder direkt kommunizieren. Das gelingt nicht mit dem Text eines ganzen Psalms, mag er noch so einfach erscheinen, wohl aber mit einzelnen ausgewählten Sätzen. Der Grund ist offenbar: Ein Ganztext distanziert, ein einfacher Satz aber spricht unmittelbar an und lässt diesen Abstand gar nicht erst entstehen.
Schon für M. Luther liegt die didaktische Bedeutung der Psalmen in ihrer tiefen Emotionalität.[1] Denn „das menschliche Herz ist wie ein Schiff auf einem wilden Meer, das die Sturmwinde von allen Seiten umtreiben (…) Solche Sturmwinde aber lehren mit Ernst reden und das Herz öffnen und den Grund herausschütten“.[2] Das spiegelt sich in Luthers Übersetzung der Psalmen, und darin ist seine Übersetzung unüberholbar, auch didaktisch. Sie ist so elementar, dass sie auch heutigen Kindern immer wieder ganz nahe kommt.
|150|Nur: Was Luther hier als das „Herz“ bezeichnet, das emotionale Zentrum in mir, heißt in den Psalmen anders; es ist die Seele.[3] Sie ist in fast allen Psalmen ausdrücklich gegenwärtig, als Gesprächspartnerin, angeredet oder selbst redend; sie öffnet sich und bringt zur Sprache, was in ihren Tiefen ist.
Für den Unterricht sind wir genötigt, zuerst nach dem Elementaren zu fragen; und gleich wie wir das Wort „elementar“ verstehen: derart unmittelbar emotionales Reden wie in den Psalmen ist jedenfalls elementar. Das aber gibt uns eine andere Blickrichtung vor als der Exegese. Grundlegende exegetische Einsichten seien hier vorab genannt:
Bezeichnung und Aufbau
Das Psalmenbuch ist eine Zusammenstellung von 150 poetischen Texten unterschiedlicher Gattungen und Ursprünge. Es finden sich aber auch an anderen, meist profilierten Stellen der Bibel weitere Psalmen (z.B. Ex 15,1–18Ex 15,10096>18: Siegeslied am Schilfmeer; Dtn 32Dtn 32: Moselied; Ri 5Ri 5: Lied der Deborah; 1 Sam 2,1–11Sam 2,10096>11: Magnificat der Hanna; Lk 1,46–55Lk 1,460096>55: Magnifikat der Maria; Lk 1,68–79Lk 1,680096>79: Benedictus des Zacharias). Für die uns im Psalmenbuch vorliegende Zusammenstellung sind bewusst 150 Psalmen ausgewählt worden.[4] Die unterschiedliche Zählweise lässt sich damit begründen, dass die LXX die Ps 9 und 10 sowie 114 und 115 jeweils als einen einzigen Psalm betrachten, die Ps 116 und 147 aber in zwei Psalmen zerlegen. Heute ist die Zählung nach der Hebr. Bibel üblich.
Der Begriff „Psalm“ bezieht sich auf die am häufigsten genannte Überschrift (hebr. mizmōr = griech. psalmos, vgl. Ps 3,1Ps 3,1; 4,1Ps 4,1 u.v.a.), was auf einen kantilierenden Sprechgesang hinweist.
Zur Zusammenstellung wird in der neueren Exegese auf Kompositionsbögen, makrostrukturelle Zusammenhänge, u.a. verwiesen, die die gattungsgeschichtliche Psalmenexegese, die primär Einzeltexte im Blick hatte, erweitern. Die 150 Psalmen sind in fünf Bücher[5] gegliedert, dabei haben einzelne Psalmen eine besondere Funktion wie beispielsweise die Königspsalmen als „hermeneutisches |151|Netz“ oder Ps 1 und 2 sowie 146–150 als doxologische Rahmenpsalmen. Sie verkünden als Lobpreis der universalen Schöpfung die endgültige Gottesherrschaft.
Die Entstehung und Verwendung des Psalters muss im Zusammenhang mit gottesdienstlichem Einsatz als Gebets- und Meditationsbuch erklärt werden, der gottesdienstliche „Sitz im Leben“ ist den Texten selbst teilweise mitüberliefert.
Dabei ist das vorliegende Psalmenbuch in seiner Endgestalt durch Aneinanderreihungen von Teilsammlungen entstanden, die chronologische Abfolge entspricht in etwa auch der Abfolge des Alters. Die Datierungshypothesen divergieren stark (5.–2. Jh. v. Chr.), heute datiert man die Endgestalt etwa zwischen 200–150 v. Chr.[6]
Hauptgattungen
In der Exegese steht der Begriff der Formgeschichte für den Durchbruch zu einer anderen Betrachtungsweise. Die formgeschichtlichen Forschungen im Gefolge H. Gunkels[7] versuchen, die einzelnen Psalmen in ihren unterschiedlichen Formen liturgischen Vollzügen zuzuordnen.
Dabei wird unterschieden zwischen folgenden Gattungen[8] in ihrem hier kurz skizzierten idealtypischen Aufbau:
Klagelieder des Volkes und des Einzelnen (Klage mit Bitte um Rettung; Bekenntnis des Vertrauens bzw. Lob[versprechen]),
Bittpsalmen (einleitende Bitte; Betonung der Unschuld; Schilderung der Not mit Bitte um Hilfe; abschließende Bitte mit Bezug zu Feinden/Freunden)
Hymnen/Lobpsalmen (Aufforderung zum Lob; Begründung und Durchführung des Lobes)
Dankpsalmen (Ankündigung des Dankes; Rettungserzählung; Einladung, sich dem Dank anzuschließen)
Man kann aber auch mit den Methoden der Formgeschichte wie in der Evangelienforschung hinter die vorliegende Form der Texte zurückfragen nach den elementaren Formen der mündlichen Überlieferung, und in dieser Zuspitzung ist die formgeschichtliche Frage ein Schlüssel auch für die didaktische Arbeit an den Psalmen.
Denn die literarische Kunstform der uns heute vorliegenden Psalmen ist das Endstadium; unsere Frage nach dem Elementaren verweist uns auf die Anfänge, |152|auf die Bausteine, aus denen die komplexe Endgestalt zusammengefügt ist, und da stoßen wir auf die einfachen Formen mündlicher Rede: emotional geladene, streng geformte Sätze, Klagen, Bitten oder Worte des Vertrauens – offenkundig Keimzellen, aus denen die Psalmen gewachsen sind – und eben dies sind die Sätze, zu denen Jugendliche und Kinder zuallererst Zugang finden.[9]
Didaktisch erster Zugang: die Klage
Als Impulse für das Gespräch haben wir diese Sätze ohne jeden Kommentar präsentiert – der Hinweis auf Alter und Herkunft hätte unweigerlich schon wieder Distanz geschaffen –, auf große Karten geschrieben und so in unterschiedlichen Anordnungen verwendet.[10] Diese Psalmensätze aber sind nicht beliebig einsetzbar; sie ordnen sich zu einer didaktisch bindenden Reihenfolge, die auch theologisch interessant ist:
Die Sätze, die allen Kindern und Jugendlichen unmittelbar zugänglich sind, ohne weitere Voraussetzungen, sind Worte der Klage. Offenbar sind sie die elementarsten Worte der Psalmen; jedenfalls sind es Worte, in denen schon Kinder sich unmittelbar wiederfinden:
Ich rufe, und du antwortest nicht (22,3Ps 22,3).
Ich bin wie ein zerbrochenes Gefäß (31,13Ps 31,13).
Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist (69,3Ps 69,3).
Warum hast du mich verlassen? (22,2Ps 22,2).
Folgen wir unserer didaktischen Analyse, so ist dies die erste Überraschung: Die erste Stufe des Psalmengebets ist nicht das Lob, sondern die Klage. Und die zweite überraschende Entdeckung ist: Dies ist keine religiöse Sprache, sondern eine ganz elementar menschliche Sprache, Kinder und Jugendliche ohne jede religiöse Sozialisation verstehen sie unmittelbar.
Und die dritte Überraschung: Die Gotteserfahrung müssen wir nicht mühsam an die Kinder herantragen, sie ist in dieser so ganz und gar menschlichen Sprache unmittelbar präsent, implizit, doch unüberhörbar. Sie braucht keine theologische Sprache, denn diese ganz einfach menschliche Sprache ist randvoll von Gotteserfahrung; ohne sie wären diese Sätze der Klage nie formuliert worden. Sie sind ja nicht einfach „Klage“, larmoyant und hilflos, es sind Hilferufe, die in der Verzweiflung nicht aufhören, auf Hilfe zu hoffen.
Und eben das ist die Stärke der biblischen Rede von Gott: dass sie nicht abhebt in eine „religiöse Dimension“,[11] nur denen zugänglich, die einen Sinn |153|fürs Übersinnliche mitbringen. Die biblische Sprache ist unter Menschen mit Migrations-, ja Deportationshintergrund geboren, nicht aus der religiösen Frage nach dem Übersinnlichen, sondern aus den elementarsten Bedürfnissen der Menschen, die in dem Würgegriff dieser Leiden und Ängste ihr Menschsein noch zu bewahren suchen. Und mitten in diesen Fragen trifft sie eine neue Sprache, die ihnen eine Ahnung von Freiheit bringt, die all die brennenden Fragen ihrer Sehnsucht aufnimmt, doch nicht mit dem Ziel, sie religiös zu lösen, sondern sie real herauszuführen aus diesem Elend.
Ohne diese Grunderfahrung, dass alles Schreien und Weinen nicht ins Leere geht, wäre kein Satz der Psalmen je ausgesprochen worden. Nur ist diese Erfahrung nicht wie eine denknotwendige Voraussetzung rational präsent, sondern emotional als Ahnung und Hoffnung. Hier sind nicht Dichter am Werk, die persönliche oder kollektive Erfahrungen in eine kunstvolle Form bringen, sondern emotionale Erfahrungen von unerhörter Intensität, auf der Suche nach einer Sprache, die ihnen angemessen ist und doch kommunikabel bleibt. Diese Sprache aber kann sich nicht als Monolog entfalten, das ist nur als ästhetische Attitüde so möglich; im Ernstfall braucht sie ein Gegenüber – die Ursprungssituation des Gebets.
Die Klage sucht Antwort
Die Klage wartet auf Antwort, und so fragen wir weiter nach Worten, die denen der Angst entgegenkommen. Es müssen Worte sein, die nicht weniger elementar sind; nur so können sie der Angst antworten. Sie dürfen nicht vorspiegeln, eine „Lösung“ zu haben, die es existenziell ja gar nicht gibt; sie müssen aber in der Lage sein, eine Gegenerfahrung zu mobilisieren:
Du bist mein Fels (31,4Ps 31,4).
Deine Hand hält mich fest (63,9Ps 63,9).
Du bist mein Lied (118,14Ps 118,14).
Du bist bei mir (23,4Ps 23,4).
Folgen wir den Psalmen, so erteilen sie uns eine didaktisch nachdrückliche Warnung: Sie bringen ihre Gegenerfahrung nicht wie eine Lösung ins Spiel, so als sei mit dem Hinweis auf „Gott“ alles gelöst. Die Bibel lebt aus einer Gotteserfahrung, die nicht mit einem einzigen Namen einzufangen ist, schon gar nicht |154|mit dem farblosen Wort „Gott“; aber mit der Frage nach dem Namen sind wir didaktisch auf der Spur zu dem theologischen Kern der Bibel.
Denn die geläufige Übersetzung „der Herr“ ist nicht wirklich ein Name, vielmehr nur eine Umschreibung des unaussprechlichen Namens, der sich hinter den Buchstaben JHWH verbirgt: Er offenbart sich dem Mose aus dem brennenden Dornstrauch mit einem hebräischen Wort, das die Zusage gibt: Ich bin da, ich will mit euch sein, das ist mein Name – der sich sogleich aber dem allzu direkten Zugriff wieder entzieht: Ich bin, der ich bin (Ex 3,14Ex 3,14).
Das Geheimnis dieses Namens ist: Er ist die Antwort, nach der die Klagen suchen, Inbegriff allen Trostes; in der reziproken Form als Anrede erscheint er im 23. Psalm: „Du bist bei mir“; und dies ist auch für Kinder das Vertrauenswort, das alle anderen in sich schließt. Es schließt auch ganz menschliche Erfahrungen ein, den Trost, der von der Gegenwart der Mutter ausgeht, vom Beistand der Freundin, von der Erfahrung, nicht allein zu sein in der Angst.
Dies ist eine Erfahrung, die immer neue Namen sucht, weil keiner sie ganz zu fassen vermag. Es sind Namen des Suchens, nicht des Besitzens, Namen der Sehnsucht, ja auch Namen der Zärtlichkeit, wie sie Liebende einander oder Eltern ihren Kindern geben. Deshalb bleibt das Grundgesetz des Verstehens: Wir müssen sie offen halten für künftige Erfahrung, um keinen Preis dürfen wir sie ablösen durch das Wort Gott, als sei dies die endgültig richtige Lösung.
Gespräche mit der Seele
Viel hängt aber davon ab, dass wir den „Sitz im Leben“ dieser Worte nicht verschieben. Die Worte des Vertrauens haben keinen anderen als die der Klage; sie sind nicht auf den Höhen des Wohlfühlens formuliert, sondern in den Tiefen der Angst; erst dort werden sie beredt.
Sind wir so in die Tiefen der Seele hineingestiegen, dann liegt es aber auch nahe, den Kindern bewusst zu machen, wer da eigentlich in ihnen und mit ihnen redet. „Meine Seele will sich nicht trösten lassen“ (Ps 77,3Ps 77,3) – das ist eine widerständige Erfahrung, die alle Kinder kennen. Sie finden dann aber auch die Spur zu anderen Erfahrungen mit der eigenen Seele. Sie will oft anders als ich es will; sie kann tieftraurig sein, aber auch grenzenlos übermütig. Dies aber führt uns zuletzt auf eine noch andere Spur in den Psalmen: Die Seele ist es, die den Impuls erfährt, IHN, der so viele Namen trägt, zu „loben“ (Ps 103Ps 103; 104Ps 104).
Das Lob – Sprache des Glücks
Die herkömmliche Bezeichnung „Lob“ allerdings ist missverständlich; erst wenn wir alle pädagogischen Konnotationen beiseite lassen, entdecken wir in den Lobpsalmen eine ähnlich ursprüngliche Sprache wie in der Klage; es ist die Sprache des Staunens, der Bewunderung: Da ist das Meer – so groß und weit (Ps 104,25Ps 104,25)! Wie bist Du schön (Ps 104,1Ps 104,1)! – es sind Worte des Glücks wie die, mit denen Liebende einander erkennen.
|155|Die Sprache des Glücks aber ist Kindern nicht fremd; bringen wir sie auf die Spur, elementare Erfahrungen von Glück und Schönheit bewusst wahrzunehmen, dann werden wir staunen, zu welcher Intensität und Klarheit lyrischer Sprache schon Kinder fähig sind. Die Sprache des Glücks aber ist für sie lebensnotwendig wie die der Klage, nur in ganz anderer Weise: Die Erfahrung des Glücks, immer nur die Sache eines Augenblicks, bleibt darauf angewiesen, dass wir sie immer neu erinnern, um nicht unterzugehen in dem Chaos des Beängstigenden.
Anders aber als die Sprache der Klage führt die des Glücks in eine unendliche Weite: Die Klage kommt mit wenigen wiederkehrenden Bildern aus; wir kennen sie aus der Sprache unserer Träume; der Umgang mit ihnen ist wie eine Engführung. Die Sprache des Glücks dagegen ist so vielfältig wie die Schönheit der Schöpfung; sie führt in die Weite und entbindet eine geradezu grenzenlose Kreativität.
Diese Explosion der Kreativität spiegelt sich auch in den Verben: Das Grundwort des Lobens in den großen Lobpsalmen 103/104 heißt: segnen; in anderen Verben aber zeigen sich noch andere Formen des Lobens: überschäumende Freude will singen, tanzen, spielen auf allen Instrumenten, im Chor mit der ganzen Schöpfung vereint, mit Feuer, Hagel, Schnee und Dampf – das Lob braucht auch die Fähigkeit zur Ekstase, um die Last des alltäglich Bedrohenden abzuschütteln; und das „Ich will Dir singen“ – das entdecken auch Kinder – ist nicht nur ein jubelnder Impuls der Liebe, sondern auch ein Wort trotzigen Widerstandes.
Leseempfehlungen
Albrecht, Folker et al., Psalmen. Einfach Religion. Paderborn 2012.
Baldermann, Ingo, Wer hört mein Weinen? Kinder entdecken sich selbst in den Psalmen. Neukirchen-Vluyn 112011.
Ders. Art. Psalmendidaktik. In: WiReLex (2015). [http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100042/]; Zugriff am 12.12.2017.
Geiger, Michaela/Theis, Stefanie, Psalter. In: Dressler, Bernhard/Schroeter-Wittke, Harald (Hg.), Religionspädagogischer Kommentar zur Bibel. Leipzig 2012, 167–181.
Itze, Ulrike/Moers, Edelgard, Psalmen: Gestalten – erleben – verstehen. Werkbuch Religionsunterricht 1 bis 6. Hamburg 52006.
Janowski, Bernd, Konfliktgespräche mit Gott. Eine Anthropologie der Psalmen. Neukirchen-Vluyn 2003.
Lessmann, Beate, Mein Gott, mein Gott … Mit Psalmworten biblische Themen erschließen. Neukirchen-Vluyn 2002.
Oberthür, Rainer/Mayer, Alois, In Bildworten der Bibel sich selbst entdecken. Heinsberg 1995.
Seybold, Klaus, Poetik der Psalmen. Stuttgart 2007.
Themenheft „Psalmen geben Sprache“. Grundschule Religion (56/2016).