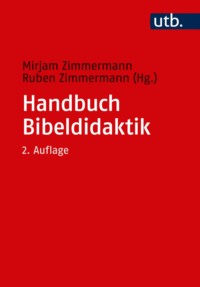Kitabı oku: «Handbuch Bibeldidaktik», sayfa 21
Fußnoten
1
Vgl. Janowski, 2003.
2
Vgl. Luther, Martin, Vorrede auf den Psalter in der Biblia Germanica. Wittenberg 1545, 289.
3
Das hebräische Wort næfæš bezeichnet nicht nur die Seele, sondern zugleich die Kehle; auch das ist als Selbsterfahrung nachvollziehbar: Die Kehle ist der Engpass des Atems, zugeschnürt ist sie der Ort, an dem die Angst leibhaft erfahren wird, und offen und frei das Organ, durch das hindurch sich Glück und Dank und Lebensfreude mit lauter Stimme artikulieren.
4
Erich Zenger führt hier u.a. die unterschiedlichen Zählungen zwischen LXX-Fassung und hebr. Psalmenbuch an, bei dem Ps 151 als „außerhalb der Zählung“ gekennzeichnet wird, bzw. die Rolle 11 QPsa 50 weitere Psalmen als Anhang konzipiert. Vgl. Zenger, Erich, Das Buch der Psalmen. In: Zenger, Erich et al., Einleitung in das Alte Testament. KStTh 1,1. Stuttgart 31998, 310–326, 310.
5
Proömium; 1f.; 1. Buch: 3–41: Davidpsalmen; 2. Buch: 42–72: Korachpsalmen (42–49), Asafpsalm (50), Davidpsalm (51–72); 3. Buch: 73–89: Asafpsalmen (73–83), Korachpsalmen (84–89); 4. Buch: 90–106: Mosekomposition (90–92), JHWH-Königtum (93–100), Davidkomposition (101–106); 5. Buch: 107–145: Lobpsalm (107), Davidpsalm (108–110), Torapsalm (111f.), Pesach-Hallel (113–118), Torapsalm (119); Wallfahrtspsalm (120–137), Davidpsalmen (138–145), Lobpsalm (145); Schluss: 146–150: JHWH-Königspsalmen.
6
Vgl. a.a.O., 321f.
7
Vgl. Gunkel, Hermann, Einleitung in die Psalmen, zu Ende geführt von Joachim Begrich. Göttingen 1933 (Nachdruck 1966).
8
Auch hier werden in anderen Publikationen noch andere Gattungen genannt z.B. Wallfahrtspsalmen, Königspsalmen, Weisheitliche Lehrgedichte, Geschichtspsalmen, Liturgien vgl. Seybold, Klaus, Die Psalmen. Eine Einführung. Stuttgart 21991, 97–102.
9
Neuere rezeptionsästhetische Ansätze haben diesen mündlichen Charakter der Psalmen und ihre kommunikative Kraft besonders herausgearbeitet; vgl. Erbele-Küster, Dorothea, Lesen als Akt des Betens. Eine Rezeptionsästhetik der Psalmen. WMANT 87. Neukirchen-Vluyn 2001.
10
Näheres zur Gesprächsstruktur → Art. Existenzielle Bibeldidaktik.
11
Die von Dietrich Bonhoeffer in den Briefen aus seiner Haft immer dringlicher erhobene Forderung, endlich nicht-religiös von den biblischen Erfahrungen zu reden, wird gegenwärtig gern relativiert durch die Beobachtung, dass Religion in der modernen Gesellschaft doch neuerlich wieder Raum finde, so dass es Aufgabe des Religionsunterrichts sei, Kindern und Jugendlichen die „religiöse Dimension“ zu erschließen und sie durch „religiöse Orientierung“ dafür kompetent zu machen – als ob nicht diese moderne Religiosität exakt die gleichen Kennzeichen trüge, die Bonhoeffer jener zukunftslosen Religiosität zuschreibt, die dem christlichen Glauben nicht kompatibel ist – es sind „die zeitbedingten Voraussetzungen der Metaphysik, der Innerlichkeit“ (WE NA S. 306), die gerade auch das moderne Interesse an der Religion kennzeichnen.
|156|Liebe und Sexualität
Ruben Zimmermann
Der Bibel ist nichts Menschliches fremd. Dies gilt auch für die körperlich-sexuelle Dimension: Neben der Vereinigung von Mann und Frau zu „einem Fleisch“ (Gen 2,24Gen 2,24) werden unterschiedliche Sexualpraktiken und Formen des Zusammenlebens der Geschlechter (z.B. Joh 4,16–19Joh 4,16–19; 1 Kor 5,11 Kor 5,1; Röm 1,26f.), der Ehe (z.B. auch Polygamie, z.B. Gen 29Gen 29) und Ehescheidung thematisiert. Wir lesen von Männern, die fremdgehen (David, 2 Sam 11)2 Sam 11 oder sich mit Prostituierten einlassen (Kundschafter bei Rahab, Jos 2,1Jos 2,1; Simson, Ri 16,1Ri 16,1; 1 Kor 6,12–201 Kor 6,12–20) und Frauen, die eben diesen Trieb als Gelegenheitshure für eigene Zwecke ausnutzen (Tamar und Juda, Gen 38Gen 38). Auch Inzest zwischen Vater und Töchtern (vgl. Lot, Gen 19,31–38Gen 19,31–38) oder unter Geschwistern (Amnon und Tamar, 2 Sam 132 Sam 13) oder brutale Vergewaltigungen (Ri 19,22–30Ri 19,22–30) werden nicht ausgespart. In Lev 18 wird ein Katalog von möglichen geschlechtlichen Beziehungen geboten, der auch nach heutigen Maßstäben sexueller Freizügigkeit noch mithalten kann (z.B. die Erwähnung von Sex mit Tieren, Lev 18,23Lev 18,23).
Die Bibel kennt also das, was wir heute mit dem Begriff der „Sexualität“ beschreiben, auch wenn ein vergleichbarer Abstraktbegriff in den Quellensprachen fehlt.[1] Stattdessen werden für die geschlechtliche Vereinigung häufig signifikante Metaphern verwendet, wie z.B. im positiven Sinn „erkennen“ (z.B. „Adam erkannte Eva“, Gen 4,1Gen 4,1.25Gen 4,25) oder negativ „die Scham aufdecken“ (Hos 2,12Hos 2,12).[2] Die Doppelsemantik der hier verwendeten Begriffe zeigt einen grundlegenden Zusammenhang: „Erkennen“ (hebr. jāda‘) kann ebenso für die Gottesbeziehung stehen (z.B. Jer 31,34Jer 31,34), „die Scham aufdecken“ (hebr. gālah) wird auch für „ins Exil führen“ (z.B. Jes 5,13Jes 5,13) verwendet; entsprechend bedeutet hebr. nā‘af sowohl „ehebrechen“ als auch „Götzendienst treiben“. Dass die genannte Reihe mit Sexualvergehen ausgerechnet im so genannten Heiligkeitsgesetz (Lev 17–26Lev 17–26) steht, unterstreicht diesen Zusammenhang. Das hebr. Wort qādōš – heilig – wird dann auch für die Verlobung (Quidduschin) verwendet. Die Sprache der Sexualität ist zugleich religiöse Sprache, Mystik und Erotik gehören nach der Bibel offenbar zusammen.[3] Die Ehe als ‚weltlich Ding‘ (M. Luther) zu bezeichnen, würde diesem Befund nicht gerecht. Doch auf welche Weise sind Gottesliebe und Menschenlust verbunden? Und welche Relevanz hat dieser Zusammenhang |157|heute noch? Vertritt die Bibel eine patriarchale und leibfeindliche Sexualmoral, die aufgrund einer modernen ‚Charta‘ des Sexualverhaltens kategorisch als irrelevant bezeichnet werden muss?[4] Oder kann sie auch heute noch bei körperlicher Liebe und Partnerschaft, z.B. für Christen, als Maßstab dienen? Wie kann und soll in unterrichtlichen Zusammenhängen mit den biblischen Aussagen zum Themenfeld umgegangen werden?
Zentrale Aspekte zu Liebe und Sexualität in der Bibel
Lange Zeit war die Überzeugung verbreitet, dass zwei Formen von Liebe, wie sie sich begrifflich in griech. erōs und agapē manifestieren, streng geschieden werden müssen und in der Bibel und besonders im Neuen Testament nur ein positives Konzept einer karitativen Nächstenliebe (agapē) entwickelt,[5] während die geschlechtlich-erotische Liebe ausgeblendet oder abgewertet werde.[6] Schon die sprachliche, aber auch strukturelle Analogie zwischen Gottesliebe und Menschenliebe in der Bibel beweisen das Gegenteil (vgl. Hos 2 f.Hos 2f.; Lk 7,36–50Lk 7,36–50; Eph 5,21–33Eph 5,21–33).[7] Auch wenn man die Felder von Gottes- bzw. Nächstenliebe (Dtn 6,5Dtn 6,5; Lev 19,18; zusammengefasst im „Doppelgebot der Liebe“, Mk 12,29–31Mk 12,29–31)[8] und geschlechtlicher Liebe unterscheiden kann, überlagern sie sich doch immer wieder und verstärken oder verhindern sich wechselseitig.[9] So ist im Bewusstsein zu halten, dass in der Bibel dem Hohenlied der agapē-Liebe (1 Kor 131 Kor 13) das ‚Hohelied‘ der erotischen Liebe (HldHld) beigeordnet ist, auch wenn im Folgenden primär diese geschlechtliche Liebe thematisiert wird.
Die Vielfalt der biblischen Texte aus weit entfernt liegenden Zeiten und Kulturkreisen verwehrt es, von der Sexualethik der Bibel zu sprechen. So finden sich sogar widersprüchliche Aussagen: Ist z.B. in vorexilischer Zeit Polygynie anerkannt, so wird um die Zeitenwende doch eine klare Präferenz der lebenslangen Einehe, ja sogar Einzigehe (über den Tod hinaus) erkennbar. Wird die Möglichkeit der Ehescheidung in der Tora rechtlich geregelt (Dtn 24,1–5Dtn 24,1–5), so spricht sich Jesus für ein radikales Scheidungsverbot aus (Mk 10,10–12Mk 10,10–12; 1 Kor 7,10 f.1 Kor 7,10f.).
Als relativ konstante Einschätzung im Sinne einer „longue durée“ wird die Ehe zwischen Mann und Frau (Gen 1,27Gen 1,27; Mk 10,6Mk 10,6; Mt 19,4f.) als dominante Lebensform und als der gute Ort sexueller Praxis (Spr 5,15–20Spr 5,15–20) benannt.[10] Abweichende Sexualpraktiken werden negativ bewertet (z.B. Ehebruch Ex 20,14Ex 20,14; |158|ferner Lev 18Lev 18; 20Lev 20). Die Bibel kennt und benennt die Gefahren, die aus der sexuellen Kraft erwachsen. Paulus mahnt deshalb, bestimmte Sexualpraktiken (porneia) zu meiden, ja davor zu fliehen wie vor einer gefährlichen Macht (1 Kor 6,181 Kor 6,18).[11] Ferner gibt es auch immer wieder Appelle zur zeitlich begrenzten oder grundsätzlichen Sexualaskese (1 Sam 21,51 Sam 21,5; Jes 54,1Jes 54,1; Mt 19,12Mt 19,12; 1 Kor 7,26f.; Offb 14,4Offb 14,4), die jedoch keineswegs über asketische Tendenzen in jüdischen und griechisch-römischen Umwelttexten hinausgehen.[12] Man darf deshalb nicht übersehen, dass es viele Texte gibt, in denen gelingende Sexualbeziehungen beschrieben werden. Am deutlichsten wird dies im so genannten atl. „Hohelied“, einer Sammlung von Liebesliedern, die in überraschender Offenheit die Begehrlichkeit des Körpers (z.B. der Brüste oder des Venushügels [Hld 4,6Hld 4,6; 7,2Hld 7,2]) und die Erotik – vermutlich sogar außerehelicher – sexueller Vereinigung besingen (Hld 1,3–7Hld 1,3–7; 3,1–5Hld 3,1–5; 5,1–7Hld 5,1–7). Besonders in 1 Kor 7 wird eine – für die patriarchal-hierarchisch geprägte Antike beachtliche – Reziprozität und Zweckfreiheit (es geht hier nicht um Nachkommenschaft!) der Sexualpraxis von Ehepartnern beschrieben (1 Kor 7,3 f.1 Kor 7,3f.).
Hermeneutik und Didaktik
War in der problemorientierten Phase des RUs das Thema Liebe-Sexualität besonders beliebt, so ist es heute aus den Lehrplänen weitgehend verbannt.[13] Dass der Sexualkundeunterricht von der Grundschule an intensiv von anderen Fächern betrieben wird, kann den RU einerseits entlasten, sollte aber gerade auch als Chance gesehen werden, den spezifisch religiösen Beitrag zum Thema in den Blick zu nehmen.
Auf die vielfältigen didaktischen Möglichkeiten, die das Thema „Gottes- und Nächstenliebe“ (einschließlich Elternliebe, Freundschaft, Diakonie)[14] bzw. Gender im weiteren Sinn birgt, kann hier nicht näher eingegangen werden. Stattdessen wird das Thema der geschlechtlichen Liebe bzw. Sexualität fokussiert.
Eine erste Aufgabe besteht in der Informations- und Aufklärungsarbeit gegenüber dem verbreiteten Vorurteil der Sexualfeindlichkeit. Religion und Bibel müssen kein gebrochenes Verhältnis zur Sexualität haben, auch wenn es genügend Zeugnisse der Kirchengeschichte (bis zu den jüngsten Missbrauchsskandalen) gibt, die dies zu bestätigen scheinen. Biblische Texte, wie z.B. das atl. Hohelied, könnten hier eine einseitige Sicht korrigieren helfen, aber auch dazu inspirieren, Liebe und Sexualität wieder neu als Gaben Gottes zu erkennen.
|159|Allerdings wird ein Blick in die Texte (z.B. die Liebesmetaphern) sofort sichtbar machen, dass die kulturelle Differenz und Fremdheit zur Geltung gebracht werden müssen.[15] Selbst in Bereichen, in denen terminologische Analogien vermutet werden können, gibt es bei genauem Hinsehen Differenzen (Onan praktiziert z.B. keine Selbstbefriedigung, sondern einen coitus interruptus, vgl. Gen 38,9Gen 38,9). Auch das Thema „vorehelicher Sex“ kommt nicht vor, weil das Heiratsalter bei Mädchen bei 12 lag und ein Sexualkontakt ohnehin als Mittel der Ehebesiegelung betrachtet wurde. Eine einlinige Ableitung sexualethischer Normen aus der Bibel ist deshalb nicht möglich. Entsprechend kann auch von der polemischen Deskription homosexueller Praktiken (Lev 18,22Lev 18,22; 1 Kor 6,91 Kor 6,9) nicht die religiöse Abwertung homosexueller Partnerschaften in der Gegenwart abgeleitet werden.[16] Hier kann es also darum gehen, biblische Traditionen kontextuell zu verorten und kritisch zu reflektieren.
Dabei ist man bereits mitten in einer hermeneutischen Diskussion: Die religiöse Legitimierung einer bestimmten z.B. bürgerlichen Sexualmoral wird den Texten nicht gerecht. Die Bibel aber kategorisch in Fragen von Liebe, Sexualität und Partnerschaft als untauglich zu deklarieren, würde ihre Irrelevanz in einem zentralen Bereich des Lebens zur Folge haben. Bei einer kritischen und differenzierten Wahrnehmung und Bewertung können die biblischen Aussagen zu Liebe und Sexualität hingegen zu einem spannenden Lernfeld hermeneutischer und ethischer Kompetenz werden.[17]
So sehr die biblischen Texte zur Sexualität in die Rahmenbedingungen ihrer Zeit eingebunden sind, leuchten doch auch darin theologische Grundbekenntnisse zu Reziprozität, altruistischer Achtsamkeit und sogar Heiligkeit (1 Thess 4,3–51 Thess 4,3–5; 1 Kor 6,201 Kor 6,20) von Körper und Sexualität hervor, die auch gegenwärtig christliche Anthropologie anregen können. Eine ‚Entheiligung‘ der Sexualität birgt die Gefahr, die körperliche Vereinigung der Menschen als ‚bloßen Sex‘, Ersatzdroge oder Leistungssport zu trivialisieren oder überzubewerten. Gegenüber einer Dominanz des Sexuellen in der Medienlandschaft kann der Blick in die Bibel jedoch Jugendliche auch entlasten. Sexualität wird ernst genommen, aber doch letztlich unter dem ‚Vorletzten‘ eingeordnet. Es gibt Wertungsmaßstäbe, nach denen sich Mann- und Frausein relativieren, weil in Christus die Geschlechterdifferenz überwunden wird (vgl. Gal 3,28Gal 3,28) oder weil das Begehren und Ehelichen in Gottes Welt keine Rolle mehr spielt (Mk 12,25Mk 12,25).
|160|Leseempfehlungen
Böhler, Patrik, Siegelungen im Garten der Liebe. Sechs Bausteine für den Religionsunterricht. Reli 39 (2010) 3, 10–14.
Büchner, Frauke, Hohes Lied. In: Dressler, Bernhard/Schroeter-Wittke, Harald (Hg.), Religionspädagogischer Kommentar zur Bibel. Leipzig 2012, 197–204.
Dabrock, Peter u.a., Unverschämt – schön. Sexualethik: evangelisch und lebensnah. Gütersloh 2015.
Haag, Herbert/Elliger, Katharina, Zur Liebe befreit. Sexualität in der Bibel und heute. Zürich/Düsseldorf ²1999.
Karle, Isolde, Liebe in der Moderne. Körperlichkeit, Sexualität und Ehe. Gütersloh 2014.
Loader, William, Art. Sexualität (NT). In: WiBiLex (2014). [https://www.bibelwissenschaft.de/de/stichwort/53967/].
Neuschäfer, Reiner A., Immer und ewig!? Kopiervorlagen zum Thema Liebe, Freundschaft, Sexualität. Sekundarstufe I. Göttingen 2008.
Nord, Ilona, Art. Sexualität. In: WiReLex (2017).
[http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100290/]; Zugriff am 12.12.2017.
Schmoll, Dorothea, Es ist, was es ist! Eine Unterrichtseinheit für die Mittelstufe. Freising 2010.
Söding, Thomas, Nächstenliebe. Gottes Gebot als Verheißung und Anspruch. Freiburg i.Br. 2015.
Themenheft „Sex und Macht“. ZNT 30 (2012).
Themenheft „Sexualität“. rabs Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen (2/2009).
Themenheft „Ist das Liebe?“ Religion 5–10 28 (2017).
Themenheft „Erotik. Hohe Lieder der Liebe“. Religion betrifft uns (3/2003).
Themenheft „Sexualität“. RelliS (3/2013).
Tiedemann, Holger, Paulus und das Begehren. Liebe, Lust und letzte Ziele. Oder: Das Gesetz in den Gliedern. Stuttgart 2002.
Wischmeyer, Oda, Liebe als Agape. Das frühchristliche Konzept und der moderne Diskurs. Tübingen 2015.
Zimmermann, Ruben, Geschlechtermetaphorik und Gottesverhältnis. Traditionsgeschichte und Theologie eines Bildfelds in Urchristentum und antiker Umwelt. WUNT II/122. Tübingen 2001 (online abrufbar unter https://publications.ub.uni-mainz.de/opus/volltexte/2017/56462/pdf/56462.pdf; Zugriff am 17.12.2017).
Zimmermann, Ruben, Körperlichkeit, Leiblichkeit, Sexualität. Mann und Frau. In: Horn, Friedrich W. (Hg.), Paulus Handbuch. Tübingen 2013, 378–385.
Fußnoten
1
Vgl. Tiedemann, 2002, 22–31, der hierbei Gedanken von Michel Foucault appliziert.
2
Vgl. zum Aspekt der sexuellen Gewalt mit gālah Baumann, Gerlinde, Liebe und Gewalt. Die Ehe als Metapher für das Verhältnis JHWH-Israel in den Prophetenbüchern. SBS 185. Stuttgart 2000, 56–62.
3
Vgl. ausführlich Zimmermann, 2001, 690–692, sowie Bartelmus, Rüdiger, Art. Sexualität (AT). In: WiBiLex (2008). [https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/28477/]; Zugriff am 13.01.2013, hier 2.1.1.
4
So Bormann, Lukas, Sexualizing with the New Testament? Das Neue Testament kann keine Grundlage einer zeitgemäßen Sexualethik sein. ZNT 30 (2012), 46–51.
5
Vgl. dazu Wischmeyer, 2015, 73–160; Söding, 2015.
6
Vgl. hier etwa die maßgebliche Arbeit von Nygren, Anders, Eros und Agape. Gestaltwandlungen der christlichen Liebe. Gütersloh 21954.
7
Vgl. hierzu das Ergebnis bei Zimmermann, 2001, 683–711.
8
Vgl. dazu grundlegend Wischmeyer, 2015; Söding, 2015.
9
Zu den unterschiedlichen Spielarten dieser Interferenzen siehe Zimmermann, 2001, 683–711.
10
Vgl. Loader, 2014.
11
Vgl. Zimmermann, 2013, 380–384.
12
So etwa in Weish 3,13f.; Qumran (1QM 7,1–7; 4Q 271; 11Q 19; 45,10–12); Philo Vit Mos 2,67–69; Epictet Diss. III,22; CD XII, 1f., vgl. dazu Exkurs ‚Ehelosigkeit und Sexualaskese‘ in Zimmermann, 2001, 531–537.
13
Vgl. etwa die Bildungsstandards Baden-Württemberg Grundschule/Haupt/ Gym (2004) oder Kernlehrplan für das Gymnasium – Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen (2011), die keinen Treffer für die einschlägigen Stichworte anzeigen.
14
Vgl. hierzu Themenheft „Ist das Liebe?“ Religion 5–10 28 (2017).
15
Vgl. den Beitrag von Frauke Büchner, Schön bist du – das Hohe Lied der Liebe. In: Religion 5–10 28 (2017).
16
Vgl. zu diesem Feld Scholz, Stefan, Art. Homosexualität (NT). In: WiBiLex (2012). [https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/46910/]; Zugriff am 11.06.2017.
17
Vgl. die Anregungen bei Karle, 2014, 117–138.183–192; Dabrock u.a., 2015, 17–40; Huizing, Klaas, Scham und Ehre. Eine theologische Ethik. Gütersloh 2016, 269–311.
Weihnachts- und Kindheitsgeschichten Jesu
Sonja Angelika Strube
Als „Weihnachtsgeschichte(n)“ werden die Kindheitsevangelien des Matthäus (Mt 1 f.)Mt 1f. und Lukas (Lk 1 f.)Lk 1f. alle Jahre wieder aktuell. Wohl kein anderer biblischer Text ist im kulturellen Gedächtnis unserer Gesellschaft so präsent wie diese beiden; Weihnachten ist, so M. Morgenrot, neben Taufe, Konfirmation |161|(resp. Erstkommunion), Hochzeit und Begräbnis für viele Menschen „einer der wenigen Schnittpunkte, an denen sich individualisierte Religiosität und offizielles Christentum treffen“.[1] Dementsprechend geben die Advents- und Weihnachtszeit einen wichtigen Anlass zur Beschäftigung mit den ntl. Kindheitsevangelien, die als konzentrierte Christusverkündigung über sich selbst hinaus auf Jesu Wirken, Passion und Auferstehung verweisen. Wer dieses Potenzial lebendig werden lässt, kann durch die Arbeit mit diesen kleinen Ausschnitten der Evangelien Grundlagen des christlichen Glaubens weitergeben und Interesse an weiteren Bibeltexten wecken.
Auch der Koran enthält Texte über Jesu Geburt, so dass auch im Kontext des Interreligiösen Dialogs Gemeinsamkeiten und Unterscheide der verschiedenen religiösen Traditionen aufgegriffen werden können. Ein weiterer aktueller Anknüpfungspunkt ist das verbreitete Interesse an außerbiblischen Kindheitsgeschichten.
Die ntl. Kindheitsevangelien (Mt 1f., Lk 1f.)
Nur die Evangelien nach Mt und Lk beginnen mit Erzählungen über Zeugung, Geburt und Kindheit Jesu. Was nach heutigem Wirklichkeitsverständnis höchst symbolträchtige Geschichten und gerade keine biographischen Fakten sind, fand sich zur Zeit Jesu regelmäßig in antiken Biographien berühmter Helden, seien es Kaiser, Götter oder Sagengestalten: Erzählungen von übernatürlichen Begebenheiten bei Zeugung und Geburt ebenso wie über wundersame Rettungen. Auch das Erste Testament kennt Erzählungen über wunderbare Empfängnis trotz Unfruchtbarkeit oder hohen Alters (Sara: Gen 18Gen 18, Hanna: 1 Sam 1 f.)1 Sam 1f. und wunderbare Rettungen (Mose: Ex 1 f.).Ex 1f. Die Kindheitsevangelien vergleichen durch ihre Erzählweise den einfachen Zimmermannssohn aus Nazaret mit römischen Kaisern und Göttern, die er als wahrer Heilsbringer und Gottessohn überstrahlt, und sie verkündigen Jesus als den Messias, auf den Israel hofft.
Was heute, gefördert durch Krippendarstellungen, wie eine einzige Kindheitsgeschichte erscheint – der Geburt im Stall und der Anbetung der Hirten scheinen die Anbetung der Könige und die Flucht nach Ägypten zu folgen –, sind tatsächlich zwei von einander unabhängige, jeweils in sich geschlossene Kindheitsevangelien. Beide stimmen in den historischen Erinnerungen überein, dass Jesus in Nazaret aufgewachsen ist und seine (zumindest sozialen) Eltern Maria und Josef hießen. Beide verkündigen auf je eigene Art Jesus als den verheißenen Messias aus dem Hause Davids (Betlehem!) und als Gottes Sohn. Dennoch sind die beiden Erzählungen nicht einfach miteinander harmonisierbar, denn sie widersprechen sich in entscheidenden Details – was auch zeigt, dass sie keine historischen Berichte im modernen Sinn sind.