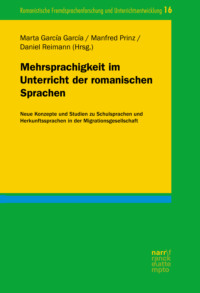Kitabı oku: «Mehrsprachigkeit im Unterricht der romanischen Sprachen», sayfa 9
4. Kulturgeschichte
4.1 Sprachgeschichte
Die Beschäftigung mit Sprache kann ohne kulturgeschichtlichen Rahmen nicht funktionieren; entsprechend befaßt sich auch Aurea Bulla nicht nur mit Sprachwandel, sondern auch mit dessen historischen Ursachen und der Veränderung der Lebenswelten im Lauf der Zeiten. Oben ist schon erwähnt worden, dass die Faltkarte des römischen Reiches und seiner Grenzen mit der Ausbreitung des Romanischen in Zusammenhang gebracht werden kann und soll; weitere Lehrbuchteile befassen sich ebenfalls mit dem Phänomen Sprachgeschichte, und zwar auf sehr vielfältige Art und Weise: Schon zu Beginn des ersten Exercitia-Bandes (1.4.13) wird der Begriff der Etymologie eingeführt und mit einfachen Erschließungsübungen ergänzt; der Magazinteil “Der Mensch und die Sprache” (1.64–69) schlägt einen breiten Bogen von der Entwicklung menschlicher Sprache an sich über die indoeuropäischen Sprachfamilien bis hin zum Einfluss des Lateinischen auf die germanischen Sprachen Deutsch und Englisch; im Lingua-Teil des Caput VII und VIII werden lautliche Veränderungen vom Lateinischen zum Französischen grundsätzlicher erklärt – nicht ohne den Hinweis, dass es sich hierbei um Tendenzen handelt und nicht um Regeln mit universeller Gültigkeit (2.111f.; 2.145–148);1 schließlich wird am Beispiel des lateinischen Wortes gratia verdeutlicht, wie sich aus derselben Vokabel im Lauf der Zeit verschiedene Bedeutungen ergeben können (3.35, Abb. 8).

4.2 Interkulturelles Lernen
Es bleibt aber nicht bei einer rein diachron-historischen Betrachtung. ‘Das antike Rom’ oder ‘Latein’ sind keine genau definierbaren Kultur- oder Sprachkreise. Die römische Antike lebt weit über die Grenzen Italiens hinaus fort, nicht nur in der mittelmeerumspannenden Oikumene des römischen Reiches, sondern auch in den Ländern, in denen die Römer selber nie Fuß gefasst haben, sondern die auf andere (mehr oder weniger problematische) Weise westliche Kultur- und Sprachelemente übernommen haben. Die Schüler*innen, die heute Latein lernen, befinden sich ihren Großeltern und wahrscheinlich sogar Eltern gegenüber in der neuartigen Situation einer immer heterogener werdenden Gesellschaft, in der verschiedene kulturelle Hintergründe und Bildungsbiographien aufeinandertreffen. Aus diesem Grund eignet sich die Folie der römischen Antike sehr gut als Modell für die heutige Gesellschaft, und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, werden in Aurea Bulla vielfach genutzt.
Natürlich können die Ziele hier nicht zu ehrgeizig sein. Ebensowenig wie Lingua Latein die Schüler*innen befähigt, Spanisch zu sprechen, werden Themen wie Sklaverei, Geschlechterrollen, Menschenrechte oder Religion in Aurea Bulla erschöpfend behandelt. Gerade in Bereichen, die in der Lebenswelt der Schüler*innen problematisch oder zumindest heikel sein könnten, darf keine Belehrung über heutige Zustände erfolgen, die ohnehin immer ungenau und pauschalisierend wäre – man denke z.B. an den aktuell beliebten Vergleich des troianischen Flüchtlings Aeneas mit heutigen Geflüchteten1, der zwar naheliegt, aber die spezifischen Gegebenheiten der jeweiligen Situation kaum adäquat berücksichtigen kann. Stattdessen werden in Aurea Bulla Themen angesprochen, die bei heutigen Lernenden Resonanz finden können, ohne aktiv Vergleiche zum Heute zu ziehen; wenn dies geschehen kann oder soll, finden sich die Anregungen in Form von Fragen wieder.
Dass in der römischen Welt gesellschaftliche Konflikte existieren, wie sie auch heute an der Tagesordnung sind, ist zentrales Thema der Lehrbuchgeschichte: Valens und Julia haben kaum eine Chance, als Paar zusammenzukommen, weil die Überwindung ihres Standesunterschieds nicht vorgesehen ist. Eine erste mögliche Reaktion heutiger Schüler*innen wäre die spontane Annahme, dass in der heutigen Welt Standesunterschiede keine Rolle mehr spielten; dieser naiven Abgrenzung von der antiken Welt wird bereits nach dem ersten Kapitel der Lehrbuchstory durch entsprechende Fragestellungen vorgebeugt: “Lies die Erzählung durch und notiere, aus welchen gesellschaftlichen Gruppen die Personen in der Geschichte kommen! … Diskutiert in der Lerngruppe, ob es auch in unserer heutigen Gesellschaft verschiedene Schichten gibt!” (1.15.4 und 8).
Ausgehend von der gesellschaftlichen Problematik, der sich die beiden Hauptfiguren der Geschichte ausgesetzt sehen, verändert sich ihre Perspektive auf die Welt; hier kommt auch das Thema Sklaverei zur Sprache. In gängigen Lateinlehrbüchern wird die Tatsache, dass in der Antike Menschen als Besitz gehalten und gehandelt wurden, in normalisierter Form präsentiert, etwa im lateinischen Lehrbuchtext der 2. Lektion des Lehrmittels Actio 1,2 in dem ein harmlos-harmonisches Familienleben mit Vater, Mutter, Kindern und Sklaven suggeriert wird, bei dem jede Figur fröhlich ihren Aufgaben nachgeht. Natürlich kommen auch in Aurea Bulla Sklaven vor, ohne dass das Thema jedesmal ausführlich behandelt werden kann, aber wenigstens gibt es an einer Stelle Gelegenheit: In der Geschichte von Caput VI (2.46–49) wird die Lebensgeschichte der Sklavin Radoara berichtet, die im Zuge ihrer Versklavung Entsetzliches erlebt haben muss; die Erzählung bringt wiederum den Protagonisten Valens dazu, das Phänomen der Sklavenhaltung generell zu hinterfragen. Wieder werden die Überlegungen durch Aufgabenstellungen an die Schüler*innen weitergeführt, die absichtlich offen gehalten sind: “Beschreibe Radoadas bisheriges Leben! […] Erfindet Lebensgeschichten der [2.49, hier Abb. 9] dargestellten Sklavinnen und Sklaven.

Schreibt sie auf und hängt sie zusammen mit einer Kopie der Illustration im Schulzimmer auf.” Bereits im ersten Band werden im Rahmen der Res Romanae die gesellschaftlichen Rangordnungen in der Welt von Valens und Julia erklärt (1.79f.), erneut zum Vergleich mit heute aufgefordert (1.80.5); das Thema Sklaverei wird direkt im Anschluss anhand einer recht drastischen Textpassage aus Varros De Re Rustica3 thematisiert, in der Sklaven unter den Arbeitsinstrumenten als genus vocale bezeichnet werden, ‘sprachfähig’ im Gegensatz zum genus semivocale (‘halbsprachfähig’, also Tiere) und mutum (‘stumm’, also z.B. Fuhrwerke). Die Schüler*innen werden u.a. dazu aufgefordert, die (erstaunlich kurz zurückliegenden) Zeitpunkte zu recherchieren, an denen die Sklaverei in Europa und Amerika abgeschafft wurde, und sich Gedanken über moderne Formen der Sklaverei zu machen (1.81.7 und 9).
Themen dieser Art werden immer wieder aufgegriffen, zuletzt bei einer mehrsprachigkeitsdidaktischen Aufgabe, in der es zunächst darum geht, einen italienischen und einen spanischen Text zum Thema Menschenrechte zu verstehen (Ex. 3.52f.); in zweiter Linie werden die Schüler*innen jedoch wieder zur Diskussion aufgefordert: “Diskutiert, was ihr unter ‘Würde des Menschen’ versteht! Gibt es Eurer Meinung nach Grenzen der Toleranz?” (Ex. 3.53.7). Ziel dieser Art von Aufgaben ist es, den Schüler*innen die Kontinuität gewisser Problemstellungen aufzuzeigen und den historischen Hintergrund gesellschaftlicher Haltungen zu beleuchten.
Auch Fragen nach Geschlechterrollen und -verhältnissen spielen in Aurea Bulla eine Rolle, zum Beispiel beim Thema der Heiratsbräuche, denen Valens und Julia unterworfen sind (2.13–15). Hier werden die geschlechtsspezifischen Erwartungen auch sprachlich beleuchtet: Der Akt des Heiratens wird im Lateinischen nach Mann und Frau unterschieden; während beim ersteren die aktive Wendung in matrimonium ducere, ‘in die Ehe führen’, verwendet wird, steht für die Frau nubere mit einer Art Dativus commodi, etwa ‘sich dem Manne verheiraten’. Wieder werden die Schüler*innen zum Vergleich mit heutigen Gebräuchen aufgefordert, diesmal auch mit Berücksichtigung verschiedener (eigener) Kulturkreise: “Welche Arten von Heiraten und gesetzlich anerkannten Partnerschaften existieren heute in der Schweiz und in euren Herkunftsländern?” (2.15.2).4 Der Schritt von der römischen Antike, in der ein Tavernenbub keine Bürgermeistertochter heiraten darf, zu heutigen Gesellschaften, in denen beispielsweise homosexuelle Paare nicht heiraten dürfen, erscheint in einer solchen Diskussion unter Umständen nicht mehr allzuweit.
Die kulturelle Heterogenität der Schülerschaft wird auch bei weiteren Themen ins Spiel gebracht, etwa bei den Feldern Bestattung und Jenseitsvorstellungen: “Welche Bestattungsriten kennt ihr? Vergleicht sie mit den römischen! Welche Vorstellungen vom Jenseits sind euch aus eurem Kulturkreis bekannt? Vergleicht sie mit jenen der Römer! Kennt ihr Bräuche, die mit der römischen Laren-Verehrung vergleichbar sind?” (2.130.1–4). Diese Art offener Diskussion ermöglicht es den Schüler*innen, in offener Pluralität auch über religiöse Vorstellungen zu sprechen, ohne dass Wertungen vorgenommen werden: Der Vergleich wird nicht auferlegt, sondern ist von den Lernenden frei wählbar; zudem erfolgt er mit der weit entfernten Folie der römischen Antike, nicht in erster Linie zwischen heutigen Religionen. Gleichzeitig eröffnet sich idealerweise ein Zugang zur polytheistischen und multikulturellen antiken Gesellschaft, die säkulare Lebensweisen neben zahlreichen Kulten und Religionen kennt.
Fazit
Der heutige Lateinunterricht benötigt zeitgemäße Formate, die aktuellen Faktoren wie migrationsbedingter Mehrsprachigkeit, kultureller Heterogenität und bildungsbiographischer Diversität Rechnung tragen. Das Lehrmittel Aurea Bulla und das Schulfach Lingua Latein verstehen sich als Beitrag zu dieser Aktualisierung des Lateinunterrichts. Natürlich bedingt die Verbreiterung des mehrsprachigkeitsdidaktischen und kulturhistorischen Ansatzes eine Schmälerung des eigentlich latinistischen Curriculums, wobei die sich stark unterscheidenden Rahmenbedingungen und die geringe Stundenzahl das Ihrige tun. Dies muss jedoch kein allzu gravierender Verlust sein: Bei den aktuellen Bedingungen in den Basler Halbkantonen ist es den Schüler*innen möglich, am Gymnasium weitere vier Jahre ‘traditionellen’ Latein-Unterricht zu belegen; umgekehrt erreicht das Fach auf Sekundarschulebene zahlreiche Schüler*innen, die bisher nie mit Latein in Kontakt gekommen sind.
Es genügt nicht, sich darauf zu verlassen, dass die lateinische Grammatik eine positive Eigendynamik entwickelt, die auf die neusprachlichen Fächer und die Deutschkompetenz der Lernenden wirkt. Entsprechend wird das vielgepriesene sprachfördernde Potential des Latein-Unterrichts in Aurea Bulla in einer Reihe mehrsprachigkeitsdidaktischer Aufgabenformate eingesetzt. Ferner wird die multikulturelle und multilinguale Welt der Antike konsequent in ihrem Zusammenhang mit der Moderne dargestellt, ohne Komplexitäten zu vereinfachen und Probleme zu normalisieren oder zu marginalisieren. Die Lernenden bewegen sich offen und neugierig und zwischen den Sprachen (auch den ihnen unbekannten). Sie sind experimentierfreudig und entdecken, dass sie mehr verstehen als sie glauben. Ziel ist, den heutigen Schüler*innen ein sprachliches und kulturelles Grundgerüst im eigentlichen Wortsinn zu geben: keine definitive Konstruktion, sondern etwas, auf dem sie aufbauen können.
Bildlegenden:
Abb. 1: Julia und Valens (Band 1, Faltumschlag vorn)
Abb. 2: Vocabula (Band 3, S. 183)
Abb. 3: Präfixe (Band 3, S. 121)
Abb. 4: Suffixe (Exercitia 2, S. 30)
Abb. 5: Mehrsprachiger Vergleich der Subjektsebene (Band 1, Seite 26)
Abb. 6:Mehrsprachiger Vergleich des Tempusgebrauchs (Exercitia 3, Seite 14)
Abb. 7: Mehrsprachige Erschließungsaufgabe (Band 1, S. 44f.)
Abb. 8: Bedeutungsverschiebungen (Band 3, S. 35)
Abb. 9: Sklavendarstellung (Band 2, S. 49)
Die Abbildungen erfolgen mit der freundlichen Genehmigung von Atelier bunterhund, Zürich (Abb.1, Abb. 9), und aplus caruso GmbH, Basel (Abb. 2–8).
Bibliographie
Habenstein et al. 1992 Latein: Grund- und Aufbauwortschatz, von Ernst Habenstein, Eberhard Hermes, Herbert Zimmermann; Neubearbeitung von Gunter H. Klemm. Stuttgart, Klett 20122 (19921).
Holtermann et al. 2005 Martin Holtermann, Irmgard Meyer-Eppler,
Günter Laser, Uwe Rademacher, Stefan Rebenich, Barbara Verwiebe, Anke Zegermacher und Patrich Zegermacher, Actio 1, Stuttgart/Leipzig 2005.
Kipf 2014a Stefan Kipf, Integration durch Sprache. Schüler nichtdeutscherHerkunftssprache lernen Latein, Bamberg 2014.
Kipf 2014b Stefan Kipf, “Lateinunterricht und Zweitsprachförderung. Neue Perspektiven für eine alte Sprache”, in: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht. Didaktik und Methodik im Bereich Deutsch als Fremdsprache, 19.1, 99–108.
Kuhlmann 2009 Peter Kuhlmann, Fachdidaktik Latein kompakt, Göttingen 2009. Kapitel “Wortschatzarbeit”, 54–68.
Nickel 1999 Rainer Nickel, “Wortschatzarbeit – wie, warum, wozu?”, in AU 1999/4, 2–12.
Nickel 2004 Rainer Nickel, “Synoptisches Lesen und bilinguales Textverstehen”, in AU 1/2004, 2–14.
Niemann 2016, Karl-Heinz, “Flucht, Schutzsuche und Schutzgewährung. Eine Unterrichtsreihe im Rahmen der Aeneis-Lektüre”, in: AU 4/5, 2016, 22–37.
Schirok 2010 Edith Schirok,“Wortschatzarbeit”, in: Marina Keip und Thomas Doepner, Interaktive Fachdidaktik Latein, Göttingen 2010, 13–34.
Weiß 2007 Dorothea Weiß, Catull, c. 8. und der Übersetzungsvergleich, in: Pegasus-Onlinezeitschrift VII/1, 2007, 57–110.
I am aprendiendo linguam hispanicam. Eine Untersuchung zum metasprachlichen Bewusstsein von Spanischlernenden
Lukas Eibensteiner / Johannes Müller-Lancé
1 Einleitung
Seit Mitte der 1990er Jahre zählen Sprachbewusstsein und Sprachlernbewusstheit zu den zentralen Konzepten der Sprachenlehre (cf. Schmidt 2010, 858sq.). Wir definieren Ersteres in Anlehnung an die Association for Language Awareness als „explicit knowledge about language, and conscious perception and sensitivity in language learning, language teaching and use” (ALA 2017). Unter Sprachlernbewusstheit verstehen wir in Anlehnung an Edmondson (1997, 93) „Kenntnisse über das Fremdsprachenlernen allgemein und/oder über das eigene Fremdsprachenlernen […], die nach Auffassung des Subjekts Einfluß auf das Fremdsprachenlernen hatten, haben oder haben können und bei Bedarf artikuliert werden können“. Aufgrund des oftmals postulierten positiven Zusammenhangs dieser beiden Konzepte im Hinblick auf eine bessere Sprachbeherrschung (cf. Schmidt 2010, 859), finden sie auch Einzug in den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Sensibilität für Sprache und Sprachgebrauch würde demnach dazu beitragen, eine neue Sprache leichter zu lernen und zu verwenden (cf. Europarat 2001, 108). Aufgrund dieser positiven Zuschreibung sind die beiden Konzepte auch aus den schulischen Lehrplänen nicht mehr wegzudenken. So schreibt beispielsweise der Bildungsplan für das Fach Spanisch in Baden-Württemberg, dass die „Schülerinnen und Schüler […] beim Erwerb der sprachlichen Mittel die spezifischen Ausprägungen des Spanischen auch im Vergleich zu anderen Sprachen“ reflektieren (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2016, 9). Der Bildungsplan betont somit nicht nur die Wichtigkeit der Konzepte des Sprachbewusstseins und der Sprachlernbewusstheit, sondern setzt diese auch in Bezug zur Komponente des Sprachvergleichs, der wiederum als zentrales Element mehrsprachigkeitsdidaktischer Ansätze verstanden werden kann. Die Nutzung von sprachlichem Vorwissen und die Implementierung sprachvernetzender Ansätze in den Fremdsprachenunterricht werden seither als wichtige Ziele der Mehrsprachigkeitsdidaktik verstanden. In diesem Kontext sind zahlreiche theoretische und praxisorientierte Arbeiten entstanden (cf. Meißner/Reinfried 1998, Stegmann/Klein 1999, Müller-Lancé 2006, Bär 2009). Seit spätestens 2010 lassen sich vermehrt Veröffentlichungen feststellen, die versuchen, sowohl weitere Schulfremdsprachen (cf. Klein/Reissner 2006, Leitzke-Ungerer/Blell/Vences 2012) als auch sogenannte Herkunfts- und Familiensprachen (cf. Fernández Ammann/Kropp/Müller-Lancé 2015) in ihre Überlegungen zu integrieren (cf. Reimann 2016, 17). Auch erste mehrsprachigkeitsdidaktische Lehrwerke wurden bereits vorgelegt (cf. Holzinger et al. 2012). Nichtsdestoweniger zeigen Lehrer/innen-Befragungen, dass Lehrerinnen und Lehrer zwar durchaus „eine positive Einstellung zur Förderung von Mehrsprachigkeit und zum Nutzen bewusstmachender Sprachvergleiche“ (Neveling 2012, 230) haben, diese aber selten planen oder mithilfe von Zusatzmaterialien durchführen (cf. Heyder/Schädlich 2015, 242). In dem folgenden Beitrag wollen wir nicht die Lehrerseite fokussieren, sondern stellen uns die Frage, ob Schülerinnen und Schüler sprachstrukturelle Ähnlichkeiten und Differenzen des spanischen imperfecto bzw. der Periphrase estar + gerundio zu ihrem sprachlichen Vorwissen in Bezug setzen können und ob diese Parallelen als förderlich für den Erwerb des Spanischen wahrgenommen werden.
2 Transferpotenziale beim Erwerb des spanischen imperfecto und estar + gerundio
Der Erwerb des spanischen Imperfekts bereitet deutschsprachigen Lernenden erfahrungsgemäß Schwierigkeiten. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die aspektuelle Opposition von perfektiv und imperfektiv im Deutschen nicht grammatikalisiert ist und sich die Lernenden diese komplexe Unterscheidung erst durch die Konfrontation mit dem L2-/L3-/Lx-Input aneignen können. Beim Erwerb des Englischen werden die meisten Lernenden im deutschen und österreichischen Schulsystem das erste Mal mit einer aspektuellen Opposition konfrontiert. Anders als das Deutsche besitzt das Englische eine vollständig grammatikalisierte und obligatorische progressive-Form (be + Verb-ing) (cf. Comrie 1976, 7), die in Form und Funktion der spanischen Periphrase estar + gerundio gleicht. Eine weitere Form-Funktions-Äquivalenz finden wir, wenn wir das spanische imperfecto mit dem lateinischen Imperfekt oder dem französischen imparfait vergleichen (cf. Lindschouw 2017, 411). Die sprachstrukturelle Nähe als ein wesentliches Kriterium für positiven Transfer ist also gegeben. Nicht jede strukturelle Nähe wird aber vom Lernenden als solche wahrgenommen. Deshalb betonen viele Transfermodelle die Wichtigkeit der vom Lernenden wahrgenommenen strukturellen Nähe (cf. Kellerman 1977). Die Fähigkeit, Sprachen zu vergleichen und strukturelle Ähnlichkeiten wahrzunehmen und gewinnbringend zu nutzen, hängt eng mit dem eingangs dargestellten Konzept des Sprachbewusstseins zusammen.
3 Empirie
3.1 Untersuchungsdesign
Die in diesem Artikel präsentierten Daten sind Teil eines noch nicht publizierten Dissertationsprojekts, das sich mit dem Erwerb des spanischen Tempus- und Aspektsystems im schulischen Fremdsprachenunterricht beschäftigt. Das Untersuchungssetting umfasst die folgenden Aufgabenformate: (1) einen C-Test, um das allgemeine Spanisch-Niveau der Lernenden zu messen, (2) Interpretationsaufgaben (en. sentence interpretation tasks) in Englisch, Französisch und Spanisch (je nach vorliegender Sprachenfolge), (3) das Nacherzählen zweier Bildgeschichten auf Spanisch, (4) eine Reflexionsaufgabe und (5) einen allgemeinen Fragebogen, in dem vor allem sprachenbiographische Daten, aber auch Aspekte wie explizites Regelwissen oder Lernerstrategien erhoben wurden. Im folgenden Beitrag werden wir uns auf die Daten aus der Reflexionsaufgabe konzentrieren und die Ergebnisse mit dem Abschnitt des Fragebogens, in dem das explizite Regelwissen der Lernenden abgefragt wurde, vergleichen.
Um die Reflexionsaufgabe zu verstehen, ist es notwendig, kurz auf die Funktionsweise der spanischen Interpretationsaufgabe einzugehen. Die Lernenden erhielten insgesamt 35 Items, welche jeweils einen deutschen Kontext und zwei spanische Sätze enthielten. Die Schülerinnen und Schüler mussten diese im Hinblick auf ihre grammatikalische Korrektheit auf einer Likert-Skala von -2 bis +2 bewerten (siehe Abbildung 1 und 2).

Abbildung1: Interpretationsaufgabe I

Abbildung 2: Interpretationsaufgabe II
Am Ende der Untersuchung wurden die Lernenden aufgefordert, gemeinsam mit ihrem/ihrer Partner/-in über sechs ausgewählte Sätze aus der spanischen Interpretationsaufgabe zu reflektieren. Der Arbeitsauftrag lautete folgendermaßen:
Denke noch einmal über Deine Ergebnisse bei der Sprachtestung in Spanisch nach und besprich Deine Ergebnisse mit jenen deines Partners. Orientiert Euch an folgenden Fragen: […] 3. Haben Dir andere Sprachen bei Deiner Entscheidung geholfen? Hat Dir vielleicht die Sprache, die Du mit Deiner Familie sprichst, geholfen? Oder vielleicht das Englische, Französische oder das Lateinische? Wenn ja, wie haben sie Dir geholfen?
Die Audiodateien wurden anonymisiert, transkribiert und mithilfe von MAXQDA ausgewertet. Wir folgten dabei den Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (cf. 2016, 88sqq.) und bildeten die folgenden Kategorien induktiv am Material: (1) In die Kategorie konkrete Sprachvergleiche wurden all jene Aussagen eingeordnet, die entweder einen expliziten Vergleich zweier Formen aufwiesen oder die Funktion der entsprechenden Formen miteinander verglichen. (2) Unter Hilfe Sprachvergleich allgemein wurden jene Aussagen kodiert, die keine konkreten Sprachvergleiche beinhalteten, diese aber als grundsätzlich positiv und hilfreich für den Spanischerwerb einstuften. Die Kommentare der Lernenden wurden diesen beiden Kategorien für jede einzelne Sprache, das heißt, Englisch, Französisch und Latein zugeordnet. (3) Unter kein Sprachvergleich ordneten wir alle Aussagen ein, die Sprachvergleiche explizit ablehnten und als nicht hilfreich einstuften. Viele der Lernenden gaben für diese Ablehnung keine Erklärungen an. Wurde ein Grund genannt, so wurde ihm ein eigener Code zugewiesen: (3a) Mangelnde Sprachkompetenz, (3b) strukturelle Unterschiede, (3c) Verwirrung durch Ähnlichkeit, (3d) keine aktiv gelernte Sprache, (3e) keine Übung.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.