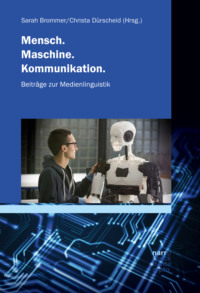Kitabı oku: «Mensch. Maschine. Kommunikation.», sayfa 7
3.2 Auditive Ebene – Vergleich zwischen Sprachnachrichten und Animojis
Was auf der auditiven Ebene geschieht, ist mit einer herkömmlichen SprachnachrichtSprachnachricht vergleichbar, die auch über WhatsAppWhatsApp versendet werden kann. Deshalb beziehen wir uns für die Analyse der lautlichen Ebene auch auf Literatur zu WhatsApp-Sprachnachrichten. Eine aktuelle Publikation zu dieser Thematik stammt von Howind, der durch die Analyse eines Korpus mit 82 Sprachnachrichten zeigt, wann und zu welchem Zweck Sprachnachrichten verwendet werden (Howind 2020). Seine Erkenntnisse können Hinweise auf die Nutzung von Animojis geben. Es handelt sich nämlich bei beiden Phänomenen um nicht simultane, quasi-synchroneKommunikationquasi-synchrone oder asynchrone KommunikationKommunikationasynchrone (siehe Howind 2020: 5 und siehe Tabelle 2). Denn sogar wenn die beiden Kommunikationspartner gleichzeitig online sind, gibt es immer eine Verzögerung, zuerst durch die Aufnahme der Nachricht und anschliessend durch das Abspielen. Auch in diesem Fall ist der kommunikative Austausch also nur quasi-synchronKommunikationquasi-synchrone.
| Gespräch (face-to-face) | Sprachnachricht (z.B. WhatsApp) | Animoji- Aufnahme | Textnachricht (z.B. WhatsApp) | |
| Synchronizität | synchron | quasi-synchron oder asynchron | quasi-synchron oder asynchron | quasi-synchron oder asynchron |
| Visualität | gegeben | nicht gegeben | gegeben | gegeben |
Tab. 2:
Überblick – verschiedene KommunikationsformenKommunikationasynchroneKommunikationsynchroneKommunikationquasi-synchrone
Die Aufnahme hält in beiden Fällen die Charakteristika der Stimme der Sprecher*innen fest (bspw. die dialektale Färbung, Tonhöhe etc.), ebenso para- und nonverbale Merkmale wie Lachen, Räuspern oder auch Denkpausen. Hintergrundgeräusche werden von einer SprachnachrichtSprachnachricht ebenfalls aufgezeichnet, sei dies z.B. Strassenlärm oder Musik (siehe König/Hector 2017: 11). So können durch das Versenden einer Sprachnachricht (und eines AnimojiAnimoji) neben der sprachlichen Information – bewusst oder unbewusst – auch Hinweise auf die Umgebung, in der sich die Senderin oder der Sender befindet, übermittelt werden. Durch den bewussten Einbezug der Hintergrundgeräusche während der Aufnahme einer Sprachnachricht als Teil einer Szenerie kann der Nachricht, so König/Hector (2017), ein theatralischer Effekt verliehen werden. Bei der Aufnahme während eines Konzerts zum Beispiel kann bewusst Raum für die Musik gelassen werden, um dem Empfänger oder der Empfängerin zu zeigen, wo man sich befindet und wie die Stimmung ist.
Sprachnachrichten wie auch AnimojiAnimoji-Aufnahmen können vor dem Versenden angehört und bei Bedarf gelöscht werdenSprachnachrichtNutzer*in.WhatsApp1 Beide Kommunikate können aber immer nur als Ganzes gelöscht werden. Das bedeutet, es ist nicht möglich, wie bei einer geschriebenen Nachricht nur einen Teil zu ändern oder zu entfernen. Ist das Kommunikat einmal versendet, bleibt es, anders als bei einem Telefongespräch, auf dem SmartphoneSmartphone gespeichert. Ausserdem können Animojis, wie auch Sprachnachrichten, nur dann ‹heimlich› rezipiert und aufgenommen werden (König/Hector 2017: 13), wenn man Kopfhörer verwendet. Geschriebene TextnachrichtenTextnachricht hingegen kann man zum Beispiel während einer Sitzung verschicken und lesen, ohne dass dies jemand merkt oder andere Personen durch das Aufnehmen oder Abspielen der Nachricht gestört werden.
3.3 Animojis als audiovisuellesAudiovisualität Phänomen
Wir haben dargelegt, welche Elemente auf der visuellen und auditiven Ebene von Bedeutung sind. Im Folgenden soll erläutert werden, wie sich diese beiden Ebenen beeinflussen. Herring et al. (2020: 2) zeigen anhand ihrer Untersuchungsergebnisse, dass der Einsatz von Animojis als maskenähnliche Ersatzpersonen das Potenzial hat, die Kommunikation und das Sozialverhalten von Personen zu beeinflussen: Diejenigen Personen, die AnimojiAnimoji-Kommunikate produzieren, tun dies, indem sie z.B. ihre normale Sprechstimme durch phonologische und prosodische Modifikationen stilisieren. Zudem verwenden sie Dialekte oder einen theatralischen Sprachstil mit einem Inhalt, der sich oft direkt oder indirekt auf dieses Animoji oder MemojiMemoji bezieht (siehe Herring et al. 2020: 14). Die Animojis (als visuelles Phänomen) haben also auf den Sprachgebrauch (als auditives Phänomen) einen Einfluss: Je nachdem, welches Animoji verwendet wird, können auf gesprochen-sprachlicher Ebene unterschiedliche dialektale oder stilistische Variationen auftreten. Animojis stellen damit einen Teil eines umfassenderen Paradigmenwechsels von statischen Mitteln der digitalen Selbstdarstellung (wie SelfiesSelfie und Bitmoji-Sticker) hin zu dynamischeren und interaktiven Avataren dar, durch die zunehmend mittels gesprochener Sprache kommuniziert wird (siehe Herring et al. 2020: 15). Diese Tendenz – vom Statischen hin zum Dynamischen – scheint der Mündlichkeit als dynamischem Element in der digitalen KommunikationKommunikationdigitale mehr Bedeutung zu geben. Angesichts der Überlegung, wie Visuelles und Auditives zusammenhängen, stellt sich die Frage, ob sich die Art zu kommunizieren in eine Richtung bewegt, die erneut die Mündlichkeit priorisiert, nachdem SmartphonesSmartphone und ComputerComputer mit TextnachrichtenTextnachricht und E-MailE-Mails die mündliche Kommunikation lange Zeit in den Hintergrund rückten. Die zunehmende Verwendung der SprachsteuerungSprachsteuerung (an Stelle des Touchscreens) wäre bspw. ein Indiz dafür, dass Visuelles an Bedeutung verlieren und Auditives an Bedeutung gewinnen wird (siehe Schuppisser 2019).
3.4 Pragmatische Ebene – Vor- und Nachteile der Verwendung von Animojis
Animojis sind in der Geschichte der Kommunikation ein junges Phänomen. Sie können als eine Art spielerisch-vermittelte Selbstdarstellung im Bereich der Mensch-Mensch-Kommunikation via MaschineMaschine beschrieben werden. Obwohl Animojis seit 2017 nutzbar sind, ist ihre Verwendung im deutschsprachigen Raum nur spärlich verbreitet. Das liegt zu einem beachtlichen Teil daran, dass Animojis auf WhatsAppWhatsApp – der meistverwendeten digitalen KommunikationsformKommunikationdigitale in Europa – nicht verfügbar sind. Ausserdem muss beim Aufnahmeprozess eines AnimojiAnimoji-Kommunikats mehr Aufwand betrieben werden, als dies bei einer (herkömmlichen) SprachnachrichtSprachnachricht oder bei der Verwendung von Emojis in TextnachrichtenTextnachricht der Fall ist. Im Unterschied zu Animojis haben die auditiven Sprachnachrichten den Vorteil, dass die Sprecher*innen dafür ihren Blick nicht (oder nur zu Beginn) auf den Bildschirm richten müssen. Die visuelle Ebene fällt weg und das hat den praktischen Vorteil, dass man sich während der Aufnahme noch auf etwas Anderes konzentrieren kann. Dieser Vorzug geht bei der Aufnahme eines Animoji-Kommunikats verloren, da es notwendig ist, dass die Sender*innen das HandySmartphone während der gesamten Aufnahmezeit vor Augen haben bzw. die Kamera auf das Gesicht gerichtet ist. Die Bequemlichkeit in der Bedienung ist bei Howind das Hauptargument für die Nutzung von Sprachnachrichten (siehe Howind 2020: 34).
Die Kommunikation mittels Animojis ist zwar mindestens so effektiv wie, aber weniger effizient als die Verwendung von Sprachnachrichten. Das Mehr an vermittelter Information durch die zusätzliche animierte Mimik ist verhältnismässig gering. Denn bei Sprachnachrichten wird ein Teil der vermittelten Emotionen bereits durch die Stimmfärbung oder sonstige Stilisierung von gesprochener Sprache kommuniziert. Wenn dann ein Aspekt – zum Beispiel die Emotionalität einer Nachricht – verstärkt werden soll, kann das immer noch durch das Versenden eines passenden (lachenden oder weinenden) EmojiEmoji in der nächsten Nachricht geschehen.
4 Résumé: Animojis als Phänomen zwischen Kommunikation und PerformancePerformance
Wie bereits erwähnt, unterscheiden sich AnimojiAnimoji-Aufnahmen und Sprachnachrichten auf der auditiven Ebene nicht sehr. Der Unterschied liegt in der animierten Darstellung von dynamischen Gesichtszügen. Auch wenn auf visueller Ebene nicht viel zusätzliche Information vermittelt wird, wirkt das Animoji auf pragmatischer Ebene als Selbstdarstellungsversuch. Deshalb sind Animojis weniger geeignet, wenn es darum geht, ‹nur› Informationen zu vermitteln. Vielmehr ist davon auszugehen, dass Animojis eher als Spielerei verwendet werden, bei der zwei gut etablierte und häufig genutzte Phänomene – Sprachnachrichten und Emojis – zu einer neuer Kommunikationspraxis zusammengeführt werden. Die Vermittlung von Information steht im Hintergrund, vielmehr geht es um die Inszenierung der Nachricht bzw. des Senders, der Senderin. So kann zum Beispiel durch die Nutzung von Animoijs bei einer freudigen Nachricht das Aussergewöhnliche des Inhalts betont werden. In gewisser Weise kann die Verwendung von Animojis als ‹Spektakel› bezeichnet werden (siehe Androutsopoulos 2010: 430). Denn immer wenn Animojis verwendet werden, schwingt ein Aspekt der Unterhaltung mit.
Doch auch wenn Animojis im Vergleich zu Sprach- und TextnachrichtenTextnachricht bislang nur selten gebraucht werden, ist das Phänomen aus folgenden Gründen auch für die Linguistik interessant: Erstens handelt es sich bei Animojis um eine Form der Kommunikation, die die auditive Ebene mit der visuellen Ebene verbindet. Somit können gesprochene Sprache und bildbasierte Kommunikate isoliert voneinander und in ihrer Wechselwirkung untersucht werden. Zweitens erlaubt die AnimationAnimation der eigenen Gesichtszüge den NutzerNutzer*in*innen, mit geringem Aufwand in andere Rollen – und damit auch in eine andere sprachliche Rolle – zu schlüpfen. Diese Art von Inszenierung der Sprache, aber auch der eigenen Person kann in der weiteren Forschung mit dem Einsatz von Avataren in Online-Spielen oder Chatforen verglichen werden. Die Tatsache, dass bei Animojis dem AvatarAvatar die eigene Stimme und im Fall von Memojis die eigenen Gesichtszüge verliehen werden, lässt die Grenzen zwischen Avatar und der dahinter stehenden Person verschwimmen. Der Einfluss dieses Rollenspiels – ob im analogen oder digitalen Kontext – auf den Sprachgebrauch kann für weitere Forschung sehr interessant sein. In jedem Fall haben digitale, visuelle AnimationenAnimation einen Einfluss auf die Art und Weise, wie analoge gesprochene Sprache stilisiert wird. Ausserdem erfährt die mündliche Kommunikation ohnehin durch Sprachnachrichten und die SprachsteuerungSprachsteuerung wieder grössere Aufmerksamkeit, so dass mit weiteren Neuerungen und Modifikationen im Stil von Animojis gerechnet werden kann. Damit sich die dynamisch-visuelle Ebene als Ergänzung zur häufig genutzten SprachnachrichtSprachnachricht aber grossflächig durchsetzen kann, müsste die Verwendung den Nutzer*innen einen Mehrwert bieten, der über den spielerischen Effekt hinausgeht. Erst wenn der Gewinn an vermittelbarer Informationsmenge den umständlicheren Aufnahmeprozess ausgleichen kann, erhöht sich die Attraktivität der Nutzung eines solchen Produktes.
Halten wir fest: Animojis stellen eine neue, spielerische Kommunikationspraxis dar, die in der Forschung mehr Aufmerksamkeit verdient. Dabei ist es wichtig zu bedenken, dass Animojis mit den von ihnen produzierten Kommunikaten gleichzeitig Informationen preisgeben und verbergen. Das bedeutet, dass man sich durch die Verwendung von Animojis – im Gegensatz zu Sprachnachrichten – zwar auf der visuellen Ebene der herkömmlichen Kommunikation annähert. Gleichzeitig distanziert man sich aber auch von der Realität, da durch das animierte EmojiEmoji oder das MemojiMemoji die Person der Sender*innen verfremdet wird. Besonders interessant wäre es daher zu untersuchen, wie mit Animojis gleichzeitig Informationen preisgegeben und verborgen werden.
Bibliographie
Androutsopoulos, Jannis (2010). Multimodal – intertextuell – heteroglossisch: Sprach-Gestalten in «Web 2.0»-Umgebungen. In: Deppermann, Arnulf/Linke, Angelika (Hrsg.). Sprache intermedial. Stimme und Schrift, Bild und Ton. Berlin/New York: De Gruyter, 419–445.
Bakhtin, Mikhail (1986). Speech genres and other late essays. Austin: University of Texas Press.
Browne, Simone (2015). Dark matters: On the surveillance of blackness. Durham: Duke University Press.
Dürscheid, Christa/Siever, Christina Margrit (2017). Jenseits des Alphabets – Kommunikation mit Emojis. Zeitschrift für germanistische Linguistik, 45:2, 256–285.
Dürscheid, Christa/Frick, Karina (2014). Keyboard-to-Screen-Kommunikation gestern und heute: SMS und WhatsApp im Vergleich. In: Mathias, Alexa et al. (Hrsg.). Sprachen? Vielfalt! Sprache und Kommunikation in der Gesellschaft und den Medien. Eine Online-Festschrift zum Jubiläum von Peter Schlobinski. Hannover: Networx 64, 149–181. Abrufbar unter: https://www.mediensprache.net/de/networx/docs/networx-64.aspx (Stand: 30.12.2020)
Elder, Alexis (2018). What words can’t say. Emoji and other non-verbal elements of technologically-mediated communication. Journal of Information, Communication and Ethics in Society, 16:1, 2–15.
Gkoni, Nefeli (2017). «One More Thing … » – A critical approach to the Apple 2017 Keynote Presentation. In: Masters of Media. Abrufbar unter: https://mastersofmedia.hum.uva.nl/blog/2017/09/25/one-more-thing-a-critical-approach-to-the-apple-2017-keynote-presentation/ (Stand: 30.12.2020)
Howind, Felix (2020). Die Verwendung von Sprachnachrichten in WhatsApp-Kommunikation. Networx 89. Abrufbar unter: http://www.mediensprache.net/networx/networx-89.pdf (Stand: 30.12.2020)
König, Katharina/Hector, Tim Moritz (2017). Zur Theatralität von WhatsApp-Sprachnachrichten. Nutzungskontexte von Audio-Postings in der mobilen Messenger-Kommunikation. Networx 79. Abrufbar unter: https://www.mediensprache.net/de/networx/docs/networx-79.aspx (Stand: 30.12.2020)
Herring, Susan et al. (2020). Animoji performances: «Cuz I can be a sexy poop.» Language@Internet 18, article (1). Abrufbar unter: https://info.sice.indiana.edu/~herring/pubs.html (Stand: 30.12.2020)
Herring, Susan/Martinson, Anna (2004). Assessing gender authenticity in computer-mediated language use: Evidence from an identity game. Journal of Language and Social Psychology, 23:4, 424–446. Abrufbar unter: https://info.sice.indiana.edu/~herring/pubs.html (Stand: 30.12.2020)
Holly, Werner (2011). Medien, Kommunikationsformen, Textsortenfamilien. In: Habscheid, Stephan (Hrsg.). Textsorten, Handlungsmuster, Oberflächen: Linguistische Typologien der Kommunikation. Berlin/New York: De Gruyter, 144–163.
McRae, Shannon (1996). Coming apart at the seams: Sex, text and the virtual body. In: Cherny, Lynn/Weise, Elizabetha (Hrsg.). Wired_Women. Seattle: Seal Press, 242–263.
Österle, Hubert (2020). Life engineering: machine intelligence and quality of life. Cham: Springer.
Schenk, Joachim/Rigoli, Gerhard (2010). Mensch-Maschine-Kommunikation. Grundlagen von sprach- und bildbasierten Benutzerschnittstellen. Berlin/Heidelberg: Springer.
Schuppisser, Raffael (2019). Das Jahrzehnt der Stimme bricht an: Mithilfe von Technologie ersetzt Sprechen zunehmend das Schreiben. Tagblatt. Abrufbar unter: https://www.tagblatt.ch/leben/das-jahrzehnt-der-stimme-bricht-an-mithilfe-von-technologie-ersetzt-sprechen-zunehmend-das-schreiben-ld.1177466 (Stand: 30.12.2020)
Stöckl, Hartmut (2011). Sprache-Bild-Texte lesen. Bausteine zur Methodik einer Grundkompetenz. In: Diekmannshenke, Hajo/Klemm, Michael/Stöckl, Hartmut (Hrsg.). Bildlinguistik. Theorie – Methode – Fallbeispiele. Berlin: Erich Schmidt, 45–70.
Silvio, Terry (2010). Animation: The new performance? Journal of Linguistic Anthropology, 20:2, 422–438.
Stark, Luke (2018). Facial recognition, emotion and race in animated social media. First Monday. Abrufbar unter: https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/9406 (Stand: 30.12.2020)
Die weinende, virtuellevirtuell Influencerin
Das Internetphänomen «Lil Miquela»
Mia Jenni
1 Vorbemerkungen
In selfiesSelfie, you can see the freckles on Miquela’s face; her gap-toothed smile. But up close, her brown hair, often pulled up into Princess Leia-esque buns, looks airbrushed (TwitterTwitter users have noted that her flyaway frizz always falls in the same pattern.) Her skin reads as smooth as the glass screen that separates us [Leser*innen des Textes und dessen Autorin, MJ]. And when you peer into Miquela’s big brown eyes, she fails the ultimate test of humanity. (Petrarca 2018)
Mit diesen Worten beschreibt Emilia Petrarca die InfluencerinInfluencer*in Miquela Sousa, besser bekannt unter dem Namen «Lil Miquela» (siehe Petrarca 2018). Mit 2,4 Millionen FollowerFollower*in*innen auf InstagramInstagram (siehe Instagram 2020a) und 191000 Abonnent*innen auf der Videoplattform Youtube (siehe Youtube 2020) erreicht sie mit ihren Einträgen in den Sozialen MedienMedium/Medien eine beachtliche Anzahl an Menschen. Anders jedoch als bei vielen anderen Influencer*innen auf InstagramInstagram, FacebookFacebook, Youtube oder TikTok handelt es sich bei Lil Miquela nicht um eine reale Person; es ist ein Internetphänomen. Sie selbst bezeichnet sich als «change-seeking bot» (Instagram 2020). Realität und Wahrnehmung spalten sich hier auf, was auch die etwas unheimlich anmutende Beschreibung von Lil Miquela zu Beginn dieses Beitrags erklärt. Was Petrarca beim Betrachten der Bilder der Influencerin erlebt, nennt man den ‹uncanny valleyUncanny Valley effect› (siehe dazu auch die Beiträge von Knoepfli und Staubli i.d.B.).Uncanny ValleyVertrauenantropomorphmenschenähnlichvertrauenswürdigRoboterMaschine1 Für Petrarca stellt es eine Herausforderung dar, festzustellen, ob Lil Miquela menschlich ist und welche Faktoren sie so anthropomorphantropomorph machen. Damit steht Petrarca nicht alleine da. Eingangs des Artikels fragt eine (echte) junge InfluencerinInfluencer*in bei ihr nach: «She’s not real, right?» (Petrarca 2018).
Andere Twitteruser*innen spekulieren über Lil Miquelas Haare, um ihre Echtheit in Frage zu stellen, und hinterlassen suggestive Kommentare wie «Yes she’s real, she’s a student in visual arts and such so she works on her pictures she takes of herself». Immer wieder geben sie ihre Irritierung kund: «You are so fucking irrelevant. If it weren’t for Shane Dawson [ein bekannter, dokumentierender Youtuber, MJ] you wouldn’t be this popular and nobody would care about your fake ass. […]» oder simpler «God wtf are you real?» (Petrarca 2018). Das sind Spekulationen, die erstaunen, bestätigt Lil Miquela doch selbst immer wieder, kein Mensch zu sein. Anscheinend gilt ihr Wort weniger als die Wahrnehmung der FollowerFollower*in*innen. Ein Sachverhalt, der irritiert und folgende Fragen aufwirft: 1) Welche Faktoren führen dazu, dass Lil Miquela als menschlich wahrgenommen wird? 2) In welcher Beziehung steht dies zur Repräsentation von menschlichen Influencer*innenInfluencer*in in Sozialen MedienMedium/Medien? Denn selbst wenn Lil Miquela explizit schreibt, sie sei künstlicher Natur, so sind ihre Beiträge kaum von der Kommunikation anderer Influencer*innenInfluencer*in zu unterscheiden. Es scheint folglich, als enthalten die Äusserungen und Publikationen Lil Miquelas gewisse Stilmittel, die sie als ‹natürlich› wahrnehmbar machen. Im Folgenden wird versucht, diese Mittel auf der Basis einer semiotischen und multimedialen Analyse zu fassen. Dabei beschränkt sich die Untersuchung auf die Plattform InstagramInstagram, auf welche kurz eingegangen wird. Grundlage der Analyse bilden vier Instagramposts Lil Miquelas, die sie zwischen September 2019 und Juni 2020 veröffentlichte. Es werden sowohl der schriftliche wie auch der bildliche Teil der Posts analysiert, akustische Elemente bleiben ausgeklammert.Influencer*in2
Im nächsten Abschnitt werden zunächst einige Hintergrundinformationen zur Plattform InstagramInstagram sowie dem Terminus «Influencer*innen» gegeben (Kap. 2). Ebenfalls wird in diesem Kapitel das Phänomen der künstlichen Influencer*innenInfluencer*in genauer beschrieben. Des Weiteren werden Lil Miquela sowie ihre Erschaffer*innen beleuchtet. Die darauffolgende semiotische Analyse (Kap. 3) basiert auf den Forschungsansätzen von Hartmut Stöckl und Winfried Nöth. Zuletzt folgt ein Fazit, das die Erkenntnisse in einem grösseren gesellschaftstheoretischen Kontext zu verankern versucht.