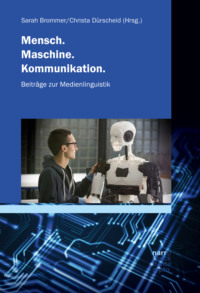Kitabı oku: «Mensch. Maschine. Kommunikation.», sayfa 9
4 Fazit
Eingangs wurde das unheimliche Gefühl thematisiert, welches sich bei einigen Betrachter*innen einstellt, wenn sie durch den InstagramfeedInstagram der InfluencerinInfluencer*in Lil Miquela scrollen. Dieses Gefühl wird durch das Unvermögen, Menschliches und Künstliches klar voneinander abgrenzen zu können, ausgelöst. Dagegen nützt selbst die Eigenaussage der InfluencerinInfluencer*in, keine reale Person zu sein, nichts. Es gibt viele Fans, die sich sowohl für ihre Musik als auch für ihren Lebensstil begeistern können und von Lil Miquela beeinflusst werden.
Die Analyse hat gezeigt, dass die Firma brud sich gleich mehrerer Stilmittel bedient, um Lil Miquela als InfluencerinInfluencer*in zu etablieren. Einerseits wird Lil Miquela in den Posts als junge, reflektierende Frau dargestellt, die versucht, als Sängerin in der Musikwelt Fuss zu fassen, und die sich gerne mit Freund*innen trifft. Dabei entfalten sich immer wieder Dramen, neue Liebschaften entstehen, Gefühle werden inszeniert. All dies wirkt echt. Doch andererseits, im Gegensatz zu realen Influencer*innen, existiert Lil Miquela nur im virtuellenvirtuell Raum. Alle ihre Lebensereignisse müssen auch da abgebildet werden, sonst geschehen sie nicht. Können Menschen die Hochs und Tiefs des eigenen Soziallebens von den Sozialen MedienMedium/Medien fernhalten, so muss Lil Miquela sie auf diesen Plattformen erleben. Die virtuellevirtuell InfluencerinInfluencer*in ist damit eine Garantie für Melodramatisches, ihre Posts wirken fast wie eine Soap Opera in InstagramformInstagram. Dies bindet FollowerFollower*in*innen, die dann zugleich auch zu Konsument*innen des Spektakels werden.
Interessant wird die Figur Lil Miquela zudem durch die ausgeklügelte Selbstreflexion und Offenlegung der eigenen Künstlichkeit. Dadurch nimmt sie erstens allen Kritiker*innen den Wind aus den Segeln und zweitens wird jeder Post so zu einem Kommentar über die Social-Media-Plattform InstagramInstagram selbst. Weint man, muss man möglichst fotogen die Tränen inszenieren. Ist man gerade von seinem Outfit begeistert, dann postet man ein SpiegelselfieSelfie, natürlich in perfekter Pose. Sucht man den Rat der FollowerFollower*in*innen, dann inszeniert man sich als junge, teilweise ratlose Person. Lil Miquela macht die Performanz oder, nach Guy Debord, das Spektakel auf InstagramInstagram offensichtlich. Es werden nur Teile der Wirklichkeit abgebildet, eine Pseudowelt wird erschaffen (siehe Debord 1992: 15). Dies geschieht implizit auch bei allen anderen Influencer*innenInfluencer*in. Und genau darauf spielt das Unternehmen brud an, wenn es behauptet, Rihanna sei nicht realer als Lil Miquela. Die Künstlichkeit aller Profile scheint der jungen (realen) Influencerin, die Petrarca nach der Echtheit Lil Miquelas fragt, bewusst zu sein. Es bereitet ihr Schwierigkeiten, die Künstlichkeit Lil Miquelas zu definieren, weil sie bei sich selber scheitert, das Reale in ihrem InstagramfeedInstagram festzustellen.
Anschliessend an diese Überlegungen zur virtuellenvirtuell InfluencerinInfluencer*in Lil Miquela ergeben sich weitere Fragestellungen. Einerseits sollte neben InstagramInstagram auch die SelbstinszenierungSelbstinszenierung von Influencer*innen auf anderen Plattformen erforscht werden. Des Weiteren könnte man der Frage nachgehen, wie Influencer*innen die NutzerNutzer*in*innen der Sozialen Netzwerkesoziales Netzwerk in ihren Ausdrucksweisen beeinflussen (und vice versa). Interessant wäre es auch, die Parallelen und Differenzen von analogem und digitalem Marketing zu untersuchen, um der ökonomisch momentan stark wachsenden Macht der Influencer*innenInfluencer*in Rechnung zu tragen.
Bibliographie
Billboard (2019). Is Miley Cyrus’ ‹Black Mirror› song ‹On a Roll› going to end up her biggest new hit? Abrufbar unter: https://www.billboard.com/articles/columns/pop/8518583/miley-cyrus-ashley-o-on-a-roll-success-black-mirror (Stand: 22.12.2020)
Brud. Homepage. Abrufbar unter: http://brud.fyi/ (Stand: 22.12.2020)
Cheetham, Marcus (2014). The Uncanny Valley Hypothesis: behavioural, eye-movement, and functional MRI findings. Zürich: Hochschulschrift.
Clement, Tobias (o.J.). Influencer. Abrufbar unter: https://www.advidera.com/glossar/influencer/ (Stand: 22.12.2020)
Debord, Guy (1992). La Société du Spectacle. Paris: Éditions Gallimard.
Eror, Aleks (2018). Meet Lil Miquela, the AI Influencer on the Cover of Our New Print Issue. Abrufbar unter: https://www.highsnobiety.com/p/lil-miquela-cover-story-issue-16/ (Stand: 22.12.2020)
Hibberd, James (2019). Black Mirror producers on that Miley Cyrus episode and a creepy pop star trend. Abrufbar unter: https://ew.com/tv/2019/06/05/black-mirror-miley-cyrus-episode-interview/ (Stand: 22.12.2020)
Instagram (2020a). Followeranzahl Lil Miquela. Abrufbar unter: https://www.instagram.com/lilmiquela/ (Stand: 25.06.2020).
Instagram (2020b). Followeranzahl Bibis Beautypalace. Abrufbar unter: https://www.instagram.com/bibisbeautypalace/ (Stand: 25.06.2020)
Instagram (2020c). Nutzer*innenanzahl insgesamt. Abrufbar unter: https://about.instagram.com/blog/Instagram/ (Stand: 27.06.2020)
Instagram (2020d). Anzahl Hashtag ‹cosplay›. Abrufbar unter: https://www.instagram.com/ (Stand: 30.09.2020)
LeDonne, Rob (2018). How Ariana Grandes Sweetener came together. Abrufbar unter: https://www.vulture.com/2018/08/how-ariana-grandes-sweetener-came-together.html (Stand: 22.12.2020)
Miquela. Homepage. Abrufbar unter: https://www.miquela.fyi/ (Stand: 25.06.2020).
Nöth, Winfried (2009). Bildsemiotik. In: Sachs-Hombach, Klaus (Hrsg.): Bildtheorien. Anthropologische und kulturelle Grundlagen des Visualistic Turn. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch, 235–255.
Nöth, Winfried (2016). Ikon, Index und Symbol, visuell und verbal. In: Klug, Nina-Maria/Stöckl, Hartmut (Hrsg.): Handbuch Sprache im multimodalen Kontext. Handbücher Sprachwissen (HSW 7). Berlin, New York: De Gruyter Mouton, 196–216.
Petrarca, Emilia (2018). Body Con Job. Miquela Sousa has over 1 million followers on Instagram and was recently hacked by a Trump troll. But she isn’t real. Abrufbar unter: https://www.thecut.com/2018/05/lil-miquela-digital-avatar-instagram-influencer.html (Stand: 22.12.2020)
Schär, Hannah (2018). Studie. So viel verdienen Influencer wirklich mit einem einzigen Post. Abrufbar unter: https://www.businessinsider.de/karriere/arbeitsleben/studie-so-ticken-influencer-2018–1/ (Stand: 22.12.2020)
Schwartz, A. Brad (2015). The Infamous «War of the Worlds» Radio Broadcast Was a Magnificent Fluke. Abrufbar unter: https://www.smithsonianmag.com/history/infamous-war-worlds-radio-broadcast-was-magnificent-fluke-180955180/?no-ist (Stand: 22.12.2020)
Shieber, Jonathan (2018). The makers of the virtual influencer, Lil Miquela, snag real money from the Silicon Valley. Abrufbar unter: https://tcrn.ch/38snk2M (Stand: 22.12.2020)
Stadler, Moritz (2016). Essen! Inspiration! Ich! – Instagram-Hashtags: Das kleine Lexikon. Abrufbar unter: https://www.spiegel.de/netzwelt/web/instagram-hashtags-das-kleine-lexikon-a-1078620.html (Stand: 22.12.2020)
Stöckl, Hartmut (2016). Multimodalität – Semiotische und textlinguistische Grundlagen. In: Klug, Nina- Maria/Stöckl, Hartmut (Hrsg.): Handbuch Sprache im multimodalen Kontext. Handbücher Sprachwissen (HSW 7). Berlin, New York: De Gruyter Mouton, 3–35.
Youtube (2020). Anzahl Follower Lil Miquela. Abrufbar unter: https://www.youtube.com/channel/UCWeHb_SrtJbrT8VD-_QQpRA (Stand: 25.06.2020)
‹Neuer Partner› in den Warenkorb hinzufügen?
Zu den Veränderungen des Online-DatingsDating von ParshipParship über TinderTinder bis zum künstlichen Partner
Florina Zülli
1 Einleitung
Die Digitalisierung hält in allen Bereichen des Lebens Einzug; sie verändert nicht nur den öffentlichen und ökonomischen Teil des Lebens, sondern auch den privaten. Auch der Dating-Prozess ist seit den Neunzigerjahren immer mehr digitalisiert worden (vgl. Aretz et al. 2017: 7); inzwischen gibt es allein im deutschsprachigen Internet über 2500 Dating-PortalDatinge, die zusammen über 100 Millionen Mitglieder verzeichnen (vgl. Moucha et al. 2016: 7f.). Diese enorme Anzahl erklärt, weswegen sich heute bis zu einem Drittel aller Paare über das Internet kennenlernt (vgl. Cacioppo et al. 2013: 10135).
Im Folgenden soll aufgezeigt werden, wie sich das Online-DatingDating, dessen Ablauf und dessen NutzerNutzer*in1 seit Beginn des digitalen Flirtens um 1995 verändert haben (vgl. Finkel et al. 2012: 10). Mit ‹Online-DatingDating› wird hier die Art des Datings verstanden, die nicht face-to-faceFace-to-Face-Gespräch stattfindet. Vielmehr ist damit eine face-to-surface oder gar face-to-interface InteraktionInteraktion gemeint, in der die Kommunikation über ein MediumMedium/Medien, etwa eine Webseite oder eine AppApp, den direkten, mündlichen Austausch mit dem Gegenüber ersetzt. Die drei grossen Meilensteine des Online-Datings lassen sich chronologisch einteilen in 1.) das Flirten in Online-Singlebörsen (wie ParshipParship), 2.) das Flirten in Apps (wie TinderTinder) und 3.) das Flirten mit einem künstlichen Partner (wie Azuma Hikari). Diese letzte Form des Datings könnte bereits als ‹Online-DatingDating 2.0› oder eine völlig andere, neue Art des Datings bezeichnet werden, da die Substitution eines menschlichen Partners durch eine auf KI basierende MaschineMaschine eine Entwicklung ist, die den ganzen Prozess von Grund auf verändert. Bei den beiden ersten Dating-Arten – das Flirten in Singlebörsen und das Flirten in Apps – wird das Augenmerk auf die Frage gerichtet, ob sich pauschale Merkmale in der Online-Flirt-Interaktion erkennen lassen, welche übergreifend bei beiden Kategorien auftreten. Dazu werden die Nutzer, die Abläufe der Dating-Prozesse und die schriftlichen Interaktionen auf diesen Dating-PortalDatingen analysiert und abschliessend miteinander verglichen. Ziel der Arbeit ist es, auf diese Weise die kontinuierliche Weiterentwicklung des Online-Datings zu reflektieren und einen Ausblick auf künftige Möglichkeiten in diesem Bereich zu geben.
2 Das Flirten in Singlebörsen
2.1 Übersicht
Die ersten digitalen Dating-PortalDatinge bzw. Singlebörsen entstanden Mitte der Neunzigerjahre und ähnelten in Aufbau und Beschaffenheit ihrem analogen Vorgänger: den Kontaktanzeigen in Zeitungen (vgl. Aretz 2017: 7). Der Suchende ‹inseriert› durch die Erstellung eines eigenen Profils und kann seinerseits selbst auf andere, bereits inserierte Profile zugreifen. Entscheidend bei dieser ersten Form der Online-Dating-Portale ist, dass die Herstellung des Erstkontakts eine aktive Handlung seitens eines oder beider (potenzieller) Gesprächspartner erfordert. Im Gegensatz dazu basieren die späteren, im Jahre 2000 aufkommenden Dating-PortaleDating auf einem «Online-MatchingMatching-System» (Aretz 2017: 7): Dieses führt Mitglieder mit ähnlichen Persönlichkeiten ohne Zutun der einzelnen Personen zusammen.
Der Ablauf bei einer SinglebörseSinglebörse mit Online-MatchingMatching-System sieht dabei wie folgt aus: Die Persönlichkeit eines Mitglieds wird in einem eigens dafür von der Webseite konzipierten Fragebogen eruiert. Danach sucht das System selbständig in seinem Mitglieder-Katalog nach kompatiblen Partner*innen, welche es dem neuen Mitglied als Vorschläge anzeigt. Dieser Ansatz des Systems, eigenständig zu agieren und Mitglieder zusammenzuführen, bildet den grössten Unterschied zwischen den verschiedenen Online-Dating-PortalDatingen – und teilt sie in zwei Gruppen: diejenigen mit Matching-System und jene ohne. Natürlich gibt es diverse andere Möglichkeiten, Singlebörsen zu klassifizieren (bezahlte/unbezahlte Mitgliedschaft, heterosexuell/homosexuell etc.), siehe für eine Auflistung dazu Skopek 2012: 32; Wiechers et al. 2015: 7; Zillmann 2016: 61. Jedoch ist die Unterteilung in Singlebörsen mit Matching-System und solchen ohne die zentrale Unterscheidung, welche auch sprachlich differenziert wird: So werden Singlebörsen mit Matching-SystemMatching ‹(Online-)Partnervermittlungen› und solche ohne als ‹(Online-) Kontaktanzeigen› bezeichnet (vgl. Aretz et al. 2017: 9).
2.2 Wer sind die NutzerNutzer*in solcher Plattformen?
Die NutzerNutzer*in von Online-Dating-PortalDatingen lassen sich auf den ersten Blick schwer als ein homogenes Klientel verstehen; vielmehr handelt es sich dabei um einen aus allen soziokulturellen Schichten stammenden und mit unterschiedlichen Bedürfnissen versehener Mix. Dieser Diversität entsprechen auch die zahlreichen, unterschiedlichen Online-Dating-Portale: So gibt es Plattformen für Singles, aber auch Seiten speziell für Verheiratete, die nach einer Kontaktmöglichkeit für einen Seitensprung suchen,1 sowie z.B. Swinger-Seiten, in denen Pärchen nach Gleichgesinnten suchen. Analog dazu gibt es Webseiten für nahezu jede sexuelle Präferenz und jedes Alter. Die meisten Webseiten bieten jedoch im Prinzip das Gleiche an: Freundschaft, Flirt, Sex und Partnerschaft(en). Die Antwort auf die Frage nach dem ‹typischen Nutzer› ist daher stark vom Kontext der Webseite abhängig, auf der dieser Nutzer verkehrt. Der typische Nutzer einer Seite für ältere Homosexuelle wird sich z.B. deutlich vom typischen Nutzer einer kommerzielleren Seite wie ParshipParship unterscheiden. Heteronormativ betrachtet, ist der durchschnittliche Online-Dater jedoch 30 Jahre alt, männlich und lebt in einer urbanen Gegend (vgl. Schulz et al. 2008: 284–286).
2.3 Ablauf beim Online-DatingDating auf Singlebörsen
Der Ablauf beim Online-Dating auf Singlebörsen lässt sich grob in vier bzw. fünf Schritte unterteilen (vgl. Finkel et al. 2012: 14):

Abb. 1: Ablauf beim Online-Dating auf Singlebörsen
Das bedeutet, dass sich der User zunächst Gedanken machen muss, auf welcher Plattform er sich anmelden möchte bzw. was für einen Partner (bspw. homosexuell, Akademiker etc.) und welche Art der Beziehung er sich wünscht (bspw. feste Beziehung, Seitensprung etc.). Entsprechend dieser Vorliebe wählt er dann die geeignete Plattform (bspw. Grindr, ElitePartner, unserkleinesgeheimnis). Nach der Erstellung seines eigenen Profils und erfolgreicher Suche wird der Kontakt von einer Seite initiiert, bspw. durch das Kommentieren eines Fotos, dem Versenden eines ‹Zwinkerns›1 oder einer anderen Art von Interessensbekundung. Ist das Interesse dabei gegenseitiger Natur, kommt es zum Gespräch: Meistens stellt die Plattform dafür eine Chat-Funktion zur Verfügung, die es erlaubt, Nachrichten und Bilder auszutauschen. Das Flirten auf der SinglebörseSinglebörse endet, wenn zu einer anderen Kommunikationsform gewechselt wird, wie WhatsAppWhatsApp, Telefon oder dem persönlichen Gespräch bei einem Offline-Date.
2.4 InteraktionInteraktion beim Online-DatingDating auf Singlebörsen
Da nonverbale Kommunikation wie Mimik und Gestik (Anlächeln, Augenaufschlag etc.), sowie olfaktorische Reize (Pheromone, Parfüm etc.) und weitere Hilfsmittel des Offline-Flirtens (wie Berührungen des Gegenübers) beim Online-DatingDating gänzlich wegfallen, kommt der Schrift eine grössere Bedeutung zu: Sie ist das massgebende Kommunikationsmittel für das Online-Dating auf Singlebörsen (vgl. Dürscheid 2017: 50).Parship1
Im Folgenden wird die SinglebörseSinglebörse ParshipParship hinzugezogen, um generelle Aussagen über Online-Dating-PortalDatinge beispielhaft zu illustrieren; diese Beispiele erheben jedoch nicht den Anspruch dabei pars-pro-toto für alle Singlebörsen stehen zu wollen. Gewählt wurde Parship, da diese Singlebörse zusammen mit ElitePartner zu den umsatzstärksten deutschen Dating-Portalen gehört und zu Parship bereits linguistische Untersuchungen vorliegen (siehe dazu Dürscheid 2017). Ein Grund, weswegen Parship so viele NutzerNutzer*in hat, ist, dass es sich an keine spezifische Gruppe wendet (siehe oben), sondern lediglich an «seriöse Singles» (Dürscheid 2017: 51). Diese seriösen Singles haben auf Parship die Möglichkeit, ihr Profil semi-individuell zu gestalten, indem sie vorformulierte Fragen beantworten können (‹Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?›), welche dann auf ihrem Profil erscheinen. Als eines der auffallenden charakteristischen Sprachspezifika nennt Dürscheid die auf Parship vorherrschende Verwendung des ‹Du› anstelle der Höflichkeitsform (vgl. Dürscheid 2017: 56). So lautet die Antwort auf obige Frage beispielsweise: ‹Ein Buch, meine Katze und dich :)›. Die zweite Person Singular wird dabei nicht nur in den einseitig von einem User formulierten Texten, sondern auch in den zwischen zwei Usern ausgetauschten Nachrichten verwendet (vgl. Dürscheid 2017: 55). Diese Verwendung des ‹Du› anstelle des ‹Sie› geschieht dabei nicht zufällig, sondern kann durchaus als Strategie gewertet werden. Denn durch die konsequente Verwendung des ‹Du› wird sprachlich eine Vertrautheit und Nähe inszeniert – auch wenn diese zum gegebenen Zeitpunkt noch gar nicht vorhanden ist. Androutsopoulos nennt dies eine «strategische Sprachgestaltung» (Androutsopoulos 2007: 80), welche es vermag, eine Situation der räumlichen und zumindest anfänglich auch sozialen Distanz (wie es bei der Online-Kommunikation der Fall ist) durch inszenierte Vertrautheit mit Nähe aufzuladen.
Dieses Vorgehen scheint ein generelles Merkmal der schriftlichen Flirtsprache zu sein, da es ebenfalls schon früher bei den Kontaktanzeigen in Zeitungen auftaucht, wie Schibli in ihrer Untersuchung zu Kontaktanzeigen zeigt (vgl. Schibli 2014: 6). Obwohl von Offline- zu Onlinekontaktanzeigen ein medialer Wechsel vollzogen wurde, besteht weiterhin viel Konsens in der ‹Art› des Flirtens (vgl. Bachmann-Stein 2011: 109). Ein interessanter Unterschied ist jedoch, dass im Internet deutlich häufiger Verstösse gegen die sprachlichen Normen (Orthographie, Grammatik, Syntax) zu beobachten sind (vgl. Bachmann-Stein 2011: 105). Dies mag irritierend wirken, wenn man sich die Argumentation von Geser und Ben-Ze’ev vor Augen hält, nach der Schreibkompetenz «even more important than physical attractiveness» (Ben-Ze’ev 2004: 38) ist und dass von der Schreibkompetenz häufig Rückschlüsse über «intelligence, charm and creativeness» (Geser 2007: 17) des Schreibers gezogen werden.
Auch wenn sich die Spannung zwischen diesen beiden Beobachtungen nicht vollständig auflösen lässt, so kann diese Ambiguität zumindest ansatzweise durch den Umstand erklärt werden, dass im Internet generell laxere (sprachliche) Umgangsformen herrschen: Aussagen werden häufig ohne Punkt am Ende formuliert, längere grammatikalische Strukturen werden zu Ellipsen oder vollständig ausformulierte Fragen zu simplen Akronymen verkürzt (Geht es dir gut? > Geht’s gut? > GG?).2 Dürscheid bringt zusätzlich den berechtigten Einwand vor, dass normfernes Schreiben auch als Zeichen von ‹Lockerheit› angesehen werden könne (vgl. Dürscheid 2017: 65); das komme auf das Wohlwollen des Gegenübers an. Ganz im Sinne des Halo-EffektsKognition/kognitiv3 sieht ein bereits interessierter User seinem Gegenüber einiges nach bzw. interpretiert es der Wunschvorstellung entsprechend um. Dadurch oszilliert eine fehlerhafte Syntax zwischen ‹charmant› und ‹unseriös› – je nach Interessensgrad des Empfängers. Dennoch scheint eine korrekte Rechtschreibung auf seriösen Singlebörsen wie ParshipParship einen hohen Stellenwert zu haben (vgl. Albert 2013: 153).
Zusammenfassend lässt sich also für die Kommunikation auf Singlebörsen wie ParshipParship festhalten, dass zwar Wert auf korrekte Rechtschreibung und Grammatik gelegt wird, aber dennoch ein gelockertes Verhältnis zu sprachlichen Regeln besteht, gezeigt durch nähesprachlichesnähesprachlich Verhalten (‹Du› statt ‹Sie›) und gebräuchlichen Abkürzungen wie hdl oder gg?.