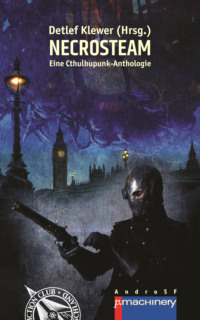Kitabı oku: «NECROSTEAM», sayfa 2
»Was soll ich Ihnen sagen? Sie sind in die Stollen gegangen und dort geblieben. Die Fabrikanten haben auch deren Familien in die Stollen geschickt, genau wie jeden Fremden, der zu uns kommt, um sein Glück zu suchen.«
»Die Brüder sagen, die alten Polen nennen die Dampfmänner Rabota, weil sie nur Arbeit kennen.«
»Halt den Mund, Emil.« Die Alte schob die Geldstücke zusammen. »Und Sie verschwinden jetzt.«
Ich starrte aus dem Fenster. Der Nebel hatte sich bis auf die Straße gesenkt. In den dunklen Schwaden erahnte ich riesige Schatten, Tentakeln gleich, die aus der Erde wuchsen. »Bitte lassen Sie mich bleiben.« Meine Stimme war dünn wie die eines Kindes.
»Wo müssen Sie denn hin?«
»Hotel Middendorf.« Draußen lauerte das Ding hinter der Wirklichkeit und machte mich wimmern.
»Emil wird Sie führen. Er kennt die sicheren Wege.«
Die sicheren Wege? Was waren die unsicheren?
Die Alte drückte mir ein Staubtuch in die Hand und band ihrem Enkel ein anderes um Mund und Nase. »Macht schon, ich will euch nicht hier haben, wenn er kommt.« Sie drückte Emil eine Gaslampe in die Hand.
Wenn wer kommt?, wollte ich fragen, doch Emil zog mich bereits die Treppe hinunter und ich lief hinter ihm her, wie ein Zicklein hinter dem bimmelnden Bock, voll Angst, von den Wölfen gefressen zu werden.
Vom Erdboden verschluckt.
An den Weg zum Hotel Middendorf will ich mich nicht erinnern. Mag sein, dass ich mein Lebtag noch nie so viel Grauen empfunden habe, wie in diesem tödlichen Dampf. Meine Augen brannten, Tränen versuchten vergeblich, die Fremdkörper aus ihnen zu spülen. Mein Nacken verkrampft noch heute, wenn ich an diesen Weg denke, denn das Gefühl, von etwas gepackt und in den Erdboden gezogen zu werden, springt in mir auf.
Ich weinte vor Dankbarkeit, als wir das Hotel Middendorf erreichten. Davor stand der Vierspänner mit dem Dampfmann.
Die Baronesse erwartete mich bereits. Ihre Haut wirkte wächsern und blass. »Wir brechen auf, jetzt.«
Aus der Kutsche heraus sah ich im Nebel das blasse, rotznäsige, rotäugige Gesicht von Emil, rötlich schimmernd im Licht seiner Gaslampe.
Berta von Babelsberg und ich sprachen kein Wort, bis wir in der Graf von Paris waren und uns sicher, dass der Gestank nach Schwefel und Ruß nur noch aus unseren Haaren und Kleidern drang und nicht mehr aus der Luft um uns herum.
»Ich möchte nichts hören«, wies mich Berta von Babelsberg an, setzte sich im Kartenraum hinter den Schreibtisch und griff zu Füller und Papier. »Nur eins, haben sie Spuren der Steamstorma gefunden, ja oder nein?«
»Nein.«
Sie schrieb. Weil ich den Brief an den Kaiser versiegelte und mich um die Zustellung kümmerte, weiß ich, was sie geschrieben hat.
Keine neuen Erkenntnisse. Ruhrgebiet funktioniert. Brauchen mehr Arbeiter.
– BB
Ich war nie wieder im Kohlenpott. Doch ich weiß, dass die Stahllieferungen für die Werften und Dampflokomotiven weiterhin zuverlässig sind und nach wie vor Arbeiter aus der Fremde in die Region an der Ruhr ziehen. Viele mit ihren Familien, auf der Suche nach dem Glück. Während ich diese Zeilen schreibe, blicke ich auf die Straßen von Berlin. Hier gibt es neuerdings Rikschas, die von Dampfmännern gezogen werden. Die Wiemann-Werft soll sie auch einsetzen. Einige der Dampfmänner wurden zerbeult und zerschlagen in Nebengassen gefunden, scheint, als wären die Steamstorma hier aktiv. Doch die Dampfmänner sind zäh. Ich weiß immer noch nicht, wie sie wahrnehmen. Aber ich bin sicher, auch ohne Augen beobachten sie uns.
Die Frage ist nur … für wen …

Sophia Rosenberger: Der Krieg der Universitäten
Eine halbe Tagesreise nordwestlich des altehrwürdigen Londons, dort, wo sich die Themse noch schmal und friedlich durch die südenglische Ebene zieht, liegt ein Tal, das seit einem Jahrzehnt niemand mehr betreten hat. Auf den meisten Landkarten Englands wird es durch einen großen, schwarzen Fleck gekennzeichnet, von dem aus sich in alle Himmelsrichtungen Arme wie die eines gierigen Seesterns ausstrecken. Lässt man den Blick von diesem Punkt ein Stück gen Nordosten wandern, findet man am Ufer des Flusses Cam einen ebensolchen unheimlichen Fleck.
Jahrhundertelang hatten an diesen beiden Orten zwei legendäre Städte gestanden, die erst die Wiegen des Wissens, dann die Hochburgen der Macht des gesamten Empires gewesen waren: Oxford und Cambridge. Es hatte Zenturien, Millennien gedauert, hatte Lebenszeiten an Arbeit, Leidenschaft und Erfindergeist gekostet, sie zu dem zu machen, was sie in ihren Glanzzeiten darstellten. Doch es bedurfte lediglich einer einzigen schicksalhaften Nacht, beide für immer verschwinden zu lassen.
In nur einer Nacht barsten gläserne Paläste, und goldene Spitztürme stürzten ins bodenlose Nichts. Und mit ihnen fiel auch England, das, ohne sein pulsierendes Herz des Fortschritts und der Triebkraft, unter der Last seines Weltreiches zusammenbrach. Über diese eine Nacht spricht niemand. Zumindest nicht außerhalb stiller Kämmerlein und geflüsterter Erzählungen am Kamin. Daher will ich, nun, da jene Nacht mehr als zehn Jahre zurückliegt, erzählen, wie es wirklich dazu kam, dass unsere Landkarten derart entstellt sind. Denn ich war dabei.
Der Aufstieg – und damit wohl zugleich auch der Sturz – Cambridges nahm im selben Jahr seinen Lauf, in dem Königin Victoria den englischen Thron bestieg. Tatsächlich munkeln einige, beides habe sogar mit dem Tag ihrer Krönung begonnen, auch wenn dafür heute keinerlei Beweise mehr existieren, denn sämtliche Tagebücher und Dokumente jener Zeit sind ebenso vom Erdboden verschwunden wie Cambridge selbst. Doch sämtliche Geschichtsbücher vermerken das Jahr 1837 als das der großen Veränderungen. Eine junge Victoria trat ihre Herrschaft an, John Herschel entdeckte am Nachthimmel eine Myriade neuer Galaxien – und Cambridge erwachte aus seinem universitären Schlummer.
Erst waren es nur einzelne der dort tätigen Wissenschaftler, die plötzlich von heute auf morgen Durchbrüche in ihrer Forschung erzielten. Doch im Verlauf weniger Monate, nein, Wochen, schienen sie alle – scheinbar im Schlaf – die Lösung ihrer mathematischen, physikalischen und chemischen Probleme zu finden. Gleichzeitig bescherte diese Zeit den Studierenden eine Eingebung nach der anderen. Bahnbrechende Konzepte und Erfindungen, die bis zu diesem Zeitpunkt als pure Fiktion wahnwitziger Autoren galten, wurden plötzlich zur Realität. Im November 1837 erhob sich das erste Luftschiff von den Ufern der Cam. Als das Weihnachtsfest 1837 nahte, war ganz Cambridge mit elektrischen Laternen beleuchtet.
Kaum einen Monat später erfolgte der nächste Durchbruch:
Die junge Assistentin eines Physikers erwachte morgens aus einem surrealen Traum und schrieb, völlig klar und doch wie in Trance, eine Formel in ihr Notizbuch. Als sie sie ihrem Vorgesetzten präsentierte, alarmierte dieser den gesamten Campus. Ein halbes Jahr später hatte man anhand ihrer Erkenntnisse und Berechnungen ein neues, vielseitig einsetzbares Element synthetisiert: den Æther. Industrie und Forschung überschlugen sich in Euphorie. Labors platzten aus allen Nähten, Werkstätten wurden errichtet, und binnen zweier Jahre wuchs Cambridge um das Dreifache an. Wissbegierige und Unternehmergeister des Landes wurden von der Metropole angezogen wie Wespen von einem Glas Zuckerwasser. Selbst das Königshaus vermochte sich ihrem Sog nicht zu entziehen, und so verlegte Victoria im Jahre 1839 persönlich ihr Domizil von London nach Cambridge, in den eigens dort errichteten Victoria Palace.
Unter den genialen Köpfen Cambridges befand sich auch Charles Babbage, dessen zumeist als Zukunftsmusik verschriene Konzepte künstlicher Gehirne im Jahre 1840 plötzlich physische Form annahmen: Olimpia, die erste ihrer Art, erblickte das elektrische Licht der Welt. Was als einfache Rechenmaschine begonnen hatte, avancierte durch eine nächtliche Offenbarung Babbages zu einer Frau aus Metall und Zahnrädern. Olimpia war ein Uhrwerksmensch, eine automatische Dienerin mit menschengemachtem Intellekt. Und sie sollte nicht die einzige ihrer Art bleiben. Nur ein Jahr später übergaben zahllose Unternehmer, wohlhabende Bürger und Wissenschaftler Cambridges ihre Arbeiten in die Messinghände der ersten Generation von Babbage-Automaten.
Die Stadt wuchs nicht nur, sie verwandelte sich auch. Nach einiger Zeit fiel den Bewohnern Cambridges auf, dass die pulsierende Energie ihrer Lampen und Generatoren sich auf andere, sonderbare Weise zu manifestieren begann. Das kühle Licht der Laternen schien in den Boden zu sickern und in der Luft hängen zu bleiben wie Dämpfe eines chemischen Experiments. Die Energieleitungen schien ein seltsames Glimmen zu umgeben, das über Wochen und Monate hinweg deutlicher und heller wurde, bis den ersten Beobachtern die Kristalle auffielen. Winzige, kristalline Partikel, die ein kühles, türkisfarbenes Licht verströmten, sammelten sich und umschwebten scheinbar schwerelos Laternen und Maschinen. Wie leuchtende Aquamarinsplitter tanzten sie in der feuchten, englischen Luft. Was anfangs Besorgnis auslöste, wurde bald zum Versuchsobjekt der Cambridger Wissenschaftler. Doch nach langwierigen, aufwendigen Experimenten kamen alle Beteiligten zu dem Schluss, dass die Kristalle als Folge hoher Ætherkonzentration im Stadtgebiet zu betrachten seien. Tatsächlich schien das türkise Glühen nur im Stadtkern Cambridges aufzutreten. Sobald man die Innenstadt verließ, verschwand auch das Leuchten. Als keine schädliche Wirkung der Kristalle nachgewiesen werden konnte, wurde Entwarnung für die Bevölkerung gegeben. Die Stadt setzte ihr wucherndes Wachstum fort, und das überirdische Leuchten wurde heller. Wenn im Frühjahr und Herbst der Nebel aus den Flusswindungen der Cam kroch und den Ort einhüllte, glomm Cambridge gleich einer versunkenen Stadt am Grunde des Ozeans. Die Luftschiffe über dem türkisen Dunst wirkten dann wie Wale, die über Atlantis hinwegzogen; die Schnellbahnen auf ihren hochbeinigen Schienenkonstruktionen dagegen glichen Muränen, die sich durch ein aquatisches Höhlensystem schlängelten.
Hätten die Bewohner der Metropole geahnt, was wirklich hinter den schwebenden Leuchtpartikeln steckte, sie alle hätten ihr Heil in der Flucht gesucht. Dass die funkelnden Irrlichter gleichsam Vorboten des Untergangs Cambridges sowie ganz Englands sein könnten, ahnte damals keine Seele. Auch nicht die Neider, die von Südwesten auf ihren Konkurrenten schauten und in verletztem Stolz nach einem Weg suchten, mit Cambridge gleichzuziehen. Denn die ewigen Rivalen, die im Schatten der träumenden Türme Oxfords jahrhundertelang die Elite des Landes gelehrt hatten, vermochten das Glück ihrer Widersacher nicht zu teilen. Die Oxforder Gelehrten mussten zusehen, wie im Nordosten ein nie da gewesener Moloch erwuchs, der junge wie alte Menschen in sich aufsog und stetig weiter wucherte und gedieh. Zugleich begann weiter flussabwärts die einstige Hauptstadt des Landes zu kränkeln, ähnlich einem Baum, dem man die Wurzeln durchtrennt hatte. Londons altehrwürdige Fassaden bröckelten, verlassene Fabriken und Häuserblocks säumten die Straßen, leere Hüllen und bloße Erinnerungen an einst glorreiche Tage.
Oxford sah sich gezwungen, zu handeln. Tiefe Verzweiflung mischte sich mit verletzter Ehre und wurde zu einer giftigen Verbindung, die sich hartnäckig in den Geistern der Oxforder Genies festsetzte. Der Rat der Universitätsleitung beschloss, man dürfe den eigenen Ruf nicht derart kläglich im Sande der Bedeutungslosigkeit verlaufen lassen. Rekrutierungsverfahren und Stipendien wurden ins Leben gerufen, mit dem Ziel, junge Denker in die verschlafene Universitätsstadt zu locken. In den ersten Jahren funktionierten diese Anreize noch, und was Cambridge durch augenscheinlich pures Glück vollbrachte, glich Oxford durch harte Arbeit wieder aus. Die Wissenschaftler und Techniker im Süden schrieben sich die Finger blutig, während ihre Konkurrenten in seligem Schlummer genialste Ideen einfach erträumten.
Als Fleiß und Mühen schließlich nicht mehr ausreichten, griffen die Oxforder auf weniger edle Mittel zurück. Von blankem Neid getrieben, verließen sie den Pfad der Moral. Spione und Saboteure wurden in Cambridge eingeschleust, und binnen weniger Monate wandelte sich die vormals klare Führung Cambridges zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen.
Ich erinnere mich gut an den Tag, an dem Oxfords Ausmaße diejenigen Cambridges erreichten. Es war mein achtzehnter Geburtstag im Jahre 1856, und die gesamte Stadt befand sich im Ausnahmezustand. Ausgelassen feierte man den hart erkämpften Gleichstand und den – da waren sich alle einig – bald bevorstehenden Sieg über den Erzrivalen. Ich selbst empfand die Feierlichkeiten nicht als positiv, geschweige denn frohsinnig. Wer genau hinsah, erkannte damals schon, dass der Verfall seine Klauen auch bereits ins Herz Oxfords geschlagen hatte. Als ich mit meinen damals noch so klaren, wachen Augen durch die engen, üppig geschmückten Straßen schlich, spürte ich, dass in jedem Winkel eine unheimliche Düsternis lauerte. Jedes gesellige Beisammensein schien sich innerhalb weniger Stunden in hitzige Streitereien zu verwandeln. Einer dunklen Wolke gleich, sammelten sich die Eifersucht, der getriebene Wille und der blinde Hass der vergangenen Jahre über der Stadt.
Doch die Ausschreitungen jener Nacht schienen den obersten Köpfen der Universität keine Warnung zu sein. Stattdessen wurden sämtliche Bemühungen verdoppelt und verdreifacht. Stellte Cambridge ein neues Luftschiff vor, entwarfen die Oxforder ein schnelleres, leichteres, besseres. Entwickelte ein Cambridger Arzt eine Uhrwerksprothese für Kriegsveteranen, machten die Oxforder sie beweglicher, geschickter und leichter zu steuern. Cambridge hatte Babbage und seine metallene Grazie Olimpia. Und Oxford hatte Gabriel Loxley, dessen Uhrwerkskreation sowie seine treuen Diener: die mechanische Kalliope und einen ihm ergebenen Menschen – mich, Scorpio Wolfe.
Loxley war eines der wenigen Universalgenies, die gänzlich ohne Betrug und gestohlene Ideen auskamen. Ursprünglich zog mich die helle Flamme seines Intellekts zu ihm hin, aber sein warmes und angenehmes Wesen, das er nur seinen engsten Vertrauten offenbarte, hatte mich über die Jahre in seiner Nähe gehalten. Kalliope, eine Frau, deren mechanische Natur einzig der metallene Glanz ihrer goldenen Haut verriet, war eine Schöpfung Loxleys. Sie bewegte sich wie wir, sie dachte wie wir, und sie sprach – so selten das auch vorkam – wie wir. Schön und unwirklich in ihrer Erhabenheit, zeigte sie sich gleichermaßen verblüffend wie bestürzend in ihrer Auffassungsgabe. Loxley stellte sie ein Jahr nach Babbages großem Olimpia-Durchbruch fertig, hatte jedoch zuvor bereits ein Jahrzehnt seines jungen Lebens in ihre Konstruktion investiert. Sie sollte eine ebenso starke wie zuverlässige Dienerin und Gefährtin werden, und genau das gelang ihm. Doch in der Flut Cambridger Entwicklungen ging seine großartige Errungenschaft unter.
Einzig in Oxforder Kreisen wusste man Loxleys Erfindergeist, wie auch sein grenzenloses Wissen über die Welt und das, was außerhalb unserer bewussten Wahrnehmung lag, zu schätzen. Und aus diesem Grund rief man uns am Neujahrstag 1859 zum obersten Dekan des Oxforder Universitätsrates. Der Tag war klirrend kalt, und das Kopfsteinpflaster so eisig, dass selbst Kalliopes leichte Schritte ein ums andere Mal ins Stolpern gerieten. In perfektem Gleichschritt gingen sie und Loxley voran auf das Christ Church College zu.
So oft Loxley mich auch bereits an diesen Ort mitgenommen hatte, erschien er mir doch jedes Mal wieder wie ein seltsames Märchenschloss. Den riesigen, quadratischen Innenhof des Colleges überspannte seit Neuestem eine kristallene Kuppel. Unter deren schützender Wärme verwandelte man das ordentliche Grün des Hofes in ein paradiesisches Tropenhaus, in dem exotische Vögel und Schmetterlinge umherflatterten wie bunte Feenwesen. Doch der schöne Schein konnte meine Sinne nicht trügen: Christ Church College sah bezaubernd aus, jedoch herrschte gespenstische Stille in diesen prachtvollen Hallen. Die Dunkelheit Oxfords ließ die Tiere verstummen und klammerte sich mit kalten Fingern an die alten Mauern.
Der Dekan erwartete uns in seinem Studierzimmer. Ein Feuer loderte im Kamin, doch es verbreitete kaum Wärme. Der Dekan machte gerade Anstalten das Wort zu ergreifen, als Loxley ihm zuvorkam: »Sie benötigen meine Hilfe, Dekan? Womit kann ich Ihnen dienen?«
Der Angesprochene schnaubte und ließ sich hinter seinem Schreibtisch in einen lederbeschlagenen Sessel fallen. »Sie wissen, in welcher Funktion ich Sie hergebeten habe.«
Loxley gab Kalliope einen Wink. Diese schritt zu einem kleinen Tischchen, auf dem der Dekan Spirituosen aller Art aufbewahrte, und schenkte Gin in zwei Kristallgläser. Wie immer folgte ich gebannt jeder ihrer Bewegungen. Die schlichte Eleganz, mit der sie jede Arbeit verrichtete, fesselte meine Aufmerksamkeit jeden Tag aufs Neue. Als ihre silbernen, pupillenlosen Augen meinem Blick begegneten, wandte ich mich ab. Hitze stieg mir ins Gesicht. Sie sah mich unverwandt an. Hätte ihr metallener Mund lächeln können, sie hätte es getan.
Im nächsten Moment ging sie zu ihrem Herrn und reichte ihm eines der Gläser. Erwartungsvoll streckte nun der Dekan ebenfalls die Hand aus, doch Kalliope kehrte ihm den schmalen Rücken zu und reichte stattdessen mir das zweite Glas. Sichtlich verärgert verschränkte der Dekan daraufhin die Hände auf der Schreibtischplatte. Loxley nippte an seinem Gin, betrachtete sich in der spiegelnden Oberfläche des Glases und strich sich das wilde, blonde Haar glatt.
Erst, als er ausgiebig gekostet und mit dem Anblick seiner selbst zufrieden zu sein schien, antwortete er dem Dekan, den Blick weiterhin auf das Glas gerichtet. »Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass Ihr Wettrennen mit Cambridge nicht gewonnen werden kann. Sie wollen sich endlich einen Vorteil verschaffen. Dass die Cambridger nicht mehr nach irdischen Regeln spielen, scheint endlich auch zu Ihnen vorgedrungen zu sein.«
Er schenkte mir sein schalkhaftestes Lächeln und zwinkerte Kalliope zu, ehe er seinem Gegenüber ins Gesicht sah.
»Sie wollen, dass ich nach etwas suche, das Sie in diesem Krieg der Universitäten voranbringt. Etwas, das nicht von dieser Welt ist – möglicherweise nicht einmal aus diesem Universum. Liege ich da richtig?«
Die Selbstsicherheit Loxleys jagte mir einen Schauer über den Rücken. Ich kannte seine Leidenschaft für sein Fachgebiet – das Übernatürliche, das Unbegreifliche, die Kryptotheologie und das schlicht Außerweltliche. Doch in letzter Zeit schien er zügelloser geworden zu sein, und ich wusste noch nicht recht, ob mir dieser Sinneswandel behagte.
Loxley und ich hatten beide in unserer Jugend intensive Studien betrieben. Unsere geteilte Begeisterung und tiefe Faszination für Kulte und das Okkulte hatte uns ursprünglich zusammengeführt. In der Bodleian Library hatten sich unsere doch sehr verschiedenen Wege eines Tages gekreuzt, an einem glänzend lackierten Tisch im warmen Licht der vielleicht letzten Gaslampen des Landes. Das kalte, arktisch-blaue Licht der elektrischen Laternen hatte es – zumindest damals – noch nicht ins Allerheiligste der altehrwürdigen Bibliotheken geschafft. Und so kam es, dass im müden, gelben Schein der Bibliothekslampen zwei Männer enger zusammengerückt waren, beide vertieft in brüchige alte Wälzer über archaische Bräuche und fremdartige Rituale. Ich, ein einfacher Hausdiener, der nach Wissen lechzte, und Gabriel Loxley, ein einsamer Lord, der nach einem Sinn in den Irrungen und Wirrungen der Welt suchte.
Beide stürzten wir uns in Erzählungen längst vergangener Kulturen, um im Fantastischen Zuflucht vor unseren ruhelosen Nächten zu suchen. Seine Begeisterung befeuerte meinen Lernwillen, und meine Neugier beflügelte seinen Intellekt. Loxley stürzte sich mit beinah ungesunder Hingabe in die Tiefen gedruckter Buchstaben, las bis zur Erschöpfung, notierte und analysierte. Einem Getriebenen gleich sammelte er immer weitere Bücher und Schriften an, bis sie sämtliche Zimmer seines prächtigen Stadthauses übernahmen. Bücherstapel wuchsen dort gleich wuchernden Pilzwäldern in die Höhe, mit jedem Tag schienen noch mehr aus dem Boden zu schießen. Selbst Kalliope vermochte irgendwann nicht mehr, Loxleys ausuferndem Chaos eine Logik abzugewinnen.
Loxley engagierte mich als seinen Butler, und wenn er erschöpft über den Pergament- und Papyrusseiten einschlief, brachte ich die alten Geschichten in Sicherheit – und ihn ins Bett. Während er sich traumlosem Schlaf hingab, tauchte ich in Fantasiewelten ein, erbaut aus jahrtausendealter Tinte und Tusche, wandelte auf Traumpfaden gefallener Götter und toter Kulturen. Entführten meine Träume mich nachts in diese unbekannten Universen, fand ich in ihren grotesken Formen seltsamen Trost – wie auch in der Nähe der Uhrwerksfrau Kalliope, die stets unweit meiner Kammer über ihren Meister wachte. An manchen Abenden, wenn sie scheinbar geräusch- und körperlos an meiner halb geöffneten Tür vorbeiglitt, hatte ich das Gefühl, sie selbst entspränge ebenfalls meinen weltfremden Träumen.
Irgendwann beschlossen Loxley und ich, dass uns bloße Theorie nicht mehr ausreichte. Wir wollten mit eigenen Augen die Orte sehen, an denen die Legenden und Überlieferungen aus unseren Büchern ihren Ursprung hatten. Wir wollten die Geburtsstätten dieser Zivilisationen selbst durchwandeln, ihre Überreste mit eigenen Händen berühren, die Luft alter Tempel atmen und ihr Aroma auf der Zunge schmecken. So begannen unsere Expeditionen, durch die Loxley sich einen Namen in Oxforder Kreisen machte. Und wegen derer wir heute im Studierzimmer des Dekans standen. Der schwieg Loxley nach dessen dreisten Worten eine geschlagene Minute lang mit starrem Blick an, erhob sich dann ruckartig – und hieb so heftig mit der Faust auf den Tisch, dass ich zusammenfuhr. Loxley und Kalliope blieben ungerührt.
»Ich bin es leid, Loxley!«, ereiferte sich der Dekan. In seinen kalten Augen funkelte derselbe Hass, der all seine Gleichgesinnten bereits längst vereinnahmt hatte.
»Diesen verfluchten Cambridge-Stümpern fällt alles in den Schoß, während wir uns bucklig schuften und unsere Hirne zermartern wie Wahnsinnige! Es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit! Und mir reicht es. Wir werden Cambridges Elfenbeintürme zum Einsturz bringen.«
Energisch schenkte er sich nun eigenhändig ein Glas Gin ein und stürzte es mit heftig zitternder Hand hinunter. Mit vor Gier und Erregung geweiteten Augen fuhr er an Loxley gewandt fort:
»Oxfords Grenzen stoßen bald an die von London. Und wir werden es schlucken. Cambridge mag unsere neue Kapitale sein, doch die alte wird ein Teil Oxfords. Damit sichern wir uns einen eigenen Hafen und die letzten Fabriken und Lehrstätten, die sich dort gehalten haben. Aber aus eigener Kraft – ich muss es leider gestehen – sind wir dazu nicht in der Lage. Zwanzig Jahre lang haben wir alles Menschenmögliche getan, um uns an die Spitze des Landes und des Empires zu setzen. Nun ist es an der Zeit, das Menschenunmögliche in Angriff zu nehmen. Und dafür sind Sie der selbst erklärte Experte, Loxley.«
Der Angesprochene hob die Augenbrauen. Kein einziges der Worte aus dem Munde des Dekans schien ihn auch nur im Mindesten überrascht zu haben.
»Was schlagen Sie vor, Dekan?«, fragte er leise.
Als sie den Tonfall Loxleys vernahm, lehnte Kalliope sich kaum merklich vor. Ich tat es ihr nach. Unser beider Gehör war inzwischen so fein auf ebendiesen Ton geeicht, dass wir mit ihm resonierten wie Stimmgabeln. Kaum unterdrückte Vorfreude schwang in ihm mit, ließ Loxleys Stimme vibrieren – und uns erschaudern.
Kein Zweifel, uns erwartete eine neue Expedition. Und wenn ich mir die beiden Männer vor mir besah, beide von ihren eigenen Dämonen getrieben, erfüllte mich die Sicherheit, dass dieses Abenteuer sich von unseren bisherigen unterscheiden würde. Wie grundlegend, war mir noch nicht klar. Doch tief in meinem Innersten muss ich gewusst haben, dass wir erstmals tatsächlich finden würden, wonach wir immer gesucht hatten. Nur fürchtete ich mich mit einem Mal vor dieser Vorstellung.
Ich erinnere mich, kurz verstohlen Kalliopes Blick gesucht zu haben, in der Hoffnung, sie teile meine plötzliche Furcht. Doch ich kann heute nicht mehr sagen, ob sie meinen stummen Hilferuf hörte.
»Ich will«, hob der Dekan an, »dass Sie eine jener überirdischen Kreaturen finden, von denen Sie so oft in Ihren Abhandlungen berichten. Falls sie wirklich existieren, müssen wir uns ihre Macht zunutze machen. Was immer nötig ist, Loxley, solange es nur dem Sisyphosdasein Oxfords ein für alle Mal ein Ende setzt!«
Und so kam es, dass Loxley, Kalliope und ich am 19. März 1859 ein Luftschiff der Oxforder Universität bestiegen und uns aufmachten, einen Gott zu wecken.
In mir rang kindliche Vorfreude mit einer mir unerklärlichen Angst. Doch statt auf Letztere zu hören, folgte ich Loxley, stellte mich im Angesicht aller drohenden Gefahren in meiner Naivität blind und taub. So sehr mich seine Begeisterung für die größenwahnsinnige Mission des Dekans auch erschütterte, hatte ich doch noch nicht die Hoffnung aufgegeben, auf dieser Expedition endlich die heiß ersehnten, unglaublichen Wunder zu schauen, die wir uns in gemeinsam durchwachten Nächten ausgemalt hatten. Meine Neugier, die mich einst auch zu Loxley geführt hatte, überwog und ertränkte meine Zweifel. Mein Leben hatte seit unserer ersten Begegnung in seinen Händen gelegen, und es widerstrebte mir, mein Vertrauen aufgrund einer vagen Furcht aufzugeben, ganz gleich, wie sehr sie in meinem Inneren wütete und tobte.
Zugleich gab mir Kalliopes Beisein Sicherheit. Solange ich ihre anmutige Gestalt nahe wusste, konnte nichts geschehen, sagte ich mir.
Wir begannen unsere Suche in den Ruinen Petras, der alten, in meterhohen Fels gehauenen Wüstenstadt. Unser Weg führte über glühenden Sand und durch tödlich kalte Nächte – doch fündig wurden wir nicht. Zwar stießen wir auf Überreste alter Tempel. Doch schon bei Berührung der geborstenen Steine erfüllte uns die Gewissheit, dass ihr Zauber längst verflogen war.
Hoffnungsvoll wandten wir uns gen Osten. Auf den Hochebenen Tibets hoffte Loxley, Hinweise auf eine versunkene Stadt zu finden. Erzählungen nach sollte sie an den felsigen Steilhängen in den abgelegensten Teilen des Himalajas hängen, geformt aus gigantischen Steinblöcken und aufgetürmt zu grotesken Gebilden. Doch noch ehe wir die verheißene Bergkette erreichten, zwang uns ein unerwarteter Schneesturm zur Landung.
In derselben Nacht träumte ich vom Ziel unserer Suche und wachte schweißgebadet auf, nicht sicher, was real und was Produkt meiner Fantasie war. Im Traum hatte ich die gigantische Stadt betreten und sie gespenstisch leer vorgefunden. Die Leere selbst schien dort ein Bewusstsein entwickelt zu haben, und einen unstillbaren Hunger, der mich nach nur drei weiteren Schritten ins Innere mit Haut und Haar verschlungen hatte.
Kalliope, die mich aus meinen panischen, krampfhaften Windungen geweckt hatte, hörte sich meine Schilderungen still an, um dann entschlossen ans Steuer des Luftschiffes zu treten. Loxley geriet am nächsten Morgen außer sich, als er erfuhr, dass sie des Nachts den Kurs geändert und uns aus den Tiefen des Gebirges hinausmanövriert hatte. Doch Kalliope rückte nicht von ihrer Entscheidung ab, und irgendwann sah sich Loxley angesichts ihres stoischen Schweigens zur Aufgabe gezwungen.
Auch im indischen Dschungel und den Wäldern Neuseelands fanden wir nicht, wonach Loxley suchte. Weder uralte Maoridörfer noch von Schlingpflanzen überwucherte Mayatempel brachten die erhoffte Offenbarung. Er schien ein konkretes Ziel zu verfolgen, schien nach Spuren eines ganz bestimmten Gottes oder Wesens zu suchen, von dem er uns jedoch nichts erzählte. Loxley wurde ruhelos, und seine Nervosität steigerte sich mit jedem Ort, den wir unbehelligt verließen.
Fast sieben Monate nach unserem Aufbruch erreichten wir die Arktis im nördlichen Teil Grönlands. Hier schien Loxleys letzte Hoffnung zu liegen.
Im ewigen Eis stand die Zeit still. Die Pfade alter Schamanen, denen wir – gemäß Loxleys immer seltener werdenden Erklärungen – folgten, schienen in der tödlichen Kälte für alle Zeiten konserviert.
Das Ziel unserer Suche, ein uralter, mannshoher Schrein, stand im Inneren eines gigantischen Walgerippes. Zu beiden Seiten des aus schneeweißem Stein erbauten Altars ragten gigantische Rippenbögen auf und bildeten ein Kathedralengewölbe aus Knochen und Eis.
Ich spürte sofort, als wir Fuß auf den einst heiligen Boden setzten, dass sich Zeit und Raum hier anders verhielten. Die Luft um uns herum fühlte sich seltsam dünn an, doch erwies sie sich nicht als schlechter atembar. Vielmehr schien sie weniger dicht, als müsse man nur die Hand ausstrecken, um aus unserer Realität in eine andere zu greifen. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie die Grenzen von Horizont, Schneewehen und Walknochen ineinanderflossen.
Ohne dem bizarren Flirren in der Luft um uns herum Beachtung zu schenken, stürmte Loxley in seinem unbegrenzten Eifer bereits voran. Mir aber stellten sich die Nackenhaare auf. Auch Kalliope folgte unserem Herrn nur zögernd in das eisige Sanktum.
Als wir uns Loxley näherten, tastete ich mit meiner Hand unwillkürlich nach der der Automatin. Er war vor dem Schrein auf die Knie gefallen und studierte die schamanischen Zeichen, die den blanken Stein bedeckten.
Ich weiß nicht, wie lange er dort verharrte, mit bloßen Fingern über die bizarren Muster fuhr und Unverständliches vor sich hin murmelte. Wie ich bereits zu Anfang gespürt hatte, verhielt sich die Zeit hier anders. Mich überkam das Gefühl, in eine Art wachen Schlafes abzudriften, während Loxley und Kalliope, die von Wind und Wetter völlig unberührte Oberfläche des Schreins untersuchten.