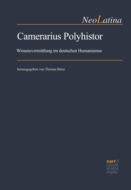Kitabı oku: «Neulateinische Metrik», sayfa 6
Literaturverzeichnis
1. Primärtexte
Cunrad, Caspar: Jacobi Monavi Viri Clariss. Manes Ad Nobilis. Dn. Daniel. Rindfleisch Bucretium, Patritium Et Physicum Vratisl., Liegnitz [1603].
Fulbertus Carnotensis: Opera omnia, herausgegeben von Jacques Paul Migne, Paris 1880 (Patrologia Latina, Bd. 350).
Melchior, Adam: Vitae Germanorum, Heidelberg 1620.
Prudentius, Aurelius: Carmina, herausgegeben von Maurice P. Cunningham, Turnhout 1966 (Corpus Christianorum. Series Latina, Bd. 126).
2. Sekundärtexte
Belke, Horst: Literarische Gebrauchsformen, Düsseldorf 1973 (Grundstudium Literaturwissenschaft, Bd. 9).
Curtius, Ernst Robert: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 1948.
Duckworth, George Eckel: Vergil and Classical Hexameter Poetry. A Study in Metrical Variety, Ann Arbor 1969.
Flood, John L.: Poets Laureate in the Holy Roman Empire. A Bio-Bibliographical Handbook, Bd. 1, Berlin 2006.
Garber, Klaus: Cunrad (Conradus), Caspar, in: Wilhelm Kühlmann u.a. (Hg.): Frühe Neuzeit in Deutschland 1520–1620. Literaturwissenschaftliches Verfasserlexikon, Bd. 2, Berlin 2012, 75.
Garber, Klaus: Reformierte Mentalität und literarische Evolution. Aspekte kultureller Disposition der nobilitas literaria Silesiae im europäischen Kontext, in: Joachim Bahlcke/Irene Dingel (Hg.): Die Reformierten in Schlesien. Vom 16. Jahrhundert bis zur Altpreußischen Union von 1817, Göttingen 2015 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Abt. für Abendländische Religionsgeschichte, Bd. 106).
Hermann, Friedrich Carl: Die Elision bei den römischen Dichtern, in: Jahresbericht über die Königstädtische Realschule, Berlin 1863, 3–32.
Hermann, Gottfried: Elementa doctrinae metricae, Leipzig 1816.
Klopsch, Paul: Pseudo-Ovidius de vetula. Untersuchungen und Text, Leiden 1967 (Mittellateinische Studien und Texte, Bd. 2).
Klopsch, Paul: Einführung in die mittellateinische Verslehre, Darmstadt 1972.
Kocks, Wilhelm: De caesura versus hexametri poetarum Latinorum, quae est post quinti pedis arsim, Köln 1862.
Multhammer, Michael: Was ist eine „natürliche Schreibart“?, in: Aufklärung. Interdisziplinäres Jahrbuch zur Erforschung des 18. Jahrhunderts und seiner Wirkungsgeschichte 25 (2014), 133–158.
Norberg, Dag: Introduction à l’étude de la versification latine mediévale, Stockholm 1958 (Acta Universitatis Stockholmiensis, Bd. 5).
Schimmelpfennig, Adolf: Monau, Jacob, in: Allgemeine Deutsche Biographie 22, 1885, 162–163.
Stotz, Peter: Sonderformen der sapphischen Dichtung. Ein Beitrag zur Erforschung der sapphischen Dichtung des lateinischen Mittelalters, München 1982 (Medium Aevum, Bd. 37).
Thraede, Klaus: Der Hexameter in Rom. Verstheorie und Statistik, München 1978.
Verfehlte Klassik oder neue Normen in der Metrik des neulateinischen Dramas?
Jürgen Blänsdorf
Forschungen zur neulateinischen Dichtung haben bisher selten die Metrik in den Blick genommen. Dies gilt insbesondere für die Metrik des Dramas.Seneca1 Zu offenkundig ist die generelle Nachahmung der Tragödien Senecas und zu bedauerlich die Unfähigkeit der neulateinischen Komödiendichter, die PolymetriePolymetrie des PlautusPlautus, ja selbst die iambischen SenareIambusSenar des TerenzTerenz zu reproduzieren. Auf diese beiden Feststellungen lassen sich die Behandlungen der neulateinischen Tragödien und Komödien in den Standardwerken zusammenfassen.Caesius Bassus2 Schon von der frühen Kaiserzeit an hatten die Metriker Anlass zu dem Hinweis, dass die lateinischen Dramen tatsächlich in Versen geschrieben seien.PriscianDe metris fabularum TerentiiAsmonius3 Asmonius lehrte den Unterschied zwischen den iambischen TrimeterIambusTrimetern der Tragödien und den der Umgangssprache näheren iambischen SenarenIambusSenar der Komödien.PriscianDe metris fabularum TerentiiErasmus von Rotterdam4 Doch die von ihnen formulierten Regeln befähigten die Komödiendichter der Renaissance nicht, sie korrekt anzuwenden. Noch Erasmus von Rotterdam sah sich genötigt, der Meinung zu widersprechen, die antiken Komödiendichter und besonders TerenzTerenz hätten keine metrischen Regelnfreier Vers befolgt oder sich so viele Freiheiten erlaubt, dass es die Mühe nicht lohne, sie zu untersuchen.TerenzCreticus5 Aus dieser Unkenntnis seien viele der neueren Textkonjekturen zu erklären.TrochaeusErasmus von Rotterdam6 Erasmus dagegen erkennt die Absicht des Terenz,Terenz die Verse trotz Bewahrung des Metrums möglichst weit der Umgangssprache anzugleichen. Seine „in nur vier Tagen“Erasmus von RotterdamDe metris verfasste Metrik ist im Kern richtig. Er erfasste zwar alle iambischenIambus und trochäischenTrochaeus Metra und selbst einige CanticaCanticum, ebenso die ElisionElision und die SynizeseSynizese, aber das IambenkürzungsgesetzIambusIambenkürzung und erst recht die Regeln der Teilung von LongumLongum, geteiltes“ und AncepsAnceps, geteiltes (darüber s.u.) waren ihm noch unbekannt.Erasmus von RotterdamFaber, TanaquilTerenzDactylusIambus7 Ford urteilt: „Iambic metres in Renaissance verse tend to be the least well known, not least because of the confusion between the practice found in the comic writers TerenceTerenz and PlautusPlautus and that of the poets, especially HoraceHoraz. DiomedesDiomedes’ relatively strict advice is often ignored in the Renaissance.“Priscian8
Den Anstoß zu diesem Beitrag gab die im Jahr 1529 im Druck erschienene Tragödie Imber Aureus von Antonio TelesioTelesio, AntonioImber aureus (Antonius Thylesius Cosentinus), in der eine große Anzahl merkwürdig holpriger Verse auffallen.Telesio, AntonioImber aureus9 Als Beispiele seien hier einige Verse des Anfangs und zwei besonders schwer zu skandierende Verse zitiert.SkansionIktus10
| Ut filià parentí parìat ingens nefas11 | 50 |
| Vetùlus ut ònere bos iugi fessus diu | 52 |
| Verbère cadìt agricòl(ae) immemòris ictus graui | 53 |
| Animamque non merìt(am) emerìtus edit gemens. | 54 |
| Gaudere pòtius, fùgere quìa potis est malum | 56 |
| [usw., besonders schwierig:] | |
| Tamèn habuìt. inanè cape sòlium inflictum tempori. | 604 |
| Ferr(e)ae. pavòr oculos putò fefellit senis. | 976 |
Der Grund für die Holprigkeit dieser iambischen TrimeterIambusTrimeter – nicht Senare, denn das zweite, vierte und sechste Breve sind immer eingehalten – liegt nicht nur in der Häufung der Doppelkürzen, sondern in der Teilung der BreviaBreve, geteiltes“ durch die Wortgrenzen, seltener bei geteiltem Breve, also den Fällen von zerrissenem AnapästAnapaestuszerrissener, als bei geteilten LongumLongum, geteiltes“.PyrrhichiusTrochaeusIambusTribrachysIambusTrimeter12 Aber trotz der Holprigkeit der Trimeter beeindruckt TelesioTelesio, AntonioImber aureus durch eine reiche Fülle iambischerIambus und anapästischer Verstypen Anapaestus– einmal verwendet er auch stichische PherekrateenPherecrateus – und einen inhalts- und stimmungsbezogenen Wechsel der Verstypen, sodass die weitere Beschäftigung mit dieser Tragödie lohnt. Wir werden am historisch passenden Ort auf TelesioTelesio, AntonioImber aureus zurückkommen.
Dieser Beitrag verfolgt daher jeweils zwei Aspekte der neulateinischen Metrik, den eigentlichen Versbau und die metrische Komposition der Tragödien. Die von der großen Zahl neulateinischer Dramen erzwungene Beschränkung auf die Tragödien fällt leicht, weil die Komödien lange Zeit nur in Prosa oder nur teilweise metrisch gefasst waren – meistens nur die Versenden ab dem 5. Fuß –, später fast nur den iambischen TrimeterIambusTrimeter nach dem Vorbild der Tragödie gebrauchten, und das meistens sehr fehlerhaft, und sich selten an die Langverse und überhaupt nicht an die plautinischen CanticaCanticum heranwagten.IambusSenarFreiheiten in KomödieVergerio, Pier PaoloPiccolomini, Enea SilvioIambusAnapaestusTribrachysDactylusIambusSenarPlautusUrceo Codro, AntonioGnapheus, WilhelmAcolastus13 Zu den seltenen Ausnahmen gehören der Acolastus des Gulielmus Gnapheus (Willem de Volder) von 1529Birck, SixtDrama comicotragicum Iudith14, das Drama comicotragicum Iudith des Sixt Birck (Xystus Betuleius) von 1544 und der Anabion des Johannes Sapidus Sapidus, JohannesAnabionvon 1540. Bis auf die wenigen bekannten PlautusPlautus-SupplementePlautus15 gingen die neulateinischen Komödiendichter in der Dramaturgie überhaupt eigene Wege. Die Plautus- und TerenzTerenz-NachfolgeImitation beschränkte sich bis auf wenige Versuche auf die Sprache, ist aber auch darin von vollständiger Stilimitation weit entfernt.16
Wenden wir uns nun der Metrik der Tragödien der Renaissance zu.Mussato, Albertino17 Das erste Drama in antiker Form verfasste bekanntlich im Jahr 1315 der Paduaner Jurist, Staatsmann und Historiker Albertino Mussato, der von dem ebenfalls in Padua tätigen Richter Lovato LovatiLovati, Lovato (1241–1309) zum Studium der Tragödien SenecasSeneca angeregt worden war, die damals gerade in der Bibliothek von Pomposa entdeckt worden waren.Mussato, ሴiሴAlbertinoEcerinis18 Mussatos Ecerinis wurde, wie die große Zahl der Handschriften belegt, zum neuen Gattungsvorbild, seine metrische Praxis zur neuen Norm.IambusTrimeter19 Die Dialog- und Monologverse sind iambische Trimeter, die er im Stil SenecaSenecas, jedoch ohne je in einen CentoCento zu verfallen, meistert – mit Ausnahme der vorhin bei TelesioTelesio, AntonioImber aureus beobachteten, aber bei Mussato Mussato, Albertinoviel selteneren Varianten, den über die Wortgrenzen geteilten LongaLongum, geteiltes“ oder BreviaBreve, geteiltes“. Der erste Fall ist erst in V. 7 zu verzeichnenMussato, AlbertinoEcerinis:
| Quodnam cruentum sidus Arcthoo potens | |
| Regnavit orbe, pestilens tantum michi, | |
| Gnati, nefando flebiles cum vos thoro | |
| Genui. Patris iam detegam falsi dolos | |
| Infausta mater. Non diu tellus nefas | 5 |
| Latere patitur; durat occultum nihil. | |
| Audite nullo temporè negandum genus, | |
| Devota proles. Arx in excelso sedet […] |
Denn das blutige Sternbild, das machtvoll am Nordhimmel herrschte, war nur für mich Verderben bringend, als ich euch, ihr beweinenswerten Kinder, in einem verbrecherischen Bett gebar. Ich, die unglückselige Mutter, werde nun die Listen des falschen Vaters aufdecken. Die Erde lässt ein Verbrechen nicht lange im Verborgenen. Nichts Geheimes ist dauerhaft. Hört, ihr fluchbeladenen Kinder, dass eure Abstammung niemals zu leugnen ist. Eine Burg thront auf der Höhe […]
Auch die dramatische Struktur übernimmt MussatoMussato, Albertino trotz der Kürze von nur 628 Versen weitgehend aus SenecaSeneca. Die Ecerinis ist in fünf, freilich sehr ungleich lange Akte zu 1–3 Szenen gegliedert, die durch vier Chöre in lyrischen Maßen – GlykoneenGlyconeus, SapphikerSapphicus, AsklepiadeenAsclepiadeus und sapphische StrophenSapphicus – geteilt werden. Den Abschluss bildet ein kurzes (sechstes) ChorliedChor in AnapästenAnapaestus. Für alle Metra konnte MussatoMussato, Albertino Vorbilder in SenecaSenecas Tragödien finden, ohne sich der Reihenfolge einer von ihnen anzuschließen. Er wagte jedoch auch kein polymetrischesPolymetrie ChorliedChor. Vor allem aber im Gehalt wich er weit von Seneca ab. All das wurde zur neuen Gattungsnorm.20
Seine Verspraxis fasste Mussato nach der Veröffentlichung der Ecerinis Mussato, AlbertinoEcerinisin einer kurzen Abhandlung über SenecasSeneca Metrik zusammen, in der er die Lizenzen des iambischen TrimetersIambusTrimeter beschrieb: Im 1. Fuß kann außer dem IambusIambus ein SpondeusSpondeus, AnapästAnapaestus, DactylusDactylus, TribrachysTribrachys oder ProkeleusmaticusProceleusmaticus stehen, im zweiten nur IambusIambus oder TribrachysTribrachys usw.Longum, geteiltes“21 Aber mit dieser Methode erfasste er nicht die Regeln für die Wortenden beim geteilten Longum und BreveBreve, geteiltes“, wie sie in den heutigen Metriken formuliert sind, für die Komödie am besten von Stockert, für die gesamte szenische Metrik von Zgoll.Diomedes22 Doch weder die antiken MetrikerDonatServiusVictorinus, MariusAtilius FortunatianusCaesius BassusTerentianus MaurusMarius Plotius SacerdosSeneca23 noch der Seneca-Kommentar des Nicolaus TrevetusTrevetus, Nicolaus (1259–1329)Poliziano, Angelo24 boten in dieser Frage irgendeine Hilfe. Die Erkenntnisse der Renaissance zur antiken Metrik, z.B. Angelo Polizianos in seinem Versprolog zur Ausgabe der MenaechmiErasmus von RotterdamDe metris25 und die Abhandlung des Erasmus über die Metra des Terenz (s.o.), kamen für die Verspraxis des 15. und 16. Jahrhunderts zu spät oder boten wie Scaligers PoetikScaliger, Julius Caesar26 kein detailliertes Regelsystem für die Metrik.
Doch 75 Jahre nach Mussatos Ecerinis, im Jahr 1390, hatte Antonio LoschiLoschi, Antonio, vermutlich dank genauerer Beobachtung der Verspraxis Senecas, dieses Problem überwunden.Loschi, AntonioAchiles27 Seine um 1390 verfasste Tragödie Achiles (sic!) stellt in dieser Hinsicht einen Fortschritt dar, in anderer jedoch einen Rückschritt. Die Fehlerlosigkeit seiner iambischen TrimeterIambusTrimeter – in den 940 Versen des Achiles habe ich nur drei missglückte entdeckt (356, 473 und 474) – verdankt er einer perfekten StilimitationImitation, die sich immer wieder dem CentoCento nähert. Schon im ersten Vers lässt er deutlich genug den Anfang der senecanischen MedeaሴiሴSenecaMedeaሴiሴ anklingenLoschi, AntonioAchiles.28
| O coniugales horridas Troie faces,29 | |
| Quas profuga coniunx numine infausto tulit, | |
| Thalamos secutas regius puppes cruor | |
| Cuius pelasgas solvit! Immites deos | |
| Placare potuit cede virginea cohors | 5 |
| Argiva? Ratibus mille suffecit caput? |
O Hochzeitsfackeln, für Troja schaudervoll, die die geflohene Ehefrau [Helena] unter unheilvollen Vorzeichen trug, [und sie, d.h. Iphigenie], deren königliches Blut die griechischen Schiffe, die der Ehe folgten, befreite. Vermochte das argivische Heer die unerbittlichen Götter mit dem Blut einer Jungfrau zu besänftigen? Genügte für tausend Schiffe ein (einziges) Haupt?
Aber damit wird deutlich, dass er überhaupt eine senecanische Tragödie schreiben wollte: Er behandelt einen antiken Mythos, den Tod des Achilleus durch die List des Paris, worin er der bei Hyginus, myth. 110, und Dares, dem spätantiken Verfasser des Troja-Romans De excidio Troianorum, überlieferten hellenistischen Variante folgte, und verlässt an keiner Stelle den Stoff, die Gedankenwelt und Dramaturgie seines antiken Vorbildes. Nur die Orthographie, v.a. die der Eigennamen, ist noch ganz mittelalterlich.30
In ähnlich nahem Anschluss an SenecaSeneca verfasste dreieinhalb Jahrzehnte später, im Jahr 1426 oder 1429, Gregorius Corrarus (Gregorio Correr) seine Progne-Tragödie, ein Schauerdrama nach Ovids Metamorphosen.31
Diese vollständige Seneca-ImitationSenecaImitation erwies sich jedoch als eine literarische Sackgasse. Jeder der folgenden neulateinischen Tragödiendichter versuchte sich in neuen Inhalten und Formen. Die einzigen Konstanten blieben der iambische TrimeterIambusTrimeter mit den schon erwähnten Lizenzen, die Fünfaktstruktur und die eingeschobenen ChorliederChor in den erprobten lyrischen Maßen, die wie schon im Mittelalter fast fehlerlos beherrscht wurden.
Im 16. Jahrhundert schwoll die Zahl der lateinischen Dramen immer mehr an. Sixt BirckBirck, Sixt (1500–1554), Gymnasialdirektor in Augsburg, übersetzte seine für den Unterricht gedachten Bibeldramen nachträglich aus dem Deutschen ins Lateinische. Die belehrende Absicht wird schon im erweiterten Titel seiner IudithBirck, SixtDrama comicotragicum Iudith ausgesprochen. In der Metrik folgte er, ob aus mangelnder Fähigkeit oder wegen der schulischen Verwendbarkeit, geradezu ängstlich nur der einen Hauptregel des iambischen TrimetersIambusTrimeter, die er fehlerlos und ohne die bisherigen Lizenzen anwandte. Er beschränkte sich jedoch mit nur wenigen Ausnahmen auf reine IambenIambus bzw. SpondeenSpondeus und ließ nur sehr selten die Teilung von LongaLongum, geteiltes“ und BreviaBreve, geteiltes“, niemals ElisionenElision zu. Zum Eindruck der Gleichförmigkeit der Verse trägt der fast durchgehende Zeilenstil bei. Prosodische Fehler wie in V. 10 vulneribus sind außerordentlich rar. Vgl. den PrologBirck, SixtDrama comicotragicum Iudith:
| Plerisque controversia est mortalibus, | |
| nec dum ratum, vel expeditum mentibus, | |
| num fas sit arma Christiano sumere. | |
| Mundus furit, nec ullum fit piaculum, | |
| in quoslibet ferrum impium constringere. | 5 |
| Frater fratris mucrone, vah, confoditur. | |
| Erecta signa utrinque picta convolant | |
| Cruce, auspicem et Christum miles exercitu | |
| Utroque sperat partibus suis fore, | |
| Saevis cadunt cives suis vulneribus32. | 10 |
Für die meisten Menschen gibt es eine Streitfrage, und es ist noch nicht entschieden oder zu Ende gedacht, ob es Christen erlaubt ist, die Waffen zu ergreifen. Die Welt ist der Raserei verfallen, und es gilt nicht als Sünde, gegen jedermann sein ruchloses Schwert zu zücken. Der Bruder wird, ach, vom Dolch des Bruders durchbohrt. Von beiden Seiten stürmen die Fahnen mit aufgemaltem Kreuz heran, und in beiden Heeren hofft der Soldat, dass Christus seiner Partei den Segen gibt. Bürger fallen von eigenen grausamen Wunden.
Das erreichte Niveau war jedoch mangels geeigneter Metrikhandbücher und der sehr beschränkten Möglichkeit, sich Handschriften der Vorgänger zu beschaffen, nicht selbstverständlich. Der am Anfang dieses Beitrags erwähnte TelesioTelesio, AntonioImber aureus hat sich 1529 in seinem Imber Aureus, der Tragödie der Danae, die von ihrem grausamen Vater Acrisius in einem eisernen Turm gefangen und von Juppiters goldenem Regen gerettet wird, offenbar weniger als LoschiLoschi, Antonio und CorrerCorrer (Corrarius), Gregorio von der NachahmungImitation SenecasSeneca leiten lassen. Seine iambischen TrimeterIambusTrimeter – die er in den Marginalnotizen gelegentlich auch IambusSenarSenare nennt, wovon sich noch der Herausgeber Jan-Wilhelm Beck 2000 hat irreführen lassen – sind zwar an vielen Stellen ungefüge. Außer den schon erwähnten zahlreichen über die Wortenden geteilten LongaLongum, geteiltes“ und BreviaBreve, geteiltes“ fallen zäsurlose VerseZäsurTelesio, AntonioImber aureus33 und positionsbildende muta cum liquida über die Wortgrenze auf, die sonst vermieden werden, z.B. 70 funeré tristem, 71 velleré sparsas, 72 tunderé plangoribus. Falsche Prosodien sind immerhin sehr selten.
Im Sprachstil ist TelesioTelesio, AntonioImber aureus weit von SenecaSeneca entfernt, ist aber andererseits erfolgreich in dem Versuch, dem antiken, bisher nicht dramatisch behandelten Mythenstoff eine ungewöhnliche Form zu geben. Er hat zwar die Standardrollen wie den Boten und die Amme und den Wechsel zwischen Monologen und Dialogen beibehalten und in den Chören wenig metrische Variation gesucht: Es sind PherekrateenPherecrateus, iambischeIambus Mono- und DimeterIambusDimeter und trochäische DimeterTrochaeusDimeter. Der Chor nimmt, wie Horaz (Ars poetica 193HorazArs poetica) empfohlen hatte, an der Handlung teil: Er ruft am Ende des 1. Aktes Juno zu Hilfe für Danae, im 2. Akt nimmt er am Dialog teil, im 3. Akt führt er ansatzweise einen Dialog mit den Zyklopen, die ihren Lohn für die schnelle Erbauung des eisernen Turmes verlangen, in dem Danae bereits eingekerkert ist.34
Aber vor allem hat TelesioTelesio, AntonioImber aureus zugunsten wirksamer Szenen die Einheit von Ort und Zeit und im langen 3. Akt die Gattungsidentität aufgelöst. Dieser vielteilige 3. Akt entwickelt sich zu einem kleinen Drama in sich: Am Anfang staunt Acrisius über die Schnelligkeit, mit der sein Wunsch nach einem unbezwinglichen Kerker für seine Tochter erfüllt wurde, dankt überschwänglich Vulkan und lädt die Zyklopen ein, sich ihren Lohn für die harte Bauarbeit abzuholen. Aber dann beginnt eine burleske Szene, wie sie der antiken und bisherigen neulateinischen Tragödie fremd war: Das Festgelage der Zyklopen geht in ein wüstes Bacchanal über, das mit dem Tod des Polyphemus und seiner Verhöhnung in einem anapästischenAnapaestus Amoibaion endigt. Als der vor Entsetzen geflohene Acrisius zurückkehrt, erkennt er zusammen mit dem Chor, dass er durch seinen Wunsch aus dem Glück ins Unglück gestürzt ist. Das Ende dieses Aktes bilden der Monolog des verzweifelten Acrisius und ein ChorliedChor über die Macht der Fortuna in katalektischen trochäischen DimeternTrochaeusDimeterkatalektisch. Diese Struktur ist ohne Vorbild in der senecanischen TragödieSeneca, aber auch in der antiken Komödie.
Das Versmaß wechselt mehrere Male, aber immer entsprechend der Handlung oder der Stimmung. In einer Randbemerkung weist der Verfasser selbst darauf hin, dass der HinkiambusIambusCholiambus passend ist für das Dankgebet an den hinkenden Gott Vulcanus. Aber gleichzeitig ist dieses Metrum das der Spottgedichte, weil hier die Dankbarkeit des Acrisius im Widerspruch zu dem Erfolg seines Wunsches steht.
Den Weg zur Gattungskreuzung ist der Elsässer Johannes SapidusSapidus, JohannesAnabion (Witz) in seinem mit 1915 Versen überlangen Lazarus-Drama Anabion von 1540 weitergegangen.Sapidus, Johannes35 Die Episode von der Krankheit und Auferweckung des Lazarus, die schon im Johannes-Evangelium (Joh. 11) personenreich ist, hat Sapidus selbst nicht ganz zutreffend als Komödie oder Tragikomödie bezeichnet.36 Denn die Handlung ist außerdem mit Elementen des Passionsspiels angereichert. Aus der Komödie stammen besonders die Intrigenhandlung, das Sklavenpersonal, die Schimpfdialoge und die Drastik in Handlung und Sprache. Die komischen Elemente mit ihrer Verspottung des Teufels vertragen sich jedoch mit der mittelalterlichen fabula sacra, der man dieses Stück zurechnen kann.
SapidusSapidus, Johannes verwendet zwar iambische TrimeterIambusTrimeter, die er wie TelesioTelesio, AntonioImber aureus bisweilen auch iambische SenareIambusSenar nennt und mit den gleichen Lizenzen wie alle seine Vorgänger verwendet, zeigt aber durch die Verwendung typischer Komödienmetra wie des trochäischen SeptenarsTrochaeusSeptenar und des iambischen OktonarsIambusOktonar, dass er PlautusPlautus und TerenzTerenz kennt – schon der Vorspann ist nach dem Vorbild der Terenz-Handschriften angelegt. Dass SapidusSapidus, Johannes auf einen ChorChor verzichtete, könnte zwei Gründe haben: ein Chor passt weder zur Gattung des Passionsspiels noch zur antiken Komödie.
George BuchananBuchanan, George, der große schottische Gelehrte, Theologe und Dichter (1506–1582), lehrte zwischen 1539 und 1544 in Toulouse am Collège de Guienne.Buchanan, GeorgeJephthes37 Als Lehrer war er verpflichtet, jedes Jahr eine Tragödie in lateinischer Sprache für das alljährliche Schulfest zu verfassen und aufzuführen. Außer zwei Übersetzungen von Tragödien des Euripides (Medea und Alcestis) verfasste er den Jephthes (1450 Verse) über einen Stoff aus dem Alten Testament (nach Richter 11) und Baptistes Buchanan, GeorgeBaptistes(1360 Verse) über den Tod Johannes des Täufers (nach Matth. 14).Buchanan, GeorgeJephthes38 Für ihr klassisches Latein, das von der gesamten klassischen Latinität inspiriert ist,PlautusAmphitruoBuchanan, ሴiሴGeorgeJephthesሴiሴ39 aber ohne gelehrte Anspielungen auskommt, für die Flüssigkeit der Verse, die zwar noch die bekannten metrischen Lizenzen nutzen, aber viel seltener als alle Vorgänger, und die elegante Rhetorik sind sie zu Recht berühmt. Vgl. den von einem Engel gesprochenen Prolog des Jephthes (aufgeführt 1542):
| Magni tonantis huc minister aliger, | |
| Coelo relicto, mittor Isaci ad lares, | |
| Sŏlumque promissum Isaci nepotibus, | |
| Sŏlum regendis destinatum gentibus, | |
| Si pacta sacri intaminata foederis | 5 |
| Servasset: arma sed modò quod Ammonia | |
| Expavit arcto servitutis sub iugo, | |
| Tulitque, quicquid triste, crudele, asperum, | |
| Iratus audet victor, aut victus timet. | |
| Hac clade fracta gens rebellis vix Deum | 10 |
| Agnoscere patrum coepit […] |
Ich, der geflügelte Diener des großen Donnerers, habe den Himmel verlassen und werde hierher zum Hause Isaaks und in das Land gesandt, das den Enkeln Isaaks verheißen war, und in das Land, das der Herrschaft über die Völker bestimmt war – wenn es den Vertrag des heiligen Bündnisses unversehrt bewahrt hätte. Aber weil es vor kurzem die Waffen des Ammon [Baal] unter dem drückenden Joch der Sklaverei fürchtete und ertrug, wagte der erzürnte Sieger oder fürchtet der Besiegte alles, was traurig, grausam und hart ist. Durch die Niederlage gebrochen begann das aufrührerische Volk kaum den Gott der Väter zu bekennen […]
Aber Buchanan hat nicht versucht, die bisherigen metrischen Formen und die metrische Komposition seiner Dramen zu variieren – selbst die Erweiterung von fünf zu sechs Akten ist damals keine Neuigkeit.IambusTrimeter40 Die Sprechverse sind ausschließlich in iambischen Trimetern gehalten, die – übrigens wunderbar lyrischen – ChorliederChor in den damals üblichen lyrischen Metra, und die Zahl der Akteure ist auf wenige Personen konzentriert. Den Streit der beiden von ihm in die Handlung des BaptistesBuchanan, GeorgeBaptistes eingefügten Rabbiner Gamaliel und Malchus über Johannes den Täufer als öffentliche Gefahr und die erregte Debatte zwischen Herodes und seiner Frau über die Maximen königlicher Macht sind meisterhaft dramatisiert, überschreiten aber an keiner Stelle die damals rezipierten Regeln der Tragödie.
So wenden wir uns seinem damaligen Kollegen am Collège de Guienne, Marc Antoine MuretMuret, Marc Antoine (1526–1585), zu, der eine ganz andere, auf das klassische französische Drama führende Richtung einschlug.Muret, Marc AntoineJulius Caesar41 Sein im Jahr 1544 verfasster und 1547 veröffentlichter Julius Caesar ist ein historisches Drama, das von zwei gegensätzlichen Themen beherrscht wird, dem Ruhm Caesars und dem Kampf um die Freiheit.Dati, LeonardoHiensal42 Wahrscheinlich verband Muret mit dem historischen Stoff ein eigenes, politisches Anliegen, den Kampf um die Befreiung von drückender Herrschaft.
In der Einleitung hebt er selbst die Herrschaft der ratio und das Vermeiden von Affekten, von Wahnsinns- und Unterweltsszenen hervor. Darum fehlt auch ein Götterapparat. Das Personal ist aufs äußerste reduziert. Aus dem alten Tragödienfundus stammt nur die Amme als Vertraute von Caesars Gattin Calpurnia.
Die metrische Komposition ist noch konventionell und zusätzlich auf schlichteste Formen reduziert. Die Monologe und Dialoge sind mit einer Ausnahme nur in iambischen TrimeterIambusTrimetern mit den üblichen Lizenzen gehalten, aber durch regelmäßige ZäsurZäsuren gefügiger und durch häufige EnjambementEnjambements effektvoller gestaltet. Durch enge Anlehnung an SenecaSenecas Tragödienstil erreicht er es, in wuchtigen Versen dem durchgehend hohen Pathos Ausdruck zu verleihen. Vgl. Caesars Rede in V. 7–19Muret, Marc AntoineJulius Caesar:
| Quacunque Nereus margines terrae premit, | |
| reges vel ipsi Caesaris nomen timent. | |
| Numerent triumphos, cum volent, alii suos, | |
| seque a subactis nominent provinciis: | 10 |
| plus est vocari Caesarem. Quisquis novos | |
| aliunde titulos quaerit, is jam detrahit. | |
| numerare ductu vis meo victas plagas? | |
| Percurrito omnes. Ipsa victrix gentium | |
| mihi Roma cessit. Ille tam magnus gener, | 15 |
| ut pene nomen duceret jam impar sibi, | |
| terra marique fusus agnovit meas | |
| praestare vires: quemque noluerat parem, | |
| tulit priorem. |
Wo immer (der Meergott) Nereus die Ränder der Erde bedrängt, fürchten sogar die Könige den Namen Caesars. Mögen andere, wenn sie wollen, ihre Triumphe aufzählen und sich nach den Provinzen, die sie unterworfen haben, benennen: Caesar zu heißen gilt mehr. Wer auch immer von anderswoher neue Titel sucht, der mindert sie schon. Willst du die Länder zählen, die unter meiner Führung besiegt wurden? Dann zähle sie alle auf. Selbst Roma, die Bezwingerin aller Völker, hat sich mir ergeben. Jener so großartige Schwiegersohn [Cn. Pompeius Magnus] hat, um fast schon zu glauben, dass sein Name ihm nicht gebührt, anerkannt, als er auf Land und Meer besiegt war, dass meine Macht stärker ist. Wen er als Gleichrangigen nicht dulden wollte, den ertrug er als Überlegenen.