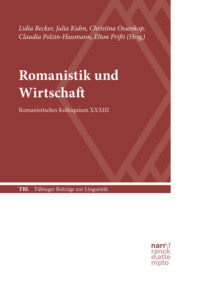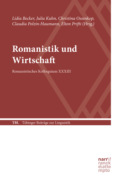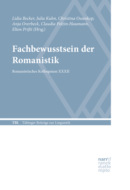Kitabı oku: «Romanistik und Wirtschaft», sayfa 6
3 Der Sprachgebrauch der Gig-Economy
Im Rahmen der Betrachtung des Sprachgebrauchs auf den beiden Plattformen DELIVEROO und FOODORA sei der Blick zunächst auf die Bezeichnungen der Fahrrad-Kuriere gerichtet. Im Französischen wird auf beiden Plattformen der Begriff coursier verwendet. Im Larousse wird eine Definition angegeben, die die Übersetzung mit ‚Laufjunge‘ nahelegt:1 „Employé chargé des diverses courses à faire en ville pour une administration, un commerçant, un atelier etc. Le féminin coursière est rare.“ Die gleiche Bedeutung wird auch im TLFI angegeben.2 Im Petit Robert wiederum wird der Begriff in dieser Bedeutung nicht aufgeführt. Die neosemantisierte Form findet auch Eingang in Komposita, so in coursiers partenaires. Darüber hinaus werden die Kuriere bei DELIVEROO als biker(s) bezeichnet. Im Petit Robert wird dieser Begriff zwar aufgeführt, allerdings als Ableitung von amer. Engl. bike « moto, bécane » und somit anderer Bedeutung (Étym. 1987).3 Im Larousse sowie im TLFI wird biker nicht erfasst.
Im Italienischen wird auf beiden Plattformen der Begriff rider verwendet, mitunter mit dem Firmennamen als determinierender Konstituente: rider FOODORA. Rider ist in diesem Jahr als Neologismus im Treccani aufgenommen worden.4
rider s. m. e f. Fattorino che si sposta a bordo di una bicicletta equipaggiata per la consegna a domicilio degli articoli acquistati dai clienti; ciclofattorino. […] Dall’ingl. rider (‚chi va a cavallo, in bicicletta, in motocicletta‘), con una evidente restrizione e specializzazione di significato rispetto alla voce ingl.
Im Zingarelli ist rider nicht erfasst bzw. nur die Kollokation free rider. Zu rider besteht – insbesondere im pressesprachlichen Gebrauch5 – das Synonym ciclofattorino, das der Treccani ebenfalls als Neologismus verzeichnet.6 Im Zingarelli wird diese Neubildung noch nicht erfasst. Mit coursier, biker und rider sind drei der vier Bezeichnungen der Kuriere durch Bedeutungsverschiebung gegenüber einer eigenen oder fremdsprachlichen Form entstanden. Eine ausdrucksseitige Innovation ist lediglich ciclofattorino.
Zentrales Argument bei der Akquise der Fahrradkuriere ist das Versprechen von Flexibilität und Autonomie. Dies geht so weit, dass Autonomie als Profileigenschaft gefordert wird. Bei FOODORA wird unter den Anforderungen, die an die Mitarbeit gestellt werden, Folgendes genannt: être autonome. Die Belege sehen für die beiden Plattformen DELIVEROO (D) und FOODORA (F) im Einzelnen wie folgt aus:
Französisch:
Travaille en toute liberté (D)
Flexibilité, indépendance, revenus attractifs (D)
Tu es libre de rouler quand tu le souhaites et selon tes besoins (D)
Choisis quand livrer (D)
Vous choisissez quand vous souhaitez travailler en fonctions de vos disponibilités (F)
Vous choisissez le mode de livraison qui vous convient […] (F)
Besoin d’un boulot sympa et flexible ? (F)
Italienisch:
Lavoro flessibile (D)
Flessibilità, ottimi guadagni e un mondo di vantaggi per te (D)
Scegli tu quando lavorare (D)
Sarai un lavoratore autonomo libero di lavorare in base alla tua disponibilità (D)
Decidi tu quando lavorare (F)
Über den „wahren“ semantischen Gehalt der Wortfamilie um Flexibilität schreibt Trifone (2007, 163):
[…] le parole-simbolo del nuovo mercato del lavoro, flessibile e flessibilità, con i neologismi derivativi flessibilizzare e flessibilizzazione, sono a ben guardare sinonimi molto più astuti di licenziabile, licenziabilità, licenziare e licenziamento.
Neben der Herausstellung von Flexibilität und Autonomie zeichnet sich der Sprachgebrauch auf den genannten Plattformen sowohl für das Italienische als auch für das Französische durch eine Vielzahl an vergemeinschaftenden Formulierungen aus.
Französisch:
Tu feras partie de la plus grande communauté de livreurs en France (D)
Rejoignez notre communauté de coursiers ! (F)
Une seule équipe (F)
Vous recherchez […] une équipe sympa ? (F)
Italienisch:
Unisciti a noi (D)
Diventa parte del team FOODORA (F)
Entra a far parte della community dei rider (F)
An der Grenze zwischen vergemeinschaftendem und verdunkelndem Sprachgebrauch liegen die Verbalformen bzw. deren Präpositionen Vieni a lavorare come rider con FOODORA (F) und Pourquoi travailler avec nous (D). Im Petit Robert heißt es travailler pour un patron, im Zingarelli lavorare per un azienda. Das Problem eines euphemistischen und verschleiernden Sprachgebrauchs liegt auch vor bei équipement de qualité (D) bzw. equipaggiamento di qualità (D), deren Referent eine Uniform ist. Gleichfalls irreführend sind die Bezeichnungen prestataire indépendant (D) ‚unabhängiger Dienstleister‘ und lavoratore autonomo (D). Bereits in ihrer frühen Studie aus dem Jahr 1964 stellte Galli deʼ Paratesi fest, in welch hohem Maße das Themenfeld des Arbeitsmarktes (inklusive der Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, den Aspekten Einstellung, Entlassung und Bezahlung) von Euphemismen geprägt ist: „Nei rapporti tra le ditte e i lavoratori sono molti gli eufemismi circa i concetti di lavoro, assunzione, pagamento e simili.“ (Galli deʼ Paratesi 1964, 137) Als Beispiele euphemistischen Sprachgebrauchs führte sie collaborazione für lavoro, inserimento für assunzione und livello retributivo für paga an. Im Zusammenhang mit den neuen Arbeitsformen, die in der Folge verschiedener gesetzgeberischer Maßnahmen7 zur Flexibilisierung der Arbeit um die Jahrtausendwende in Italien entstanden sind (z. B. die Zeitarbeit), schreibt Trifone (2007, 161):
La nuova disciplina del lavoro temporaneo e atipico, la conseguente nascita delle agenzie per il cosiddetto „lavoro in affitto“, la parallela crescente diffusione di lavoratori precari hanno determinato lo sviluppo di una sorta di gergo interinalese, fatto di termini e locuzioni che hanno per lo più […] una componente eufemistica, che tendono cioè a occultare o edulcorare una realtà di fatto spiacevole e talvolta drammatica.
In besonderer Weise betroffen von der euphemisierenden Einführung neuer Begrifflichkeiten sind Berufsbezeichnungen. Trifone (2007, 160) schreibt ihnen eine aufwertende, mitunter rehabilitierende Funktion zu, die in seinen Beispielen von Anglizismen erfüllt wird:
Se persino il caporeparto […] diventa un teamleader, si capisce che il bistrattato venditore porta a porta cerchi di riabilitarsi assumendo la definizione ben più professionale di seller door to door.
Für den Wechsel im Bereich der Berufsbezeichnungen gibt es in historischer Sicht viele Vorläufer. Wahrgenommene Bedeutungsverschlechterungen führen im Zeitablauf zu regelrechten Bezeichnungsketten, wobei die jeweils neue Bezeichnung zur Aufwertung des entsprechenden Berufs beitragen soll (Galli deʼ Paratesi 1964, 137). Als Beispiel möge die folgende Kette dienen: serva → donna di servizio → donna → domestica → cameriera → persona di servizio (Galli deʼ Paratesi 1964, 137). Im weiteren Verlauf ist sie um den Ausdruck COLF (collaboratore familiare) ergänzt worden. Neben der aufwertenden und euphemistischen Funktion sieht Dardano (2000, 327) darin auch eine hierarchisierende Funktion am Wirken. Diese bildet letztlich die zunehmende und immer feingliedrigere Spezialisierung und den Zuschnitt einzelner Tätigkeiten in der Gesellschaft ab:
La causa di tali cambiamenti […] è eufemistica e al tempo stesso gerarchizzante: la sistemazione puntigliosa delle sempre nuove specializzazioni e mansioni nella società di oggi comporta lo sviluppo di neologismi, scemi classificatori e iperonimi. I centri di potere producono di continuo eufemismi.
Wenn es auch im vorliegenden Fall weniger um die Umbenennung einer bestehenden Tätigkeit geht als vielmehr um die Benennung eines neu entstandenen „Berufsbildes“, ist doch Crisafulli (2004, 96) zuzustimmen, der über den sog. nominalismo schreibt: „Il nominalismo crede nel potere magico del nominare, è un idealismo linguistico […].“
Wenden wir uns den euphemisierenden Begrifflichkeiten équipement de qualité / equipaggiamento di qualità sowie prestataire indépendant / lavoratore autonomo zu. Insofern als hier in gewisser Weise eine Form der Tabuisierung vorliegt, könnten die Begriffe in die Nähe der political correctness gerückt werden. Hier besteht allerdings ein zentraler Abgrenzungsfaktor. Denn während die political correctness den sprachlichen Schutz von Minderheiten im Sinne hat, geht es im vorliegenden Fall um die Verschleierung der direkten Bezeichnung eines Sachverhalts (Reutner 2009, 369). In ihrer Studie zu französischen und italienischen Euphemismen aus dem Jahr 2009 etabliert Reutner eine Kategorie, die sie mit dem Etikett „Ethik ohne Moral“ versieht (Reutner 2009, 368) und die hier zum Tragen kommt. Ethik ist hier im Sinne von Verhaltenskodex zu verstehen, Moral wiederum als gemeinwohlorientierte Moral und nicht als individuelle Geschäfts- bzw. Wohlstandsmoral (Reutner 2009, 368). Die beobachtete Verschleierung lässt sich zudem mit dem Konzept des doublespeak von Lutz (1989, 1) erfassen. Es ist zu verstehen als:
[…] language that makes the bad seem good, the negative appear positive, the unpleasant appear attractive or at least tolerable. Doublespeak is language that avoids or shifts responsibility, language that is at variance with its real or purported meaning.
An anderer Stelle spricht Lutz (1989, 11) von „language of nonresponsibility“. Doublespeak kommt in verschiedenen Ausprägungen vor (Lutz 1989, 2-7). Eine relevante Kategorie sind bei Lutz die Euphemismen, die mit der Absicht des Täuschens hervorgebracht werden.
4 Schlussbetrachtung
Der Sprachgebrauch der Gig-Economy lässt sich – wie derjenige anderer wirtschaftlicher Systeme auch – mit Lutz (1996, 128) wie folgt beschreiben:
Economist are in the business of creating verbal maps. That is, they create a world with words. As with all verbal maps, there is no necessary connection between their words and the reality they purport to represent.
Diese spezifische „Welt aus Worten“ ist in lexikalischer Hinsicht durch die Versprachlichung der Aspekte „Flexibilität“ und „Autonomie“ geprägt. Wie wir anhand der Bezeichnungen der Kuriere gesehen haben, sind auch Bedeutungserweiterung und Entlehnungen betroffen, hier insbesondere eigenständige semantische Entwicklungen in der Empfängersprache. Schließlich werden Euphemismen gewählt, und zwar weniger zum Schutz der Interaktanten als vielmehr zur Verschleierung wahrer Tatsachen. Es gilt allerdings zu bedenken, dass ein Ausdruck nicht per se als Euphemismus zu betrachten ist, sondern erst im Sprachgebrauch zu einem Solchen wird, wie Galli deʼ Paratesi (1964, 9) ausführt:
Infine è importante tenere presente che di una parola non si può dire che essa è un eufemismo in sé, ma soltanto che essa può avere un uso eufemistico. Un termine isolato dal contesto difficilmente può essere un eufemismo poiché l’essere eufemismo non è una proprietà insita nella parola, come le qualità fonetiche o il genere, ma è un valore che la parola assume nell’uso che se ne fa rispetto al contesto verbale in cui la si utilizza e alla situazione in cui la si usa. (Galli deʼ Paratesi 1964, 9)
Wenn auch die einzelsprachliche Ausgestaltung ebenso wie die historischen Bezüge zu weiteren „kritisierten“ Sprachformen (man denke an die sog. anti-lingua oder das sog. Hexagonal) unterschiedlich sein mögen, ist es doch Aufgabe der romanistischen Linguistik, die in der Sprache sichtbaren Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungsprozesse in vergleichender Perspektive in den Blick zu nehmen und hierfür übergreifende Deutungsversuche anzubieten.
Literatur
Baucher, Bérangère et al. (eds.) (2017): Le Robert illustré, Paris, Dictionnaires Le Robert.
Canobbio, Sabina (2009): „Confini invisibili: l’interdizione linguistica nell’Italia contemporanea“, in: Iannàccaro, Gabriele/Matera, Vincenzo (eds.): La lingua come cultura, Turin, UTET, 35-47.
Crisafulli, Edoardo (2004): Igiene verbale. Il politicamente corretto e la libertà linguistica, Firenze, Vallecchi.
Dardano, Maurizio (2000): „Lessico e semantica“, in: Sobrero, Alberto A. (ed.): Introduzione all’italiano contemporaneo. Le strutture, Rom/Bari, Laterza, 291-370.
Fanfani, Pietro/Arlìa, Costantino (31890): Lessico dell’infima e corrotta italianità, Mailand, Paolo Carrara.
Galli de’ Paratesi, Nora (1964): Semantica dell’eufemismo. L’eufemismo e la repressione verbale con esempi tratti dall’italiano contemporaneo, Torino, Giappichelli.
Jacquet, Denis/Leclercq, Grégoire (2016): Uberisation: Un ennemi qui vous veut du bien? Paris, Dunod.
Lutz, William (1996): The New Doublespeak: Why No One Knows What Anyone's Saying Anymore, New York, Harper Collins.
Lutz, William (1989): Doublespeak. From "Revenue Enhancement" to "Terminal Living". How government, business, advertisers, and others use language to deceive you, New York et al., Harper & Row.
Merle, Pierre (2011): Politiquement correct. Dico du parler pour ne pas dire, Paris, Les Éditions de Paris/Chaleil.
Reutner, Ursula (2009): Sprache und Tabu: Interpretationen zu französischen und italienischen Euphemismen, Tübingen, Niemeyer Verlag.
Teboul, Bruno / Picard, Thierry (2015): Uberisation = Économie déchirée?, Annecy, Kawa.
Trabant, Jürgen (2017): „Die Erfindung der Sprachwaschmaschine“, in: Zeitschrift für Ideengeschichte, XI/1, 123-126.
Trifone, Pietro (2007): „Call center. Fenomenologia del nuovo latinorum“, in: Trifone, Pietro (ed.): Malalingua. L’italiano scorretto da Dante a oggi, Bologna, Il Mulino, 155-163.
Internet-Links [letzter Zugriff jeweils 21.11.2018]
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/sharing-economy-53876
https://www.zeit.de/arbeit/2017-11/foodora-fahrer-proteste-gewerkschaft-verhandlungen
https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2017-11/amazon-flex-lieferservice-privatleute-berlin
https://www.mckinsey.com/mgi/overview/in-the-news/exploding-myths-about-the-gig-economy
https://www.zeit.de/arbeit/2017-10/kurierfahrer-foodora-arbeitsbedingungen-gewerkschaft-protest
http://www.treccani.it/vocabolario/uberizzazione_res-5c91c9a5-89ee-11e8-a7cb-00271042e8d9_%28Neologismi%29/ [letzter Zugriff am 21.11.2018]
https://corrieredibologna.corriere.it/corriereimprese/b_L11_160711SBBologna_BOOKMUL.pdf
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/coursier/19946?q=coursier#19837
http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1504093530
https://pr12.bvdep.com/robert.asp
http://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/RIDER/
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/Neologismi2.html
Semantisch-konzeptuelle Asymmetrien zwischen deutscher und spanischer Wirtschaftssprache
Franz Rainer
1 Einleitung
Zumindest für Linguisten ist es eine Binsenweisheit, dass sich der Wortschatz verschiedener Sprachen nicht nur durch die Bezeichnungen für Begriffe unterscheidet, sondern auch die begriffliche Ebene selbst unterschiedlich gegliedert sein kann. So finden wir Deutschsprachige mit einem einzigen Wort Fisch das Auslangen, wo man sich im Spanischen für pez oder pescado entscheiden muss, je nachdem, ob der Fisch noch im Wasser schwimmt oder aber bereits im Fischgeschäft, in der Pfanne oder auf dem Teller liegt. Im Vergleich zur Gemeinsprache unterscheidet sich der Wortschatz vieler Fachsprachen begrifflich wesentlich weniger von Sprache zu Sprache, was auf den jahrhundertelangen geistig-sprachlichen Austausch zwischen den europäischen Kulturen zurückzuführen ist. Allerdings gibt es auch in diesem Bereich große Unterschiede von Fach zu Fach. Während die Juristerei trotz aller Bemühungen, supranationales Recht zu etablieren, weiterhin stark in nationalen Traditionen verhaftet bleibt, bieten die Wirtschaftswissenschaften ein Bild weitgehender begrifflicher Gleichschaltung. Diese begriffliche Homogenität bildete sich in diesem Fach allmählich im Laufe der Neuzeit heraus, als die Ausarbeitung wirtschaftlicher Doktrinen noch eine wesentlich polyphonere Angelegenheit war als heute (vgl. Rainer 2017). In chronologischer Reihenfolge dominierte zuerst das Italienische, dann das Französische und schließlich das Englische, wobei im 19. Jahrundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch der Beitrag des Deutschen nicht unterschätzt werden sollte. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg erlangte das Englische seine Stellung absoluter Hegemonie. Seitdem begnügen sich die übrigen Sprachen weitgehend damit, das auf Englisch Vorgekaute jeweils mit eigenen Mitteln wiederzukäuen. Aus der Sicht des Lexikographen oder Übersetzers hat dieser Umstand den Vorteil, dass sich die Suche nach einer Entsprechung meistens auf die Bezeichnungsebene beschränkt. Die folgenden Beispiele mögen genügen, um den allgemeinen Fall zu veranschaulichen:1
| Monopol, Duopol, Oligopol | monopolio, duopolio, oligopolio |
| Handelsbilanz | balanza comercial |
| Bad Bank, Abbaubank | banco malo, banco tóxico |
| Abwrack-, Verschrottungsprämie | prima de/por desguace |
| Marketing | marketing, mercadotecnia |
| abschöpfen | descremar |
| usw. |
Im Allgemeinen ist die begriffliche Isomorphie in den akademischen Sphären der Wirtschaftssprache am größten, während wir in jenen Bereichen, die näher an der wirtschaftlichen Praxis liegen, durchaus begriffliche Asymmetrien antreffen können. Im vorliegenden Beitrag will ich versuchen, Asymmetrien, die mir im Zuge der Arbeit an einem deutsch-spanischen Wirtschaftswörterbuch2 begegnet sind, zu systematisieren.
Betrachten wir zur Einstimmung ein paar konkrete Beispiele. Für das deutsche Wort Erholungsurlaub bietet Pons3 als einzige Entsprechung vacaciones (de reposo). Der Duden4 definiert das Wort als „der Erholung dienender Urlaub“. Wenn man sich die Verwendung dieses Wortes jedoch etwas näher ansieht, bemerkt man, dass es sich auf zwei verwandte, aber dennoch unterschiedliche Begriffe beziehen kann. Es kann einerseits jeden Urlaub bezeichnen, der der Erholung dient („Ein kurzer Erholungsurlaub täte ihr gut.“5), andererseits ist es im Arbeitsrecht aber auch der Fachausdruck für den langen Urlaub, der Arbeitnehmern einmal im Jahr zusteht („Der ‚normale‘ Urlaub wird auch als Erholungsurlaub bezeichnet“). Während man Erholungsurlaub im ersten Sinn mit vacaciones de reposo, oder geläufiger mit vacaciones de descanso übersetzen kann, ist die Entsprechung im arbeitsrechtlichen Sinn vacaciones anuales („Las vacaciones anuales deben disfrutarse por el trabajador dentro del año natural.“). Mit der Unterscheidung von zwei Begriffen kann dieses Problem also aus lexikographischer Sicht einfach gelöst werden, denn beide Begriffe existieren identisch in den deutsch- und spanischsprachigen Ländern.
Dasselbe gilt auch für unser nächstes Beispiel, Bierbrauer. Pons gibt als einzige Entsprechung cervecero. Diese deckt jedoch nur einen von zwei Begriffen ab, mit denen das Wort im Deutschen verbunden ist, nämlich ‚Fachmann für die Herstellung von Bier‘ (Duden). Neben dieser gibt es im Deutschen aber noch eine zweite Verwendung, in der das Wort metonymisch auf ein entsprechendes Unternehmen, eine Brauerei oder einen Bierkonzern, bezogen wird („Bierbrauer Heineken verdient deutlich mehr.“). In dieser zweiten Verwendung muss das Wort im Spanischen mit (empresa) cervecera widergegeben werden, da die im Deutschen produktive metonymische Übertragung Fachmann > Unternehmen im Spanischen nicht üblich ist. Es handelt sich hierbei um eine systematische Lücke, die alle Ausdrücke dieser Art betrifft, im Duden wie in den deutsch-spanischen Wörterbüchern.
Nicht immer jedoch lassen sich Fallunterscheidungen so eindeutig bewerkstelligen. Für den Ausdruck Wirtschaftsstandort liefert Pons die alleinige Entsprechung emplazamiento económico. Diese Bezeichnung findet man zwar schon einige hundert Male im Internet, aber praktisch nur auf Seiten, die offenkundig einen deutschen Ausgangstext ins Spanische übersetzt haben, wahrscheinlich mithilfe von Pons! Der Ausdruck ist im Spanischen nämlich unüblich. Das Problem liegt hier darin begraben, dass die deutsche Bezeichnung, die seit einigen Jahrzehnten zu einem Modewort geworden ist, eine reiche Polysemie entwickelt hat, die es erforderlich macht, von Fall zu Fall unterschiedliche spanische Entsprechungen zu suchen. Wird der Ausdruck im Zusammenhang mit der Attraktivität für Investoren verwendet, so kann destino de inversiones eine gute Lösung sein: „Deutschland hat als Wirtschaftsstandort an Attraktivität eingebüßt. / Alemania ha perdido atractivo como destino de inversiones.“ Geht es nicht nur um Investitionen, sondern allgemeiner um Geschäfte, kann lugar para hacer negocios die bessere Lösung sein: „Wien ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort. / Viena es un lugar atractivo para hacer negocios.“ In wieder anderen Zusammenhängen wird der Ausdruck jedoch auch einfach auf die Wirtschaft insgesamt bezogen und kann/sollte dementsprechend mit economía übersetzt werden: „Der Mittelstand ist eine der Stärken des Wirtschaftsstandorts Deutschland. / El Mittelstand es una de las fortalezas de la economía alemana.“ Damit sind die Übersetzungsmöglichkeiten sicher nicht erschöpft, aber es dürfte klargeworden sein, dass es auch im neuesten Wirtschaftswortschatz Ausdrücke gibt, die mangels exakter begrifflicher Entsprechung für den Lexikographen und den Übersetzer eine beträchtliche Herausforderung darstellen.
Um etwas Ordnung in die folgende Diskussion zu bringen, werde ich mich an den breiten Bedeutungsbegriff von Blank (1997, 95) anlehnen, der nicht nur den semantisch-begrifflichen Kern eines Wortes umfasst, sondern auch andere Ebenen, die für eine erfolgreiche Verwendung ausschlaggebend sind. Im Wesentlichen entspricht eine solche Auffassung Wittgensteins Gebrauchstheorie der Bedeutung, in der die Bedeutung als die Summe der impliziten Regeln betrachtet wird, die die Verwendung eines Wortes in einer Sprachgemeinschaft steuern. Konkret unterscheidet Blank folgende Ebenen:
1 Das „Semem“, d.h. das einzelsprachlich bestimmte begriffliche Wissen, also z. B. all jene Merkmale, die mir erlauben, ein Arbeitsamt von einer Jobbörse zu unterscheiden.
2 Von diesem einzelsprachlich bestimmten Wissen unterscheidet Blank strikt das außersprachliche Wissen sowie Konnotationen, die mit der persönlichen Erfahrung zusammenhängen. Das Wissen, dass sich von meiner Wohnung aus gesehen in der nächsten Querstraße ein Arbeitsamt befindet, ist außersprachliches Wissen, das nicht dem Semem von Arbeitsamt zugerechnet werden sollte. Auch Konnotationen können ganz persönlicher Natur sein: wer einmal schlechte Erfahrungen mit dem Arbeitsamt gemacht hat, wird mit diesem Wort unangenehme Gefühle verbinden. Im Gegensatz zu Blank glaube ich allerdings nicht, dass es möglich ist, das sememische Wissen wirklich klar vom Weltwissen zu trennen. Auch bei den Konnotationen finden wir denselben fließenden Übergang zwischen einzelsprachlich systematischer Festlegung und individueller Ausprägung.
3 Als dritte Ebene unterscheidet Blank das einzelsprachlich-lexikalische Wissen. Dabei handelt es sich um Wissen, das nicht den begrifflichen Kern des Wortes, sondern seine sonstigen Verwendungsbedingungen in der Sprachgemeinschaft betrifft. Blank unterscheidet zwischen interner und externer Wortvorstellung. Die interne Wortvorstellung betrifft u.a. das Wissen über Genus, Motivationsbeziehungen oder Polysemie, aber auch jenes über die Kombinierbarkeit eines Wortes (so kann man in Österreich nicht nur zum, sondern auch auf’s Arbeitsamt gehen). Die externe Wortvorstellung hingegen betrifft soziokulturelle Determinanten der Wortverwendung, also z. B. das Wissen, dass Arbeitsamt nur mehr selten verwendet wird und dass die entsprechende Institution heute in Deutschland Arbeitsagentur und in Österreich Arbeitsmarktservice, kurz AMS, heißt.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.