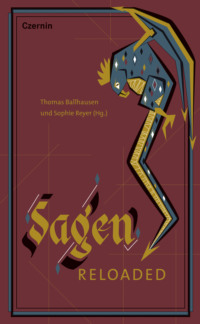Kitabı oku: «Sagen reloaded», sayfa 3
Lucas Cejpek
Die große Kurve
Das steinerne Untier mit einer Krone und einem Schweif aus Eisen sitzt in einer Nische hoch oben in der Fassade des Hauses Schönlaterngasse 7 und erinnert an das statistische Ungeheuer, das seit März 2020 auf unseren Bildschirmen erscheint. – Allein schon der Atem des Eidechsenkönigs ist tödlich, warnte der Weltweise, der 1212 von der Wiener Stadtregierung um Rat gebeten wurde. – Nach 808 Jahren ist das im Hausbrunnen verschüttete Mischwesen aus Schlange, Kröte und Hahn als gelber Kranich zu neuem Leben erwacht. Cui Hao schrieb im 8. Jahrhundert, dass die Kranichpagode von Wuhan das Einzige sei, was an den Vogel erinnere: Der gelbe Kranich ging und kehrt nicht wieder, / Weiße Wolken ziehen langsam über tausend Jahre. – Um 77 nach unserer Zeitrechnung hat Plinius der Ältere in seiner 37-bändigen Naturgeschichte zum ersten Mal den König der Schlangen beschrieben, mit einem weißen Fleck auf dem Kopf, der an eine Krone erinnert. – In mittelalterlichen Tierbeschreibungen schlüpft der Basilisk aus einem Ei, das ein Hahn gelegt und eine Schlange oder eine Kröte ausgebrütet hat. Sein Atem ist giftig, und wer in seine Augen schaut, wird zu Stein. Wenn man ihm einen Spiegel vorhält, zerplatzt das Untier vor lauter Wut in tausend Stücke. – Wie verhält sich eine Kurve zu einem Spiegel? Ein Verkehrsspiegel kann die Sichtverhältnisse verbessern, aber auch zur Entstehung von toten Winkeln führen. – Der Verlauf der roten Kurve muss abgeflacht werden, damit die nationalen Gesundheitssysteme nicht überfordert werden. Bis dahin müssen alle Gesichtsmasken tragen. – 2004 hat Georg Hofer das rotglühende Auge des Basilisken in einem Spiegel fotografiert und das Foto ins Netz gestellt. – Historische Ungeheuer wurden in vielen Naturaliensammlungen gezeigt, Kombinationen von Körperteilen unterschiedlicher Tiere. Der Basilisk hatte eine große blaue Nase und drei Hörner auf dem Kopf und Stacheln am Hinterkopf, am Hals und am Rücken. Sein Leib war mit Schuppen bedeckt wie der Leib des Pangolin, das als Überträger des Virus auf den Menschen gilt. Auf dem Wildtiermarkt von Wuhan werden neben dem Schuppentier Stachelschweine, Schleichkatzen, Waschbären, Schlangen und Fledermäuse verkauft. – Der Basilisk war in einem feuchten Keller aus dem Ei geschlüpft und hatte sich im Brunnen des Hauses Schönlaterngasse 7 eingerichtet, wo er von einer Magd entdeckt wurde. In einer Mauernische im Parterre des Nachbarhauses kauert sie neben dem Untier am Boden, das weiße Kleid wirft Falten, wie die weiße Haube des Mannes, der sich über den Brunnenrand beugt, einen Spiegel in der Hand: Der Rahmen des Spiegels ist so rot wie die Lippen der Frau. – Der Chefberater des österreichischen Gesundheitsministers trägt die Uniform des Roten Kreuzes. – Das Basiliskenhaus wurde in den Kriegsjahren 1939–45 beschädigt und 1952–53 wiederhergestellt, steht auf einer Tafel neben dem Eingangstor, die Tafel darunter erinnert an Erwin Abeles, Sissel Berkowicz, Pauline Ekstein, Rudolf Ekstein und Alois Löwy, die bis zu ihrer Deportation 1939–42 hier gewohnt haben. Eine historische Tafel wirbt für das Schreibbüro E. Petrovsky, das Geschäft Treasures & More hat Gemälde, Gläser und Porzellan in der Auslage, und in den Auslagen von Georg Fritschs Antiquariat & Buchhandel sind aufgrund des Ausnahmezustands VER SACRUM- und Die Gesellschaft-Hefte, hrsg. v. Martin Buber, liegen geblieben, in der Mitte Jörg Schlicks Plattencover KEINER HILFT KEINEM. – 2001 hat mir Jörg seinen Ausstellungskatalog mit dem Titel GLEICH SCHEUEN HIRSCHEN IN WÄLDERN VERSTECKT ZU LEBEN mit K.H.K. signiert. – H. C. Artmanns Proklamation des poetischen Actes von 1953 hängt in den Fenstern des Antiquariats, im Original und in englischer Übersetzung: Der poetische Act ist jene Dichtung, die jede Wiedergabe aus zweiter Hand ablehnt, das heißt, jede Vermittlung durch Sprache, Musik oder Schrift. – Der Basilisk machte sich durch einen infernalischen Gestank bemerkbar, der aus dem Brunnen aufstieg. Die Magd des Bäckers konnte kein Wasser schöpfen und rief um Hilfe, worauf sich der Geselle an einem Seil in den Schacht hinabließ, der Wien an der Donau mit Wuhan am Zusammenfluss von Jangtsekiang und Han-Fluss verbindet. Dort hat Hans der Gelbhaar gelernt, wie man Garnelenknödel macht: Weizen- und Maniokmehl mischen, kochendes Wasser unterrühren und Öl hinzufügen und kneten, bis der Teig glatt und glänzend ist – einen Teelöffel davon nehmen und zum Ball rollen und mit dem Messer flachdrücken – einen gehäuften Teelöffel gehackte Garnelen in die Mitte geben und den Teig mit Daumen und Zeigefinger über der Füllung falten: Ein Har Gow sollte mindestens zehn Falten haben.
Daniela Chana
Die Spinnerin am Kreuz
Zuerst dachte ich, es wäre nur dieses typisch matte Gefühl, das einen oft befällt, wenn endlich etwas eintritt, auf das man lange gewartet hat, und man feststellen muss, dass man sich über die wirklich großen Dinge im Leben nie so richtig freut. Am Tag nach der bestandenen Matura oder der Führerscheinprüfung oder der Hochzeit steht man doch wieder ganz normal auf, macht sich sein Brot mit Käse und Gurkerl, findet eine verschrumpelte Zitrone im Kühlschrank und staunt darüber, dass sich nicht alles überwältigend schön anfühlt. Stattdessen hat man auf einmal lauter neue Probleme.
Deswegen war ich nicht sonderlich überrascht, als mir in den ersten Tagen nach Leonardos Rückkehr nur die negativen Dinge auffielen. Gleich nachdem er zur Tür hereingekommen war und sich ausgezogen hatte, bemerkte ich, dass er Gesundheitsschuhe mit Einlagen trug. Freilich hatte ich immer den Traum gehabt, gemeinsam alt zu werden, mit Gesundheitsschuhen und Krücken und Ähnlichem, aber ich hatte mir das völlig anders vorgestellt. In meiner Fantasie wären wir gemeinsam am Frühstückstisch gesessen und er hätte liebevoll meine Hand gestreichelt und gesagt: »Na, jetzt wird es schon langsam Zeit, dass wir uns Gesundheitsschuhe kaufen, meine Liebste, und du bist immer noch so wunderschön wie am ersten Tag.« Danach wären wir romantisch Hand in Hand zum Orthopäden gegangen. Im Wartezimmer hätte ein Kind auf uns gezeigt und laut gesagt: »Schau, Mama, so ein uraltes Ehepaar!«, und ein Teenagermädchen, das gerade per SMS von ihrem Freund verlassen worden wäre, hätte uns traurig angeschaut und gedacht: »So wie die möchte ich auch einmal sein.« Nun waren wir aber unabhängig voneinander alt geworden, und was mich fast noch mehr ärgerte, war, dass ich mir trotzdem für unser Wiedersehen den kurzen Rock und die unbequemen Korksandalen mit der goldenen Schleife angezogen hatte, weil ich ihm gefallen wollte.
Ich redete mir ein, dass es nur eine Weile dauern würde, aber die Freude hat sich bis heute nicht richtig eingestellt. Stattdessen wird mir bewusst, wie viele Aspekte des Zusammenlebens ich in den Jahren ohne ihn komplett vergessen hatte, zum Beispiel sein lautes und holpriges Schnarchen. Wenn ich nachts aufstehe, um mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, ist er verärgert, weil ich ihn geweckt habe, und er bemerkt es nicht, wenn der Träger meines Nachthemds sexy von der Schulter rutscht. In meinen Jahren des Wartens hatte ich abends auf dem Balkon gern ein Glas Wein getrunken, melancholisch in den Himmel geschaut und war mit einer Flasche gut fünf Tage ausgekommen. Jetzt ist sofort nach dem Entkorken schon die halbe Flasche leer, weil Leonardo mittrinkt, und ich gehe allmählich dazu über, billigeren Wein zu kaufen. Letzten Samstag habe ich auch günstigere Steaks genommen als sonst und bei der Pasta am Montag mit dem Parmesan gespart.
Nicht zuletzt hat seine Rückkehr meinen Jahresumsatz geschmälert. Der Artikel über meinen Laden, der kurz nach Leonardos Verschwinden in der Bezirkszeitung erschienen war, hatte dazu geführt, dass die Höhe meiner Einnahmen zum ersten Mal in meinem Leben die steuerfreie Grenze überschritten hatte. Die Journalistin hatte die »melancholische Schönheit der Brautkleider einer einsamen Schneiderin« hervorgehoben und sogar behauptet, dass »in jedem Hochzeitskleid eine Träne« stecke. Seitdem war ich permanent ausgebucht gewesen und hatte nach Anproben nicht nur sanfte Blicke zukünftiger Ehefrauen, sondern auch enorme Trinkgelder erhalten. Manchmal war ich mir vorgekommen wie eine Art Glücksbrunnen, in den die verträumten Frauen eine Münze warfen, um ein schlechtes Schicksal für ihre Ehe abzuwehren.
Später hatte ich angefangen, für gemeinnützige Zwecke zu spenden und noch mehr gute Presse erhalten. »Die einsame Wohltäterin« hieß es in der Bezirkszeitung, und manchmal war es mir ein bisschen peinlich, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Rolle doch sehr übertrieben wurde. Andere Menschen spenden auch ihr verdientes Geld und sind sicher ebenfalls manchmal einsam oder traurig. Ich rief die Journalistin an, aber sie meinte, das sei eben Marketing und wenn ich deswegen schlechtes Gewissen hätte, sei ich ja noch heiliger als sie vermutet hätte, und dann müsse sie gleich einen weiteren, viel romantischeren Artikel über mich verfassen. Ich ließ es also dabei bewenden.
Da ich selbst nach Leonardos Rückkehr etwas reserviert war, fand ich es zunächst auch nicht komisch, dass meine Katze Penelope von Anfang an den Raum verließ, wenn er hereinkam. Auch Penelope war in der Bezirkszeitung vorgekommen, und nachdem immer mehr Kundinnen nach ihr gefragt hatten, hatte ich für sie Accounts bei mehreren sozialen Netzwerken eröffnet und ihre Katzenohren und Schnurrbarthaare in das neue Logo des Ladens integriert. Manche Kundinnen zahlten sogar einen Extra-Tarif dafür, dass Penelope bei den Terminen zur Brautkleidanprobe dabei war. Die beliebtesten Modelle wurden im Katalog mit einer Katzenpfote und dem Schriftzug »Penelope’s choice« versehen. Das alles konnte sie natürlich nicht so genau wissen, aber ich bin überzeugt davon, dass sie nach Leonardos Rückkehr spürte, wie sich die Aufmerksamkeit verlagerte und ihr plötzlich jemand das Wasser abgrub. Sie merkte zwangsläufig, dass die Buchungen nachließen, weil sie seltener von verträumten Brautjungfern auf den Schoß genommen und gekrault wurde. Ich hatte den Fehler gemacht, Leonardos Ankunft sofort in Penelopes Profilen zu posten, und von heute auf morgen war das Geschäft eingebrochen. Ob Penelope sich überhaupt an Leonardo erinnerte und ihn wiedererkannte, weiß ich bis heute nicht. Sie war noch ein kleines Kätzchen gewesen, als er ging.
Erst nach und nach begriff ich, dass ich mich auch deshalb nicht so richtig freuen konnte, weil durch Leonardos Rückkehr ein Stück von mir selbst verloren ging. Das viele Weinen nachts im Bett hatte mich auf eigenartige Weise erfüllt, die mir seither schmerzhaft fehlt. Gerade in den Nächten, in denen ich besonders lang voller Verzweiflung wachgelegen war, hatte ich mich mit etwas Höherem verbunden gefühlt, als müsste ich nur die Hand ausstrecken und könnte mich geradewegs an den Gliedern einer Kette nach oben ziehen, an deren Ende die Geister von spannenden Persönlichkeiten auf mich warteten. Meine Traurigkeit und mein Schmerz hatten mir einen Platz in einer Ahnengalerie eingeräumt, in der ich eine Nachfahrin zahlloser Einsamer und Verlassener der Geschichte war. Dieses erhebende Gefühl kann ich nicht mehr haben, wenn Leonardo neben mir schnarcht und atmet oder wenn er draußen im Wohnzimmer sitzt und die Geräusche eines Action-Films zu mir hereindringen.
Auch für meinen Körper ist es schwierig, sich wieder an seine Nähe zu gewöhnen. In den Jahren des Wartens hatte ich eine Vielzahl erotischer Träume mit langen und komplizierten Plots entwickelt, die ein schwieriges Spannungsverhältnis zur Realität aufweisen. Eine Fantasie beginnt damit, dass ich von Piraten entführt werde. Der einfühlsamste Pirat, der wegen seiner traurigen Kindheit immer einen melancholischen Blick und ein Buch dabeihat, erkennt sofort, dass ich die schönste Frau bin, die ihm weltweit je begegnet ist. Nach einiger Zeit des Werbens, in der er mir seine Sprache beibringt und Gedichte vorliest, die handwerklich solide und gut komponiert sind, gebe ich seinem Drängen nach, dann gibt es ein bisschen Sex und am Ende den Heiratsantrag. Solche Träume kann man nur haben, wenn man ungestört ist. Jetzt gibt es nur noch die gleichförmige Intimität mit Leonardo, die für mich nie ein Grund gewesen wäre, mit ihm zusammen zu sein.
Der vielleicht schwerwiegendste Verlust sind jedoch die Besuche meiner Nachbarin Evelyn. Nach dem ersten Artikel in der Bezirkszeitung hatte sie mich eines Tages bei den Postkästen angesprochen. Ob ich nicht Ablenkung und ein bisschen Gesellschaft bräuchte? Sie hätte sich schon gewundert, dass sie Leonardo nicht mehr im Stiegenhaus gesehen habe.
Zuerst hatte ich nur aus Höflichkeit »Ja« gesagt und sie zu mir eingeladen, aber mit der Zeit hatte ich ihre Besuche kaum noch erwarten können. Wenn das Handy klingelte und sie schrieb, sie könne in einer halben Stunde zu mir herüberkommen, stellte ich schon mit Herzklopfen im Hals die Gläser auf das Balkontischchen, dazu Schalen mit Nüssen, Käse und Oliven, klopfte die Pölster aus und entkorkte den Wein. Penelope legte sich dann immer schnurrend auf Evelyns Platz und wartete auf sie. Wenn Evelyn da war, strich Penelope glücklich zwischen unseren Beinen herum, und wir redeten stundenlang in den Sonnenuntergang, lachten und weinten die Dämmerung herbei, manchmal die Nacht. Unser Lieblingsthema waren Träume und Fantasien, und es gelang uns dabei, die Motorengeräusche und das Hupen von der stark befahrenen Kreuzung auszublenden. Mehrmals musste ich das Handy zur Reparatur in den Shop bringen, weil ich es immer am Gerät ausließ, wenn Evelyn mir nicht schrieb oder keine Zeit hatte.
Nachdem Leonardos Rückkehr bekannt geworden war, hatte Evelyn sich nicht mehr gemeldet. Auf meine drängenden SMS hatte sie irgendwann geantwortet, dass ich ja nun wieder ausreichend Gesellschaft hätte und auch keine Ablenkung mehr bräuchte. Vielleicht war Penelope auch deswegen so sauer auf Leonardo, denn sie hatte immer glücklich gewirkt, wenn Evelyn sie zwischen den Ohren gekrault und »Mauz mauz« gesagt hatte. Um sie zu besänftigen, habe ich sie letztens in einen Katzenkorb gepackt und bin mit ihr in die Werkstatt der Künstlerin gefahren. Die Künstlerin hatte zwei Jahre zuvor in einem meiner Kleider geheiratet und danach eine Plastik von Penelope angefertigt, die bereits bei mehreren internationalen Ausstellungen gezeigt wurde und auch in Zukunft noch viele Bewunderer finden wird. Unser Traum wäre, sie dauerhaft in Wien irgendwo im öffentlichen Raum aufzustellen, zum Beispiel bei der Spinnerin am Kreuz. Penelope wirkte zufrieden, als sie ihr Ebenbild betrachtete.
Ich glaube immer noch, dass sich alles einrenken wird. Viele Paare haben nach Jahren des Zusammenlebens eine Krise, warum also nicht auch nach Jahren des Getrenntseins? Ich werde mir einen neuen USP für das Brautmodengeschäft überlegen. Und irgendwann werden wir wieder ganz andere Probleme haben.
Peter Clar
Über den See, über das Wäldchen
für Johanna Taupe
»Im 17. Jahrhundert erzählten sich die Bewohner eines Dörfchens in unmittelbarer Nähe des Faaker Sees, daß der Mittagskogel Gold berge«, liest du, in der Latschacher Pfarrkirche, dem ›Dom vom Rosental‹ (»Rož, Podjuna, Zila, nagelj, rožmarin, v sveti zemlji sniva tvoj slovenski sin« / »Rosental, Jauntal, Gailtal, Nelke, Rosmarin, in der heiligen Erde schläft dein slowenischer Sohn«), in der Kirche deiner Kindheit sitzend und blickst nach vorn, blickst auf den barocken Altar oder auf das Ovalfenster mit gelbem Glas, davor die Taube des Heiligen Geistes, oder nach links zur Kanzel, auf der du noch niemals, auch nicht vor 20, nein, 25, nein, 30 Jahren oder mehr jemanden stehen gesehen hast, wie du überhaupt noch nie jemanden auf der Kanzel einer Kirche stehen gesehen hast. In der Latschacher Pfarrkirche St. Ulrich sitzend liest du weiter (»Es gab daher viele Leute, die es zu gewinnen trachteten und bald da, bald dort Grabungen anstellten, aber immer vergebens.«), liest du von der Magd des Ischnig-Bauern und ihres plötzlichen Reichtums, liest, wie dies den Bauern und den Pfarrer Latschacher (die Sage sagt Latschacher, nicht Leitschacher) stutzig machte und sie beschlossen, dem Geldgeber (1 Dukate pro Übernachtung und Verpflegung), einem Italiener, einem »Welschen«, aufzulauern.
Wie selbstverständlich hast du dich beim Eintreten in die Kirche bekreuzigt, hast du Zeige- und Mittelfinger in das aus der Wand wachsende Weihwasserbecken getaucht, das vor 20, nein, 25, nein, 30 Jahren oder mehr noch zu hoch für dich und deinen Bruder war, so dass deine Mama, so dass deine Oma euch mit ihren Daumen das Kreuz auf die Stirn malten (Geste von Mama wiederholt an deinen ersten Volksschultagen) und dir Stirn, Kinn und Brust bekreuzigten. Wie selbstverständlich hast du dich am Mittelgang – darunter das Grab des Pfarrers Leitschacher, des Erbauers der Pfarrkirche St. Ulrich – rechts gehalten, wie selbstverständlich hast du dich in die sechste oder siebte der rechten Bankreihen gesetzt, wie damals mit deinem Bruder und Opa, deine Mama aber, deine Oma aber immer links, bei den anderen Frauen. Und so sitzt du nun, im Buch Heimat am Mittagskogel und Faaker See die Sage des Pfarrers von Latschach lesend (der Welsche hat, vom Ischnig-Bauern und dem Pfarrer überrascht, diese zu jenem Ort geführt, wo Gold zu finden ist), auf ca. jener Stelle, auf der du früher gesessen, links von dir Opa oder rechts und rechts von ihm dein Bruder oder links, und blickst nach vorn (wie damals) auf den Altar oder auf die Portraits von Johannes und den anderen Evangelisten in halbförmigen Lünetten oder blickst geradeaus, auf die Wand, auf das auf der Wand hängende Bild des gefolterten Jesus, leicht in die Knie gesunken, die Hände hinter dem Rücken gebunden, den Blick leidend nach oben gerichtet (der für uns gegeißelt worden ist). Wie oft hast du gedankenverloren dieses Bild angesehen oder die Fotos und Namen der Gefallenen des Ersten Weltkriegs auf der darunter angebrachten Tafel aus weißem Marmor, während links von dir oder rechts von dir dein Opa (der beste der Welt), während rechts von ihm oder links von ihm dein Bruder, während rund um dich die Kühle der Kirche, die Sonntagsvormittagsmüdigkeit, die Vorfreude auf das Spielen – wir waren unendlich …
Jedes Mal, erinnerst du dich jetzt (der Ischnig-Bauer, der Pfarrer und der Welsche haben mittlerweile eine Vereinbarung geschlossen, das Gold zu teilen), wenn der Messner oder einer der Ministranten mit dem an einer langen Stange befestigten, samtenen Klingelbeutel durch die Reihen ging, hatte dein Opa deinem Bruder und dir je eine 5-Schilling-Münze in die Hand gedrückt, damit ihr diese in den Klingelbeutel werfen konntet, und du erinnerst dich weiter, an den Weg zum Altar, dein Opa hinter dir (oder deine Mama oder deine Oma), eine Hand auf deiner Schulter, das Kreuzzeichen des Pfarrers, der Stolz, als du dann alt genug für die Hostie, und an das sehnlich erwartete ›Gehet hin in Frieden‹ und dann hinaus, in den sonnigen Sommertag, in den Nebelnovember, in den weißen Wintermorgen. Rechts neben der Tafel mit den Namen der Gefallenen, rechts neben dem Bild des gefolterten Jesus (der für uns gekreuzigt worden ist) siehst du nun das Epitaph für den unter dem Mittelgang der Kirche beerdigten Pfarrer Leitschacher, umrahmt von einem vergoldeten Bild des Pfarrers, von Getreideähren, einem Hostienkelch, einer Weinrebe, vor allem aber von einem sich plastisch abhebenden Totenschädel mit Flügeln – »Hic cubat, abreptum defle, tequaeso. Uiator / Ioannes Leitshaher Primus Parochus et / author aedificii« (»Hier ruht, beweine den Entrissenen, darum bitte ich dich, Wanderer, Johannes Leitschacher, der erste Pfarrer und Erbauer dieses Gebäudes«).
Das Geld für den Bau der Kirche, für den Bau des Pfarrhauses, für den Bau der Volksschule habe der Pfarrer sich selbst aus dem am Mittagskogel gefundenen Erz prägen lassen, so erzählt dir die Sage, während du unwillkürlich (wie damals) immer wieder auf den aus der Wand herauswachsenden, geflügelten Totenkopf schaust, auf die lateinische Inschrift schaust (»Quinque decem Numeres ac His / Super addito Quintum / ætatis Numerum Mox libi Crede dabit« / »20 Jahre leitete er die Kirche. Zähle 5 x die 10 und füge zu diesen Zahlen die fünfte, das wird Dir die Lebenszeit geben, glaube es«). Bald aber hätten ihm seine Neider vorgeworfen »daß er auf unehrliche Art reich geworden sei« und ihn vor Gericht gebracht, von dem er, da er die Quelle seines Reichtums nicht preisgeben wollte, zum Tode durch lebendiges Einmauern verurteilt wurde. Und du stehst auf und stehst nun im Mittelgang des Mittelschiffs, darunter das Grab des Pfarrers, und gehst ein paar Schritte nach vorn bis zu exakt jener Stelle, wo vor ein paar Jahren der Sarg deines Opas gestanden ist oder bildest du dir das ein, deine Erinnerungen verschwimmen, während du, das aber weißt du bestimmt, ziemlich genau auf jenem Platz gesessen bist, auf dem du als Kind neben ihm (links oder rechts du, rechts oder links dein Bruder) gesessen warst. Und nun siehst du dich selbst, wie du leer den leeren Worten des Pfarrers zuhörst (irgendetwas vom ewigen Leben), aber siehst dich auch deiner Mama zuhören und erinnerst dich an ihre Rede (unser junger, fescher Vati) und dann doch auch an Tränen (wie heute).
Und du blickst noch einmal zum Altar, an dem der Pfarrer Leitschacher kurz vor der Vollstreckung des Urteils tot zu Boden gesunken sein soll (Gnade Gottes) und drehst dich um, unter dir sein Grab, in dem sein Körper, zum Zeichen, dass er nichts Unrechtes getan hatte, 100 Jahre lang nicht verwest war, und gehst Richtung Ausgang, vorbei an der Kreuzigungsgruppe mit dem Schneeball auf der Brust des gekreuzigten Jesus (der Werfer verlor, da er seinen Treffer nicht bereute, auf der Stelle den Verstand, heißt es, und sei »[n]ach dem Pfingstfest (1613) […] elendiglich verstorben«), und trittst hinaus in die Frühlingssonne, vom Mittagskogel der Geruch nach Schnee (noch oder wieder) und gehst zweimal nach links (wie damals, als ihr dem Sarg hinterher – »Muass wohl fuat aus meiner Kammer, pfiat enk Gott, pfiat enk Gott«), links von dir nun die Kirche und rechts von dir die Friedhofsmauer mit der ehemaligen Totenkammer, dahinter die Karawanken. Oder du gehst zweimal nach rechts, vorbei am Mahnmal gegen den Krieg von Valentin Oman, das 2010 errichtet wurde und das du, so lange warst du nicht mehr hier, heute zum ersten Mal siehst (oder bildest du dir das ein oder erinnerst du dich falsch?), rechts von dir nun die Kirche und links von dir die Friedhofsmauer, dahinter der Pfarrhof. In diesem hatte die Dorfgemeinschaft Latschach vor rund 20 Jahren (damals noch ohne rechtsrechten Obmann, damals noch mit Chor, Volkstanzgruppe und Theatergruppe) zum ersten Mal Ernst Müllers Der Goldpfarrer von Latschach aufgeführt, du erinnerst dich an die Proben und an die Arbeiten an den Kulissen und daran, wie der Nadrag-Opa (den alle in eurer Großfamilie so nennen, auch wenn er der Opa deiner Cousins ist) als »Welscher« die Friedhofsmauer entlanglief, erinnerst dich an das Trauerlied des Chors anlässlich des verkündeten Todes des Goldpfarrers (»Ave, ave, ave Maris Stella«), den dunkelblauen Nachthimmel und den hell erleuchteten Kirchturm, und es kommt dir vor wie ein anderes Leben, ein anderes Sein.
Und an der Rückseite der Kirche bleibst du kurz stehen, schaust auf das große Kruzifix, darüber das Ovalfenster mit gelbem Glas, dahinter die Taube des Heiligen Geistes, und liest die Namen auf den Gedenktafeln, liest den Namen von Janko Mikula (»Rož, Podjuna, Zila«) und von Franc Treiber (»Nmav čriez jizaro, nmav čriez hmajnico, čjer je dragi dom z mojo zibelko, čjer so me zibali mamica moja in prapievlali haji, haja.« / »A bisserl über den See, a bisserl über das Wäldchen, wo mein liebes Zuhause mit meiner Wiege steht, wo mich Muttern wiegte und »haji, haja« sang«), die erst 2009 aufgehängt wurden. Und du gehst vorbei am Mikul-Grab und wunderst dich, warum dir als Kind niemand die Geschichte der drei von den Nationalsozialisten ermordeten Kärntner Slowen_innen erzählt hat (und erinnerst dich an die Aufbahrungshalle, den Sarg deines Opas und die Vorbeterin, die auch für »unseren verstorbenen Landeshauptmann Haider« gebetet hatte – und wunderst dich nicht mehr). Und du gehst weiter, gehst bis zum Grab deines Opas, dahinter der Mittagskogel (»fliagt a großer Vogel üban Mittagskogel / kennt ka Grenz, kennt ka Zeit«). Wie lange du schon nicht mehr hier warst (»amol mecht i a so a Vogel sein / fliagn wo’s ma grod gfollt«), denkst du dir, und erinnerst dich an Allerheiligen im Novembergrau, an Anoraks und Hauben und Hände in Taschen, an Atemwolken und Erwachsene mit hochgeschlagenen Mantelkrägen und an das Verstummen der Gespräche beim Nahen des gräbersegnenden Pfarrers. Und dann der Nachmittag bei Oma und Opa, bei Tee und Kuchen und Sasakabroten. Und am Abend, auf der Heimfahrt, noch einmal vorbei am Friedhof, das Licht Hunderter Kerzen verschwimmend im Grau, irgendwo bellt ein Hund (aber das kannst du nicht hören) oder fährt einsam ein Auto und dann / wieder Stille.
Und jetzt holst du ein Grablicht aus deiner Tasche, hast aber die Zündhölzer vergessen, hast dein Feuerzeug vergessen, weißt aber auch, dass deine Oma hinter dem Grabstein ein Feuerzeug platziert hat (vielleicht eines vom Spar) oder eine dünne Kerze, um an einem anderen Grablicht Feuer entzünden zu können, und du holst das Feuerzeug oder holst die Kerze und zündest das Grablicht an und gehst leicht in die Hocke, um sie aufs Grab zu stellen. Und wie damals, einige Tage (oder waren es Wochen?) nach dem Begräbnis, bleibst du kurz hocken, aber diesmal kommt dein ehemaliger Hausarzt, obwohl stramm deutschnational ein Freund deiner Familie, und du schüttelst im Heute den Kopf, nicht vorbei, bleibt nicht kurz stehen, schaut nicht zuerst aufs Grab und dann auf dich, sagt nicht, mit freundlichem Lächeln, nachdenklich »Dein lieber Opa« und du nickst nicht stumm zurück. Und du stehst auf und gehst weiter, den Gräbern entlang, die dir seltsam vertraut, liest hin und wieder einen neuen, doch selten einen unbekannten Namen, gehst bis zum Grab der Mutter deiner ersten Freundin. Und du erinnerst dich an den Moment, als du die Nachricht ihrer Krankheit bekamst, erinnerst dich an das Public Viewing bei der EM 2008 und du weinend im Rathauspark, erinnerst dich aber auch an Ivo Vastićs Elfmetertor, an »Wien-wird-Cordoba« (wurde es nicht) und an deinen Besuch im Krankenhaus, an dein Versprechen, auf ihre Tochter aufzupassen – und wie schnell du es gebrochen, wie wenig sie es gebraucht aber auch – und an das Begräbnis (»Vom Rupertiberg in die Turia«). Und du denkst zurück, an Paris ’98, an Hand-in-Hand und wild schlagendes Herz (wie in schlechten Gedichten) oder an ein halbes Jahr später, an geöffnete Fenster – ihr wart noch Kinder und seid es lange schon nicht mehr (»Hiša očəna, ljuba mamica, da bi jes našel še embart oba; o da bi videl jo, mamico svojo, pa bi spevlav spet haji, hajo.« / »S’ Vaterhaus, die liebe Mutter, könnt’ ich beide noch einmal aufsuchen, oh, sähe ich sie noch einmal, meine Mutter, dann sänge ich wieder haji, hajo«).
Da reißen dich Schritte aus deinen Gedanken und du drehst dich um, ein alter Mann geht vorbei, du kennst ihn vom Sehen, für ihn aber bist du fremd. Und trotzdem grüßt er dich stumm und du ihn und drehst dich zurück zum Grab, dahinter leuchtet der Mittagskogel golden im Abendlicht (als wäre es eine Klammer). Und du fängst ein Kreuzzeichen an, lässt es aber bleiben und gehst los, gehst Richtung Parkplatz, rechts von dir die Karawanken und links von dir der Kerzenautomat, die Mülltonnen, der Abfallhaufen, und in deinem Rücken die Kirche, das Ovalfenster mit gelbem Glas, dahinter die Taube des Heiligen Geistes, darunter das Kruzifix, daneben die Gedenktafeln für Janko Mikula und Franc Treiber (»K’ sem še mihen bil, sem bil dro vasev, sem večbarti k’tero pesem pev« / »Als ich noch klein war, war ich fröhlich, sang oftmals so manches Lied«).
Für die Übersetzung von Nmav čriez jizaro bedanke ich mich bei Dominik Srienc – Hvala za pomoč!