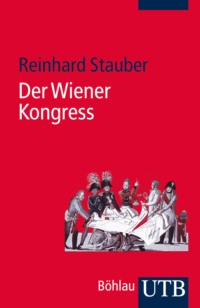Kitabı oku: «Der Wiener Kongress», sayfa 5
Talleyrand und die Frage der Zulassung Frankreichs
Der französische Außenminister erreichte Wien nach einwöchiger Reise am 23. September 1814. Im Versuch, die diplomatische Isolation seines Landes zu überwinden, wollte er sich besonders für die Interessen der mittleren und kleinen Staaten einsetzen, vor allem für eine Zulassung Sachsens zu den Verhandlungen. Unter den Vertretern der Großmächte, [<<50] deren Anspruch auf Kongressregie er auf diese Weise zu unterlaufen drohte, setzte Talleyrand vor allem auf Castlereagh.
Die erste Zusammenkunft des Sechs-Mächte-Gremiums fand am Nachmittag des 30. September 1814 in Metternichs Villa am Rennweg statt, wohin der Hausherr Talleyrand als Vertreter Frankreichs und Labrador als Vertreter Spaniens zu einer „vorläufigen Conferenz“ geladen hatte, um beide über den Stand der Vorbereitungsarbeiten in Kenntnis zu setzen.8
Der Konferenz „als bloß privilegierter Beobachter … vom Katzentisch aus bei[zu]wohnen“ konnte für den Virtuosen des diplomatischen Geschäfts keine verlockende Perspektive sein.9 Talleyrand zelebrierte am Nachmittag jenes 30. September einen denkwürdigen Auftritt, mit dem er, wie Gentz notierte, alle bisherigen Verfahrensplanungen zunichte machte. Auf Anweisung Castlereaghs überreichte Metternich Talleyrand zunächst das Protokoll der Vier-Mächte-Konferenz vom 22. September. Der Franzose nahm sogleich Anstoß an der Bezeichnung „Verbündete“, mit dem die vier Allianzmächte sich darin bezeichneten – als „ob kein Friede geschlossen wäre, ob eine Feindseligkeit bestehe und gegen wen?“ Zwischen dem Pariser Frieden, in dem die Einberufung eines Kongresses nach Wien festgelegt worden sei, und der bevorstehenden Eröffnung des Kongresses könnten keine ihn bindenden Absprachen getroffen worden sein: „Alles, was inzwischen geschehen ist, ist mir fremd und existiert für mich nicht.“ Metternich nahm den Ablaufplan wieder an sich und legte ihn „beiseite, und es war nicht mehr davon die Rede.“10 Damit waren die Verfahrensplanungen wieder auf dem Nullpunkt angelangt und der geplante Eröffnungstermin des Kongresses am Folgetag, Samstag, dem 1. Oktober, natürlich Makulatur.
Als nächstes übergab Metternich Talleyrand jenes Papier, in dem Gentz die bisherigen Verfahrensabsprachen, die Abtrennung zwischen europäischen und deutschen Agenden und das Prinzip der Vorabverständigung [<<51] der „Großen Vier“ festgehalten hatte. Der Franzose verlangte dagegen, rasch ein Kongressplenum einzuberufen; nur in dessen Auftrag könne ein engeres Gremium, zusammengesetzt aus den acht Signatarmächten des Pariser Friedens, dann die Erörterung von Grundsatzfragen und die Vorbereitung von Entscheidungen in verschiedenen Ausschüssen in Angriff nehmen, „denn die acht Mächte seien nicht der Congreß, sondern nur ein Theil desselben.“ Dies ging in Richtung der von Castlereagh befürchteten Blockadepolitik, und auch Hardenberg ereiferte sich, die Fürsten Leyen und Liechtenstein hätten „nicht bei der Ordnung der allgemeinen Angelegenheiten Europas mitzusprechen.“11
Um Talleyrand den Wind aus den Segeln zu nehmen, lehnten die vier Siegermächte eine eröffnende Plenarsitzung ab und spielten eine Woche lang auf Zeit. Zunächst legte Castlereagh einen neuen, ganz abstrakt gehaltenen Entwurf für eine Verfahrensordnung des Kongresses vor. In den Auseinandersetzungen darüber wuchs die Runde der Sechs durch Zuziehung der Vertreter Portugals (Palmella) und Schwedens (Löwenhielm) am 8. Oktober zu jenem Gremium der Acht Mächte an, das für den weiteren Ablauf dann entscheidende Bedeutung gewinnen sollte. Talleyrand verlangte immer noch eine formale Regelung der Frage der Zulassung zu den Verhandlungen, während Metternich einfach nur die Verschiebung des Auftakts um einige Wochen bekanntmachen wollte. Als Metternich – ungewohnt eindeutig – drohte, es werde andernfalls gar keinen Kongress geben, steckte Talleyrand schließlich zurück. Vorher brach er freilich, am 8. Oktober, noch eine fast handgreiflich endende Diskussion mit dem preußischen Staatskanzler vom Zaun, indem er ausdrücklich die „Grundsätze des öffentlichen Rechts“ als Leitlinie für die Verhandlungen des Kongresses verankert sehen wollte, was Hardenberg zu Recht als Spitze gegen die preußischen Interessen an Sachsen interpretierte.12 Zweifelsohne kam die „Kleinteiligkeit des Konferenzgeschehens“ gerade im September/Oktober Talleyrands Taktik und seinem diplomatischen Talent entgegen, doch hat [<<52] er die von ihm gespielte Rolle in seinen Berichten wie in seinem Memoirenwerk systematisch überhöht und damit auch verzeichnet.13
Die Verschiebung der Eröffnung
Am Abend des 8. Oktober ließ das Gremium der Acht offiziell verkünden, die Eröffnung des Kongresses werde auf den 1. November 1814 verschoben, um weitere Zeit für „freie und vertrauliche Erörterungen“ zur Vorbereitung zu gewinnen.14 Man brauchte in der Tat, wie Castlereagh formulierte, Zeit für weitere Diskussionen ohne die Formalia einer Geschäftsordnung. Die Organisation des Kongresses als parlamentsähnliche, beratende Versammlung („deliberative assembly“) mit Ausschüssen und plenaren Entscheidungen nach Mehrheitsprinzip schien dem Briten organisatorisch unmöglich zu bewältigen. Nun sei vorerst in kleinerer Runde weiter zu verhandeln. Die schwierigste und deshalb entscheidende Frage sei Polen.15
Den Aufschub im Oktober nützten die vier Siegermächte für den Versuch, vor der Befassung des Achtergremiums und unter Ausschaltung Frankreichs die Chancen auszuloten, die bisher verpassten Vorabsprachen zu fixieren. Für den „kleinen Ausschuß“, wie Gentz ihn nannte, mit Metternich, Castlereagh, Nesselrode sowie Hardenberg und Humboldt standen die russischen Ansprüche auf das Herzogtum Warschau und die damit zusammenhängenden Folgen für die Gebietsumverteilung in Deutschland im Fokus, vor allem die preußischen Entschädigungsansprüche. Ohne dass offizielle Sitzungsprotokolle überliefert wären, können wir uns aus einem Bericht Castlereaghs ein Bild davon machen, welche Themen die vier Siegermächte im Oktober 1814 beschäftigten:16 [<<53]
• „The affairs of Poland“ würden (mit Konsens Frankreichs) vorerst nur im Kreis der Vier behandelt. Formal agiere Großbritannien als Vermittler zwischen Russland, Preußen und Österreich. Die Klärung aller weiteren territorialen Fragen in Mitteleuropa hänge von der Lösung dieses Problems ab.
• In den „German affairs“ habe „a species of commission“ bereits die Arbeit aufgenommen und bemerkenswerte Erfolge bei der Ausarbeitung einer „confederation for Germany“ erzielt.
• „The affairs of Switzerland“ würden von einer eigenen „commission“ der vier alliierten Mächte behandelt, die alle Schweizer Gesandtschaften anhöre und ihre Vorschläge mit dem französischen Gesandten Dalberg abstimme.
• „The affairs of Italy“ stellten eine weitere „subdivision“ dar. Hier werde man zunächst, um Zeit in der umstrittenen Frage des Königtums in Neapel zu gewinnen, die Umgestaltung Norditaliens behandeln. Dabei solle der Auftakt gemacht werden mit der Regelung des Anschlusses von Genua an Piemont-Sardinien; auch hierfür gebe es bereits eine „preparatory commission“.
Festzuhalten bleibt – Castlereagh wies ausdrücklich darauf hin –, dass trotz ungeklärter Interessenlagen in der Mächtepolitik und der Verschiebung der formellen Kongresseröffnung bereits im Oktober offizielle Verhandlungen stattfanden: Am 14. Oktober 1814 begannen die Sitzungen des Komitees für „die Angelegenheiten, welche die künftige Gestaltung Deutschlands betreffen.“17 In dem Gremium vertreten waren Österreich, Preußen, Bayern, Hannover und Württemberg, das Protokoll führte der Göttinger Völkerrechtler und hannoversche Kabinettsrat Georg Friedrich von Martens. In dichter Frequenz fanden in den vier Wochen vom 14. Oktober bis zum 16. November 13 Sitzungen statt. [<<54]
Kongress oder Plenum?
Am 30./31. Oktober endlich erfolgten die Beschlüsse der Acht zur förmlichen Aufnahme der Verhandlungen. Entsprechend einem Vorschlag Talleyrands übernahm Metternich am 31. Oktober 1814 „den Vorsitz dieser Versammlung“. Die Eröffnung am 3. November 1814 vollzog sich freilich in denkbar unspektakulärer Form. Drei Vertreter der Großmächte (Preußen, Russland und Großbritannien wurden dazu ausgelost) bezogen an diesem Tag ein Büro in der Staatskanzlei am Ballhausplatz und begannen mit der Überprüfung der Vollmachten aller Gesandten. Zu den offenen Organisationsfragen wurde am 1. November lediglich mitgeteilt, die Minister der Acht Mächte würden „Maaßregeln in Vorschlag bringen, die sie für die zweckmäßigsten halten werden, um den fernern Geschäftsgang des Congresses zu bestimmen.“18
Noch einmal hatte Talleyrand die Bildung einer „Generalkommission“ vorgeschlagen. In ihr sollten alle in Wien anwesenden Vertreter von Höfen im kaiserlichen oder königlichen Rang, des Papstes und des Hauses Oranien Sitz und Stimme haben; sie sollte einerseits die Arbeit von drei Unterkommissionen (zuständig für Deutschland, Italien bzw. die Schweiz) anleiten und prüfen, andererseits die Vollversammlung aller in Wien akkreditierten Diplomaten regelmäßig informieren. Damit erkannte auch Talleyrand letztlich die Unterscheidung zwischen zwei großen Gruppen von Kongressteilnehmern an: solchen mit Entscheidungsrecht und solchen, die lediglich Informationen beziehen sollten. Nach wie vor stieß die Idee einer mit bestimmten Rechten auszustattenden Generalversammlung auf den Widerstand zunächst Nesselrodes, dann auch Hardenbergs.19 Auch Metternich und Castlereagh waren der Ansicht, die Großmächte könnten und dürften sich nicht der Willensmeinung einer entscheidungsbefugten Versammlung unterwerfen: „a Congress [<<55] never could exist as a deliberative assembly, with a power of decision by plurality of voices.“20 Dahinter stand die Befürchtung, die bereits am Rande des Scheiterns balancierende Abstimmung der vier Siegermächte über Polen würde in einer solchen Konstellation (und angesichts der misstrauisch beobachteten Aktivitäten Talleyrands) vollends unmöglich. Anfang November endlich entschieden die Acht, dass es auf dem Kongress keine nach Mehrheitsprinzip entscheidende Generalversammlung geben werde.21
„Einmal“, will Talleyrand danach zu Metternich gesagt haben, „muss er ja doch zusammentreten“22, doch sollte er sich täuschen. Nach Abschluss der Prüfung der Vollmachten wandten sich die Acht in ihrer nächsten Sitzung am 13. November erstmals einem Sachthema zu und besprachen das Vorgehen in der Genua-Frage. In kurzen Worten machte das Sitzungsprotokoll nun außerdem bekannt, eine „allgemeine Zusammenkunft aller Bevollmächtigten“ sei gegenwärtig „nicht nützlich“ und deshalb auf unbestimmte Zeit vertagt. Sie sollte nie einberufen werden.
Ein „Europa ohne Distanzen“
In Form eines Generalplenums ist der Wiener Kongress nie zusammengetreten. Gentz hatte zur Zeit der eben dargestellten Verhandlungen im Oktober 1814 wenigstens noch zwei oder drei Generalversammlungen erwartet, die die Beschlüsse der Kommissionen sanktionieren und diesen so zu „mehr Ansehen und Feierlichkeit“ verhelfen würden. Doch denke „keine souveräne und unabhängige Macht“ im Ernst daran, sich in Fragen der „großen Interessen Europas“ den Entscheidungen einer Diplomatenversammlung zu unterwerfen.23 [<<56]
Auch als repräsentativer Rahmen für die Sanktionierung bereits getroffener Entscheidungen trat der Kongress nie in Erscheinung; es gab weder eine offizielle Auftakt- noch eine Schlussveranstaltung. Es waren neue Faktoren, die diesen Kongress prägten: der vertraute Stil des Umgangs dieser politischen Entscheidungsträger untereinander, der Vorrang der Sacharbeit vor Fragen des Zeremoniells, die kurzen Verbindungen zwischen privaten und offiziellen Erörterungen. Die Chefdiplomaten der großen Höfe, die einen Großteil des Spätjahres 1813 und das erste Halbjahr 1814 praktisch durchgehend miteinander verbracht hatten und sich deswegen gut kannten, führten den eingeübten „English style of conducting business“ mit vertraulichen Begegnungen ohne zeremoniellen Aufwand und freien mündlichen Erörterungen fort.24 Im Gegensatz zu den großen diplomatischen Kongressen des 17. und 18. Jahrhunderts kamen in Wien keine weisungsgebundenen Gesandten zusammen, sondern alle wichtigen leitenden Politiker, was die politischen Optionen vergrößerte und das persönliche Ausloten von Kompromissen in kritischen Situationen ermöglichte.
Von Mitte September bis Anfang November 1814 waren die Unterzeichner des Pariser Friedens in Wien scheinbar mit Fragen der Geschäftsordnung beschäftigt. Dahinter verbargen sich jedoch schwierige Grundsatzfragen: Gleichbehandlung aller Teilnehmer, Rolle einer Plenarversammlung, Steuerungsfunktion der Großmächte. Neben dem halben Dutzend offizieller Sitzungen liefen in dieser Phase auch Gespräche der vier Alliierten über das Herzogtum Warschau, in denen es nicht gelang, den Zaren zu einer Berücksichtigung der Ansprüche Preußens zu bewegen. Das Komitee für die Angelegenheiten des Deutschen Bundes dagegen steckte bereits mitten in der Arbeit und hielt allein im Oktober sieben Sitzungen ab.
Der Wiener Kongress war weder eine Friedenskonferenz (der völkerrechtliche Friedensvertrag datierte vom 30. Mai 1814) noch eine entscheidungsberechtigte Versammlung im Sinne der heutigen Vereinten Nationen. Er war ein „Arbeitskongress“ und bildete den Rahmen für viele bi- und multilaterale Gespräche, die vor allem von den Großmächten Russland, Österreich, Großbritannien und Preußen geführt wurden, mit [<<57] ad-hoc-Konsultationen, wo und mit wem auch immer es den „Großen Vier“ angebracht schien. Politisches Ziel war die Weiterentwicklung der Pariser Bestimmungen zu einer tragfähigen Friedensordnung für Europa, wofür zunächst aber eine Reihe strittiger Territorialfragen zu klären waren.
Nach außen hin prägte der Kongress die Bühne der Kaiserstadt Wien gerade in den Monaten Oktober und November mit einer Fülle großer und glanzvoller Festlichkeiten. Die Eröffnung der Verhandlungen hingegen musste um sechs Wochen verschoben werden. Was am 3. November 1814 dann tatsächlich von statten ging, war keine prunkvolle Sitzung in einem der großen Repräsentationsräume der Hofburg oder in Schönbrunn, sondern die Eröffnung eines Akkreditierungsbüros in der Staatskanzlei am Ballhausplatz: „Am 3. November 1814 fand dessen [des Kongresses] Eröffnung in einer den Erwartungen des schaulustigen Publicums nicht entsprechenden prunklosen Conferenz statt.“
Die erst 1852 niedergeschriebenen Erinnerungen des alten Metternich an die Eröffnung des Kongresses, aus denen die eben zitierte Passage stammt, sind von besonderem Interesse in ihrer Vermischung von korrekter und falscher Erinnerung. Der Staatskanzler fährt fort: „Die Bevollmächtigten der verschiedenen Staaten und Länder ersuchten mich, die Oberleitung der Verhandlungen zu übernehmen. Ich unterzog mich diesem Geschäfte in der Ueberzeugung, daß die dem Congresse gestellten Aufgaben nur in einer geregelten Reihenfolge unter strenger Beseitigung alles Nichtnöthigen … gelöst zu werden vermochten. Ich stellte den Antrag auf eine Geschäftsordnung, welche zu umfassen hatte: a) Die Berathungen unter den Mitgliedern der Quadrupel-Allianz und Frankreichs unter der Bezeichnung des Comité des cinq Puissances; b) die Versammlung der Bevollmächtigten dieser fünf Mächte mit denen von Spanien, Portugal und Schweden in erweiterter Form unter der Benennung der Assemblée des huit Cours und deren Berührungen mit den Vertretern der übrigen Staaten; c) die Errichtung einer der Regelung der deutschen Zustände speciell gewidmeten, aus Bevollmächtigten der deutschen Staaten zu bildenden Commission.“25 [<<58]
Die Übernahme der „Oberleitung“ ist korrekt geschildert. Allen Versammelten war klar, dass dem leitenden Minister der Habsburgermonarchie als ranghöchstem Vertreter des gastgebenden Kaisers Franz I. eine hervorgehobene Rolle zukommen musste, auch im Hinblick auf den Zugriff auf die bürokratischen Kapazitäten der Wiener Staatskanzlei. Doch Talleyrand brachte erst am 30. Oktober den Vorschlag ein, Metternich zum „Organ“ der Acht Mächte zu bestimmen, und dieser übernahm tags darauf, nach Rücksprache mit dem Kaiser, die „Ehrenstellung“ („fonctions honorables“) des, wie er nun formulierte, „Vorsitzes dieser Versammlung“ („présidence de cette assemblée“).26 Doch am 3. November fand gar keine offizielle Konferenz der Acht statt und das Gremium der Fünf war keineswegs von Anfang an eingerichtet, sondern kam erst Anfang Januar 1815 zur Aufarbeitung der polnisch-sächsischen Krise zustande. Gerade in der Phase des Kongressauftakts war Metternich alles andere als der sattelfeste „Kutscher Europas“. Abwarten, Taktieren ohne Festlegen und Absicherung nach allen Seiten war ihm von je wichtiger gewesen als Sachinhalte. Nun, in der unklaren Situation der Wiener Herbsttage, gab es gar keine andere Möglichkeit, als bei dieser Taktik zu bleiben. Welchen Anschein auch immer Metternich später zu erwecken suchte, er kam ohne Masterplan auf den Kongress, wie Castlereagh Anfang Oktober ausdrücklich festhielt: „I found Prince Metternich without any fixed plan.“27
Talleyrand, dessen Worte mit weit größerer Vorsicht zu bewerten sind als jene Castlereaghs, kritisierte Metternich wegen einer kurzen Rede, die dieser wahrscheinlich am 31. Oktober hielt. Diese Ansprache sei „verschwommen“ und „sehr zerfahren“ gewesen, und der Staatskanzler habe gesagt, dieser Kongress sei eigentlich kein Kongress, deswegen sei auch seine Eröffnung eigentlich keine Eröffnung. Dennoch habe die Versammlung der Mächte in Wien eine große Chance: Es sei die vorteilhafte Situation eines „Europa ohne Distanzen“ („l’avantage d’une [<<59] Europe sans distances“), in der man zu einer Einigung über die neuen politischen Grundlagen des Kontinents kommen könne.28
Dieses schöne Bild vom „Europa ohne Distanzen“, ebenso Metternichs Stoßseufzer, er finde „ganz Europa in seinem Vorzimmer versammelt“29 oder Isabeys Sammelportrait der Bevollmächtigten der Acht kennzeichnen die Einzigartigkeit der Wiener Verhandlungssituation 1814/15 mit ihren Herausforderungen, Schwierigkeiten und Chancen. Es gab kein festes Drehbuch, um mit dieser Ausnahmesituation umzugehen; der Kongress erfand seine Arbeitsmethoden im „learning by doing“.
3.2 Mächtekonferenzen, Ausschüsse, Komitees
Ein Spezifikum der Wiener Verhandlungskultur ist die wichtige Rolle der Ausschüsse und Kommissionen. Die Bewältigung einer Vielzahl zeitlich wie sachlich anspruchsvoller Agenden in synchron führbaren Gesprächen, eine gewisse Formalisierung der Verhandlungsführung auch ohne formellen Geschäftsverteilungsplan sowie eine „Bündelung von Expertise“30 durch die Beiziehung von Fachleuten oder regional einschlägig erfahrenen Diplomaten erwiesen sich als zentral wichtig für den Erfolg der Verhandlungen. Der gleichberechtigte Wiedereinstieg Frankreichs in das diplomatische Konzert der Großmächte vollzog sich im Spätjahr 1814 in Wien über die Mitarbeit in drei Kommissionen, und der Ausschuss für die deutschen Angelegenheiten spielte mit seiner Arbeit ab Mitte Oktober eine Vorreiterrolle bei der Aufnahme themenbezogener Gespräche. [<<60]
Die Konferenzen der Acht Mächte
Zentral für die Vorbereitung und Sanktionierung von Beschlüssen auf dem Wiener Kongress waren zwei Gremien. Am Anfang stand das Acht-Mächte-Kollegium der Signatarstaaten des Pariser Friedens, zwischen dem 22. September und dem 8. Oktober 1814 in zwei Erweiterungsschritten (von Vier zu Sechs, von Sechs zu Acht) etabliert. Mit dem Scheitern einer Lösung für Polen im Kreis der Großmächte und mit der Zulassung Portugals, Schwedens und Frankreichs Anfang Oktober hatte die Runde der „Großen Vier“ ihren formalen Führungsanspruch vorerst verloren. In Castlereaghs Sicht diente die Achterrunde als eine Art Lenkungsausschuss („directing body“) zur Vorverhandlung aller europäischen Fragen. Gentz spricht ebenfalls vom „leitende[n] Ausschuß des Kongresses“, der unter Metternichs Vorsitz in einem der Räume am Ballhausplatz tagte; wenn von „allgemeinen Konferenzen“ die Rede sei, sei diese Runde gemeint.31 Die mögliche Besetzung der Achter-Runde lag zwischen neun und 21 Personen. Das bekannte Bild Jean-Baptiste Isabeys, auf der Grundlage von Einzelportraits zusammengesetzt, „zeigt die vollste Besetzung des Achtmächtegremiums bei der Ankunft Wellingtons, Anfang Februar [1815]“ mit 21 Diplomaten und zwei Sekretären.32
Als die Acht am 31. Oktober die offiziellen Beschlüsse über die Aufnahme der Verhandlungen fassten, waren die Mächte durch 16 Personen vertreten: Metternich und Wessenberg für Österreich, Castlereagh, Cathcart, Stewart und Clancarty für Großbritannien, Humboldt für Preußen, Nesselrode für Russland, Talleyrand, Dalberg und La Tour du Pin für Frankreich, Labrador für Spanien, Palmella, Saldanha und Lobo für Portugal und Löwenhielm für Schweden.33 Später nahmen auch Noailles für Frankreich, Razumovskij und Stackelberg für Russland, Hardenberg für Preußen und Wellington für Großbritannien an [<<61] diesen Besprechungen teil. Ausweislich der in den „Kongressakten“ des Wiener Archivs aufbewahrten Protokolle34 tagte die Achter-Konferenz im November einmal, im Dezember, im Zeichen der sich zuspitzenden sächsischen Krise, dreimal. Mit der Blockade der Verhandlungen um die Jahreswende und deren Überwindung Mitte Januar trat die neue Fünfer-Runde ins Zentrum der politischen Auseinandersetzungen; die Acht dagegen traten in den ersten beiden Monaten des Jahres nur dreimal zusammen, um Kommissionsberichte entgegenzunehmen. Erst nach Napoleons Rückkehr von Elba gewannen die Acht Mächte ihre Koordinationsfunktion, jetzt mit deutlich militärischem Akzent, zurück, tagten im März viermal und erklärten u. a. am 13. März (unter Beteiligung der französischen Gesandten) die Ächtung Napoleons. Es folgten zwei letzte Sitzungen am 9. und am 18./19. Juni, die der Verabschiedung der Schlussakte und deren Formalia galten.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.