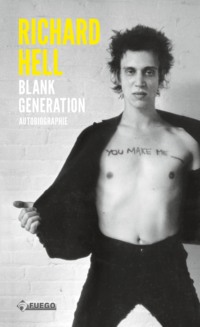Kitabı oku: «Blank Generation», sayfa 3
Später am Tag wurde ich in das Büro des Schulleiters bestellt, und er drohte mit der Verweisung von der Schule. Ich versuchte, den Drogenkonsum als eine wissenschaftliche Untersuchung darzustellen. Ich bin mir nicht sicher, wie überzeugend das war, jedenfalls warfen sie mich nicht raus, sondern suspendierten mich für eine Woche.
Als ich zurückkehrte, wurde ich siebzehn. Die Schule blieb enttäuschend. Ich war kribbelig und ließ den Unterricht an mir vorüberziehen.
In jenem Herbst befreundete ich mich mit einem Typ, den ich bis dahin kaum wahrgenommen hatte: Tom Miller. Das, was uns in der Schule zusammenbrachte und für die nächsten sieben oder acht Jahre zusammenhielt, war sowohl etwas Negatives als auch etwas Positives. Wir waren beide nach innen gekehrte Menschen, die Konventionen kaum respektierten und die sich als Außenseiter fühlten. Wir teilten auch den Geschmack für eine bestimmte Literatur und eine bestimmte Musik und hatten beide einen antirealen Humor.
Tom war eine Ausnahme in Sanford. Zum einen war er ein Tagesschüler, wohnte also nicht in der Schule, so dass er weniger bekannt war. Er war ruhig und immer angespannt, und er machte gerne gespenstische Witze. Das meiste auf der Welt erschien ihm unverständlich seltsam, und er war deshalb empfänglich für alle möglichen irrationalen Erklärungen – von Dingen wie fliegenden Untertassen über extreme Verschwörungstheorien bis zu obskurem religiösem Mystizismus. Er wusste, dass diese Vorstellungen und Verdächtigungen vielen Leute verrückt vorkamen, und das war ein Grund dafür, dass er so verschlossen war.
Er war ein Neurotiker, der mit anderen nur in den beschränkten Begriffen seiner Privatsprache kommunizieren konnte. Damals war er allerdings noch lockerer und geselliger und weniger launenhaft, als er es schließlich wurde.
Er hatte eine große Sensibilität. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie weit sie sich in der zwölften Klasse entwickelt hatte, aber als wir zwei Jahre später in New York wieder zusammenkamen, mochte er Free Jazzer wie Albert Ayler und Eric Dolphy und Dichtung, die der Musik ähnelte, wie Kerouacs Gedichtband Mexico City Blues mit seiner Missachtung der Grenzen und mit seiner Spontaneität und Verzweiflung und spirituellen Sehnsucht und seinem Humor. Tom gefielen obsessive Außenseiter – Künstler, deren Werke Mustern folgten, die intuitiv und materiell mit der wahren verrückten oder verborgenen Realität verbunden waren, denn diese Werke waren aus der Gehirn von Leuten hervorgegangen, die zwanghaft kreativ waren, selbst wenn man sie nach orthodoxen Standards für ungeschult halten konnte. Und er mochte die Kehrseite der Medaille, nämlich die hochbegabten, hart arbeitenden, selbstbewussten und gebildeten, weltgewandten Künstler, die sich nicht darum scherten, irgendjemandem zu gefallen oder irgendetwas allzu ernst zu nehmen, und sie waren natürlich subversiv und in der ihnen eigenen Reinheit unfähig, schlechte Kunst zu machen. So bewunderte er die ursprünglichen Sun Records Musiker oder den Gitarristen Link Wray oder wilde Popkünstler wie die Rolling Stones mit einigen ihrer frühen selbstgeschriebenen Singles oder Bob Dylan. Und immer ging es ihm um den Spaß in allem oder von allem, was interessant war.
Als ich an die Schule zurückkehrte, kam mir dort alles falsch vor. Das war der Moment, da die Wahl, eine bestimmte Richtung einzuschlagen, fast zu einer ästhetischen Entscheidung wurde. Weiter in die Schule gehen? Es würde die zukünftige Erinnerung ruinieren. Ich verstand das allerdings erst nach ein paar Tagen. Es kam wie eine Inspiration, die sich langsam unter der Oberfläche gebildet hatte, so wie es einem abgerichteten Tier dämmern mag, dass es den Hof einfach verlassen konnte.
»Lass uns abhauen«, sagte ich. Tom war einverstanden.
Wir planten, Richtung Süden zu fahren. Wir hatten genug Taschengeld für eine Fahrkarte nach Washington, und dann fingen wir an zu trampen.
Kapitel Fünf
Wir machten uns auf nach Florida. Wir kannten dort niemanden und wussten nichts über die Gegend außer, dass sie warm und luftig war, und es jede Menge Zitrus- und Meeresfrüchte gab und Mädchen, die nach Sonnenmilch dufteten und Sandkörnchen da und dort hatten, auch unter dem Bund ihrer Höschen. Wir würden Dichter auf der Flucht sein, um die sie sich kümmerten.
Diese Tage auf der Straße, mit Tom der Schule entflohen, gaben mir die bis dahin stärkste Dosis meines Lieblingsgefühls: mein Ich für eine andere Welt zurückzulassen. Es gibt viele Wege, um dieses Gefühl zu bekommen. Eine Droge kann das tun oder eine neue Tätigkeit; man verliebt sich oder verändert einfach sein Aussehen; aber tatsächlich abzuhauen und sich all den Verantwortlichkeiten und Beziehungen der früheren Identität zu entziehen, ist wahrscheinlich der reinste und berauschendste Weg.
Da ist eine schlichte, scheinbar unschuldige Erfahrung, die für mich jene Flucht aus der Schule von 1966 symbolisiert, eine Erfahrung, die neu war und durch unser Weglaufen ermöglicht wurde: spät in der Nacht in einem Restaurant sitzen und mit einem Freund Kaffee trinken. Für viele Jahre behielt sie ihre Wirkmächtigkeit, und für die meiste Zeit war Tom dieser Freund. Es ist ein immerwährendes, ja göttliches Gefühl, mitten in der Nacht mit einem guten Freund zusammenzusitzen, leise miteinander zu sprechen und zu lachen, gemächlich Gedanken auszutauschen, vielleicht brennen die Augen, alles ist ein wenig verschwommen, wir schlürfen aromatischen stimulierenden süßen heißen Milchkaffee, unsere Stimmen sind heiser, das grelle Licht im Restaurant isoliert uns von der um sich greifenden Dunkelheit draußen vor den Fenstern.
Ich weiß nicht, ob ich ganz zu unserem Bewusstseinszustand zurückkehren kann, um die Freude jener Tage beschreiben zu können, nachdem wir von der Schule abgehauen waren. Einerseits lieferten sie eine Blaupause für die Zukunft, andererseits sind sie unwiederbringlich. Wir waren sechzehn und siebzehn (Tom wurde erst im Dezember siebzehn – ich war fast drei Monate älter), und wir waren groß, dünn und linkisch; unsere Handgelenke stachen aus den Ärmeln hervor. Alles war Spaß und ein zaghaftes Erkunden, da wir so vieles, was wir taten, zum ersten Mal taten. Wir suchten immer etwas zum Lachen, und da unsere Egos noch nicht ausgereift waren, konnten wir fast unbegrenzt über uns selbst und übereinander lachen, und kaum ein Verhalten war unerlaubt. Wir liebten es, wie Idioten zu agieren, identifizierten uns aufrichtig mit Pennern auf der Straße und waren trunken von unserer neuen Freiheit.
Jeder brachte in dem anderen einen Sinn für das Lächerliche hervor, und gleichzeitig fühlten wir uns wie Künstler, wie Menschen, die lebten, um das Leben zu ergründen und es nach den eigenen Vorstellungen zu bewältigen. Aber es galt als ein Verbrechen, irgendetwas allzu ernst zu nehmen, so unterdrückt wir uns auch von der konventionellen Welt der Erwachsenen fühlten. Jede wirklich ernsthafte Kunst ist nicht nur traurig, sondern auch urkomisch. Welche andere intelligente Art und Weise zu leben gibt es, als über das Leben zu lachen? Eine achtbare Alternative ist der Selbstmord. Aber wie konnte man das nur tun? Nicht nur würde das einen beklagenswerten Mangel an Humor verraten, sondern es hinderte einen daran, herauszufinden, was als nächstes passiert.
Wir hielten uns nur kurz in Washington auf. Ich kontaktierte einige Freunde von Sayre und teilte ihnen mit, dass wir heimlich durch Lexington kommen würden. Einer von ihnen kannte ein leeres kleines Farmhaus auf einem Gemüsefeld in der Nähe der Stadt, wo Tom und ich einige Tage bleiben konnten. Es war möbliert, aber es gab kein Telefon oder Strom, auch keine Lebensmittel, und natürlich hatten wir keinen Wagen. Sehr bald hatten wir auch nichts mehr zu essen außer rohem Mais und Bohnen, die wir auf dem Feld zusammenklaubten. Aber als meine Freunde vorbeikamen, waren wir die Helden.
Kurz bevor wir wieder aufbrachen, schmissen sie für uns eine Party, und auf dieser Party kam es endlich dazu, dass ich wieder Sex mit einem Mädchen hatte. Ich kannte es kaum, aber es war hübsch. Wir betranken uns beide, und ich fühlte, was es für einen Soldaten bedeuten muss, in den Krieg zu ziehen, oder für einen Rockstar, der für seine noble Aufopferung Liebe verdient. Wir gingen ins Schlafzimmer, während die anderen im Haus tranken und schrien. Es war dunkel in dem Zimmer, aber ich war so gierig, dass ich sie bat, mich mit einer Taschenlampe zwischen ihre nackten Beine schauen zu lassen, und sie, die Göttliche, war einverstanden.
Tom und ich trampten weiter Richtung Süden. Wir kamen ziemlich weit, bis in das südöstliche Alabama, nicht mehr weit von Florida entfernt. Es war mitten in einer Oktobernacht und kalt. Wir standen an einer zweispurigen Straße, die sich durch Felder und Kiefernwälder wand. Es gab kaum Verkehr; zweimal fuhren Autos an die Seite, um dann wieder davonzurasen, als wir auf sie zuliefen. Die Insassen, junge Rednecks, hupten und johlten. Wir entschieden, jenseits der Straße auf einem Stoppelfeld zu warten, bis es hell wurde. Wir sammelten Gestrüpp, Äste und Zweige und machten ein kleines Lagerfeuer.
Wir wurden ausgelassen, verfluchten die Einheimischen und provozierten uns gegenseitig, und dann fingen wir an, brennende Stöckchen auf dem Feld herumzuwerfen. Wir hatten nichts beabsichtigt, aber ziemlich bald fingen ein paar Stellen da und dort Feuer. Wir schwelgten in unserem Machtgefühl. Ich weiß nicht, was wir als nächstes getan hätten, aber plötzlich waren wir von Polizei umringt. Auch ein Löschfahrzeug tauchte auf, und die Bullen hatten Hunde. Wir behaupteten, Collegekids aus Florida zu sein, aber es gab bereits eine Suchmeldung für zwei verschwundene Schüler. Sie nahmen uns fest, steckten uns in eine Zelle und riefen unsere Eltern an.
Wir waren etwa zwei Wochen weg. Diesmal behielt mich die Schule nicht; wir wurden beide rausgeschmissen.
Tom entschied sich, an der staatlichen Schule in Wilmington weiterzumachen, ich aber konnte nicht wieder zurückkehren. Ich musste etwas aus meinem Leben machen. Der fruchtbarste Boden dafür war New York City, aber ich war noch minderjährig, und meine Mutter erinnerte mich daran, dass sie die Polizei alarmieren würde, falls ich abhaute. Ich glaubte nicht, dass sie das tun würde, schlug ihr aber einen Deal vor – ich erklärte mich einverstanden, so lange in die schreckliche High School von Norfolk zu gehen, bis ich 100 Dollar als Startgeld verdient hatte. Wenn ich dann die Stadt verließ, durfte sie mich nicht mehr anzeigen. (1966 waren 100 Dollar etwa so viel wert wie 700 Dollar im Jahr 2012.) Der staatliche Mindestlohn betrug damals 1 Dollar 25 Cent pro Stunde – es würde also Wochen dauern, bis ich das Geld stundenweise nach dem Unterricht verdienen konnte. Ich wusste, dass meine Mutter glaubte, ich, verantwortungslos und faul, wäre nicht fähig, irgendeinen Job so lange zu behalten, ja ich hätte nicht einmal die Ausdauer, überhaupt etwas zu suchen. So stimmte sie schließlich der Abmachung zu, und ich fand sofort einen Job. Ich arbeitete nach der Schule in einem Zeitschriftenladen im Stadtzentrum, der vor allem Pornos verkaufte.
Die Schule war ein Witz. In der Englischklasse wurden uns die Formen der Korrespondenz beigebracht, um unseren Platz in der Gesellschaft zu finden. Als wir einen Dankesbrief für ein Geburtstagsgeschenk schreiben sollten, lautete meiner so:
18. November 1966
Liebe Betty,
vielen Dank für dein aufmerksames Geschenk, Der Esprit de Sades. Unsere ganze Familie lachte lauthals über den ausgelassenen Humor des »heiteren Marquis«.
Niemand kam zu meiner Geburtstagsparty, aber ich hatte viel Spaß mit dem Ausblasen der Kerzen, nachdem ich sie angezündet hatte.
Nochmals Dank für das entzückende Buch.
Dankbar der Deine
Richard
In dem Musterbrief für eine Stellenbewerbung suchte ich eine Arbeit als »Defäkant« in einer Düngemittelfabrik.
Nach der Schule las ich Dylan Thomas. Jahre später fand ich es peinlich, zuzugeben, dass er mich inspiriert hatte. Er war überreizt und »poetisch«, seine Sprache biblisch und astronomisch und anatomisch (Erlöser, Radium, Sonne, Zungen, Brunnen, Nerven, Knochen) und mit großen dramatischen Themen befasst, auch wenn die Gedichte nicht wirklich einen Sinn ergaben, sondern mehr wie Musik klangen. Die New Yorker Dichter, die ich dann später lieben lernte, waren dagegen nette Klugschwätzer und collagierende Phrasensammler, Liebhaber von Alltagsdetails, und sie nahmen sich nie allzu ernst.
Ich habe Thomas kaum mehr gelesen, seit ich achtzehn war. Aber nun, wenn ich wahllos seine Collected Poems aufschlage und finde
To-day, this insect, and the world I breathe,
Now that my symbols have outelbowed space,
Time at the city spectacles, and half
The dear, daft time I take to nudge the sentence,
In trust and tale I have divided sense,
Slapped down the guillotine, the blood-red double
Of head and tail made witnesses to this
Murder of Eden and green genesis._1
… muss ich sagen, es gibt mir einen Kick, und ich kann in mir die Reaktion des Siebzehnjährigen entdecken, der sehen wollte, was er auf dem Blatt in kleinen Wortabteilungen tun konnte. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was mich zu Thomas führte, aber ich las ständig und zog immer viel Nutzen aus Worten, fremde und eigene, und Dylan Thomas war eine berüchtigte Ikone eines Lebens, wie ich es mir für mich selbst vorstellte: ein Typ, der sich mit Hirngespinsten in die Betten der Frauen und in die Schlagzeilen brachte und eine orgiastische Existenz führte, der sich irgendwie durchschlug, ohne zur Schule zu gehen oder einen Job zu haben, eine Spur von Songs darüber hinterließ, schöne Songs der Dankbarkeit und des Lobs und der Tränen und des Unsinns, Erinnerungen an seine Entdeckungen und Verluste, für alle zum Genießen und Nachdenken. Ich wurde dieser Lyrik bald überdrüssig, weil sie mir wie übertriebene Mystifikation und allzu theatralisch vorkam, so wie Nebelmaschinen bei einem Rockkonzert. Der Dichter nahm, was wahrscheinlich nur eine vage kleine Idee oder Quasi-Erkenntnis pro Gedicht war, schmückte es aus und deklamierte es. Was er sagen wollte, war nicht etwa zu tief für klare Worte, sondern vielmehr mussten das Vage und die Dürftigkeit der ursprünglichen Idee durch predigerhaftes Heulen und Brummen weiter verschleiert werden.
Aber wenn ich jetzt auf das Gedicht schaue, gibt es mir einen Kick, und ich kann es ohne Zwang, eine Bedeutung darin zu entdecken, lesen und verstehen, dass gerade das einen Großteil des Vergnügens ausmacht. Wenn man jene Strophe liest, als wäre es Alltagsrede, ähnelt sie einem Spiegelkabinett, das einen mit seinen jähen Wendungen, den vorbeiziehenden Szenen und den Sprüngen zwischen den Ebenen überrascht. Der Text ist krude, zwingt nicht passende Sätze zusammen, und in dieser Hinsicht ist er liebenswert unprätentiös. Er kam der Methode der Zufallsmontage schon ziemlich nahe. Und immerhin verwendete selbst Ted Berrigan, mein liebster New Yorker Dichter, in The Sonnets wiederholt Anspielungen auf Dylan Thomas.
Ich war als Siebzehnjähriger der Lyrik von Thomas verfallen, und ich besorgte mir auch einen Band mit seinen Briefen und eine Biographie. Dylan Thomas sah aus wie ein würdevolles Schweinchen mit einer Kippe zwischen den Lippen, wirren Locken und einer nachlässig gebundenen Fliege. Man konnte sehen, dass eine starke innere Haltung nötig war, um sein knolliges Gesicht so sexy zu machen, wie es ihm gelang, und außer seiner eigenwilligen Art, mit der Sprache umzugehen, bedurfte es einer Menge Alkohol und eines guten Sinns für Humor.
Ich ging damals in die Bibliothek, um zu sehen, wer die anderen modernen Dichter waren. Mir missfielen die gebildeten, pingeligen, grimmigen Lyrikproduzenten wie etwa Robert Lowell. Ich entdeckte William Carlos Williams, und mir wurde klar, dass Lyrik für mich genau das Richtige war. Williams hatte ein schönes Buch nach dem anderen im Verlag New Directions veröffentlicht und wurde wie ein VIP behandelt. Ich wusste, dass ich besser schreiben konnte als er. Ich dachte, wenn er es mit ein paar weißen Hühnern, einer regennassen roten Schubkarre und kalten Pflaumen im Eisschrank zu Ruhm bringen konnte, dann könnte ich es auch schaffen. Dylan Thomas war mein Vorbild, aber es war Williams, der mich meine Berufung erkennen ließ. Komisch, auch wenn ich nie viel Interesse an Williams entwickelte, sind seine Objekte fraglos die Highlights dieses Abschnitts. Objektivismus nannte man damals.
Kapitel Sechs
Einen Tag nach Weihnachten 1966 bestieg ich den Bus nach New York. Vier oder fünf Jungs von Sanford machten Ferien in der Stadt. Ich teilte mir mit zwei von ihnen ein Hotelzimmer in der Nähe des Washington Square Park. Wir kauften auf der Straße schlechtes Gras und tranken, und dann, als sie zur Schule zurückkehrten, war ich allein und fast pleite. Ich suchte in den Kleinanzeigen nach einem Job, und schon am nächsten Tag arbeitete ich als Regalauffüller im Kaufhaus Macy’s. Ein junger puertorikanischer Kollege mit großer Afrofrisur war bereit, mich als Mitbewohner aufzunehmen. Ich zog aus meinem Billighotel aus und in sein winziges möbliertes Zimmer am Irving Place 1, Ecke Fourteenth Street ein. Dort gab es ein Bett und einen Schrank, einen kleinen Tisch und eine Spüle. Das Klo war auf dem Flur. Die Miete betrug 20 Dollar die Woche, was wir uns teilten.
Wir wohnten über einer Horn and Hardart-Filiale – ein Automatenrestaurant, wo man auch Pastetenstücke, Makkaroni und frittierte Fischfilets kaufen konnte, die aus kleinen Fenstern gereicht wurden. Einen Abräumservice gab es nur sporadisch, also konnten wir uns vollschlagen, indem wir uns an einen Tisch setzten, der gerade freigeworden war, und das essen, was übrig geblieben war. Mein Zimmergenosse nannte sich einen klassischen Komponisten. Er hatte einige zerknitterte leere Notenblätter, vor denen er manchmal saß und die er anstarrte, während er hin und wieder einige Noten auf die Linien schrieb. Er trank viel. Wir mussten das Bett teilen, und oft kam er mitten in der Nacht betrunken zurück, ließ sich aufs Bett fallen und übergab sich. Es war eine kleine Operette für sich.
Nach ein paar Monaten hatte ich genug gespart, um mir ein Apartment zu besorgen. Von da an hatte ich immer neue Jobs und wechselte ständig die Wohnung. Beides war so reichlich vorhanden, dass es für mich keinen Grund gab, einen Job zu behalten, wenn ich genug verdient hatte, um zwei Wochen ohne Arbeit zu verbringen, und es gab keinen Grund, die Miete zu bezahlen, wenn mein Einkommen zu niedrig war, da erst einige Monate vergehen mussten, in denen man keine Miete gezahlt hatte, bevor der Vermieter einen rechtmäßig rauswerfen konnte. Alle meine Apartments waren klein, die meisten waren dunkel, und einige ein wenig gefährlich. An sieben Behausungen zwischen 1967 und 1975 kann ich mich noch erinnern, und ich weiß noch, als was ich in jenem ersten Jahr arbeitete: Regalauffüller bei Macy’s, Haustürverkäufer für Zeitschriftenabonnements, Regalauffüller in einer Buchhandlung und Hilfsbibliothekar in der Hauptstelle der New York Public Library in der Fifth Avenue, und ich bin sicher, es waren noch mehr Jobs. Später fuhr ich Taxi, machte eine Menge ungelernter Bürotätigkeiten im Auftrag einer Zeitarbeitsfirma, sortierte Briefe in einem Postamt, lud nachts am Hafen in Crews Obst- und Gemüsekisten ab und schleppte als Bauarbeiter fünfzig Pfund schwere Zementsäcke auf Mietshausdächer.
Bei einem dieser Bauarbeiterjobs sah mich Allen Ginsberg. Ihm gefiel mein Aussehen, und er lud mich zu sich ein. Das erinnerte mich an Walt Whitman, der die schweißglänzenden Oberkörper von Arbeitern bewunderte. Ich lehnte seine Einladung ohne zu zögern ab, da mich seine Arbeiten nicht interessierten und ich keine engere Beziehung zu Ginsberg fühlte, und außerdem wollte ich keinen schwulen Typen zu ermutigen, mich anzumachen, auch wenn es mich nicht störte.
Kellnern war ein Job, der für mich nie in Frage kam. Ich hätte es nicht gekonnt, Gäste anzulächeln und wegen Trinkgelder höflich zu sein.
Wenn man es ertragen konnte, irgendwo für das gesetzlich vorgeschriebene Minimum von fünf Monaten zu arbeiten, dann versuchte man, es so hinzukriegen, dass die Entlassung als unverschuldet und unvermeidlich erschien, denn dann bekam man Arbeitslosigkeitsschecks.
Es gab Wege, sich für öde Jobs zu entschädigen: kleine Diebstähle vor allem, aber meine große Erleuchtung war die Strategie, die ersten drei Wochen so brauchbar und fleißig zu sein, dass ich unverzichtbar erschien, und dann konnte ich monatelang faulenzen, bevor der erste Eindruck nachließ. Wenn ich Glück hatte, dann wurde mir so viel Respekt entgegengebracht, dass ich glaubhaft versichern konnte, persönliche Probleme würden meine Leistung untergraben, bevor der Boss mich entließ. So konnte ich wieder das Arbeitslosengeld einstreichen.
Ich hatte als ignoranter Teenager einige Schreibversuche unternommen, aber ohne irgendein reales Fundament von Werten außer dem niedrigsten, nämlich mein armes, einsames, sentimentales, grandioses, poetisches Selbst ausdrücken zu wollen. Ich vertraute auf meine Einsichten in Situationen und Menschen und auch auf mein elementares ästhetisches Urteilsvermögen. Aber für eine ganze Weile (was in diesem Alter drei oder vier Jahre waren) war ich nur ein Schriftsteller, weil ich mich selbst für einen solchen hielt. Ich schrieb nicht sehr viel, und was ich schrieb, war nicht gut. Das meiste ahmte Dylan Thomas nach (eines meiner frühesten New Yorker Gedichte begann »Rain me green on stones unseething«). Viele Gedichte handelten von dem Verlangen, sich aufzulösen, und von Sex (artifiziell oder unter der Tarnung von Symbolen und Gleichnissen) und von einer Angst vor irgendeiner grässlichen Schwäche in mir selbst. Als Dichter oder Schriftsteller konnte ich als Beispiel dafür dienen, wie eine Maske, die du lange genug trägst, zu deinem Gesicht wird, oder, um es freundlicher zu sagen, wie eine Berufung als Pose beginnt.
Ich schrieb mich für einen Lyrik-Workshop an der New School ein in der Hoffnung, vielleicht Leute zu treffen, die an einigen der gleichen Themen interessiert waren wie ich. Ich hatte Pech mit der Klasse, traf aber ein trauriges, hysterisches Mädchen mit roten Kapillaren in der Nase und Wangenknochen und großen Brüsten, die aussahen wie Eeyore (der Esel aus Winnie the Pooh). Sie ließ mich Sex mit ihr haben.
Der Typ, der die Klasse unterrichtete, war ein ehemaliger Dichter namens José Garcia Villa. »Ehemalig«, weil es zu seiner Selbstdramatisierung gehörte, Ende der fünfziger Jahre mit dem Schreiben aufgehört zu haben, um sich »nicht zu wiederholen«. Er war ein Filipino, geboren 1908 in Manila, lebte aber, seit er einundzwanzig war, meistens in New York. Er erregte ein wenig literarisches Aufsehen in den vierziger und frühen fünfziger Jahren.
Sein poetisches Vokabular war nicht weit entfernt von Dylan Thomas’, enthielt vielleicht auch ein wenig von Blake und Rilke und favorisierte Worte wie »naked« und »bright« und »rose« und »lion« – aber besonders und höchst verräterisch »I« und »God« (über deren beider Wege er seine Leser gerne instruierte) – in sauberen aphoristischen Zeilen.
Jedenfalls veranstaltete er die Workshops nicht zuletzt deswegen, um über einen Zirkel zu präsidieren. Neben dem wöchentlichen Unterricht an der Schule in der West Twelfth Street gab es samstags ein geselliges Treffen in seinem Apartment und ein weiteres jeden Dienstag in einer Smith’s Bar in der Sixth Avenue, Ecke Fourteenth Street. Jeder der Teilnehmer bemühte sich, so lässig arrogant und sexuell provozierend zu sein und so sarkastisch über Dichter geringerer Sensibilität zu urteilen wie er. Ich war der jüngste Student. Villa verkündete allen, ich sei »der am poetischsten Aussehende« und einer der »Kränksten, was eine Voraussetzung für das Verfassen anständiger Gedichte ist«.
Welche Richtung auch immer ich nehmen würde, ich wollte in Bewegung bleiben, und so begann ich, noch bevor 1967 vorbei war, ein Lyrikmagazin zusammen mit einem anderen Studenten aus der Gruppe namens David Giannini herauszugeben. Giannini war etwa so alt wie ich, war vor kurzem aus New Jersey in die Stadt gekommen und war lyrikbesessen. Er sah mehr skandinavisch als italienisch aus – groß und muskulös, dünnes blondes Haar. Er trug eine Brille mit Drahtgestell, ein Arbeitshemd, Cordjeans und Hush Puppies. Er trieb Sport, um in Form zu bleiben, und hatte einige pummelige, aber durchaus sexy Langzeitfreundinnen, die wir oft sahen und die seit der High School in seine poetische Begabung und seine Sexspäße vernarrt waren. Wie Villa liebte er es auch, aphoristisch zu reden, und glänzte mit fragwürdigen Bemerkungen wie »Picassos Nackte habe ihre blaue Periode«.
Getreu unserer lyrischen Neigung nannten wir das Magazin Genesis : Grasp. Die sechs Ausgaben, die wir über vier Jahre (1968-71) veröffentlichten, präsentierten einen Anfang, der eher einer Totgeburt glich. Die ersten drei Nummern waren selbstgefällig, unkoordiniert und amateurhaft wie das Literaturblatt einer High School. Um dem Magazin Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, es hatte sich bis zur letzten Nummer, einer Doppelausgabe (#5/6), sehr verbessert. Aber inzwischen hatte ich mich schon in Anspruch und Einstellung weit von meinem Mitherausgeber entfernt, und ich gab die letzten drei Nummern größtenteils allein heraus. Ich druckte sie auf einer gebrauchten, kleinen Wachsmatritzendruckmaschine in meinem Apartment und machte den Schriftsatz auf einer gemieteten IBM VariTyper.
Ich hatte in jenen Jahren eine weitere bescheidene öffentliche Existenz als Dichter. Als wir mit dem Magazin begannen und ich eine Reihe von Gedichten geschrieben hatte, schickte ich einige an James Laughlin, Verleger von New Directions Books, und fragte, ob sie für das nächste Annual des Verlags in Frage kämen. Meiner Meinung nach war Laughlins Verlag damals der angesehenste in Amerika. Nicht nur war er Dylan Thomas’ amerikanischer Verleger, sondern er veröffentlichte auch Céline, Nabokov, Wilfried Owen und Rimbaud (ganz zu schweigen von Henry Miller, William Carlos Williams und Ezra Pound) und viele andere der literarisch ehrgeizigsten und kühnsten internationalen Schriftsteller. Das Annual war eine Hardcover-Anthologie neuer Arbeiten, die seit Mitte der dreißiger Jahre erschien. In der Ausgabe von 1970 veröffentlichte Laughlin acht meiner Gedichte, die ich in den Vorjahren geschrieben hatte, als ich achtzehn und neunzehn war. Sie waren schrecklich – gestelzt, bombastisch und sentimental. Vier weitere Gedichte erschienen in dem folgenden Jahrbuch, einige waren geringfügig besser. Aber je besser ich wurde, desto weniger schien ihm zu gefallen, was ich tat. Doch noch hielt ich New Directions für meinen Verlag. Laughlin bestärkte mich in dem Glauben, dass er eines Tages ein Buch von mir herausbringen würde, aber zu dem Zeitpunkt, da ich mit einundzwanzig eins fertiggestellt hatte, das mir gefiel, betitelt Baby Hermaphrodite Rabbits, meinte er, es sei nicht gut genug. Einige Jahre später, als ich bereits eine Weile Rock’n’Roll gespielt hatte, kontaktierte ich ihn wieder in der Hoffnung, dass er an der kommerziellen Publikation eines Buches interessiert sein mochte, für das ich zusammen mit Tom verantwortlich war und in das ich vollstes Vertrauen hatte – Wanna Go Out! von Theresa Stern (mehr darüber später) –, aber er äußerte sich nur verächtlich darüber, und das war das Ende unserer Beziehung.