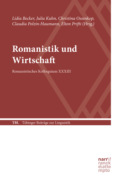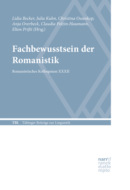Kitabı oku: «Das Verständnis von Vulgärlatein in der Frühen Neuzeit vor dem Hintergrund der questione della lingua», sayfa 10
4.1.1.4 Spätlatein
Die Frage, ab wann die Epoche des Spätlateins anzusetzen ist, hängt eng mit der unterschiedlich gehandhabten Begrenzung des Klassischen bzw. vor allem des Nachklassischen Lateins zusammen (v. supra), während ihr unscharfes Ende in erster Linie mit der Herausbildung der Romanischen Sprachen verknüpft ist. Müller-Lancé (2006:34) verweist deshalb mit Recht auf den Charakter einer Übergangsepoche. Es sei aus der dort gegebenen, relativ exakten Datierung (ca. 180–650 n. Chr.) und der ebenfalls präzisen, aber leicht verschobenen bei Steinbauer (2003:513), nämlich ca. 200–600 n. Chr, hier eine etwas fließenderen Grenze angenommen, d.h. ein Zeitraum vom 2./3. Jh. – 5./6. Jh. postuliert. Das etwas frühere Ende sei damit begründet, daß mit dem Fehlen der Reichseinheit spätestens ab dem 7. Jh. geistes- und kulturgeschichtlich genauso wie politisch eine andere Ära beginnt. Der Beginn der spätlateinischen Epoche fällt mit dem von Berschin (2012:94) charakterisierten „dunklen III. Jahrhundert“ zusammen, in dem nicht viel von der lateinischen Kultur überliefert ist, aber sich ein Wandel in Schrift, Sprache und Literatur vollzog.
Aus der soziolinguistischen Sicht des sprachlichen Ausbaus ist für die spätlateinische Phase vor allem die neu aufkommende christliche Literatur von Relevanz, die sich in vielen Facetten zeigt. Ohne in vollem Umfang auf alle Schriftsteller und Genres eingehen zu können, seien hier an erster Stelle die lateinischen Kirchenväter (patres ecclesiae) genannt, und zwar die kanonischen großen vier: Ambrosius (Aurelius Ambrosius, 339/340–397 n. Chr.), Hieronymus (Sophronius Eusebius Hieronymus, 345/348–420 n. Chr.), Augustinus (Aurelius Augustinus, 354–430 n. Chr.) und Gregor d. Große (Gregorius, 540–604 n. Chr.).
Chronologisch sollen zunächst aber einige andere wichtige Vertreter aus der Reihe der Kirchenlehrer genannt sein, die den Ausbau der religiösen Fachliteratur maßgeblich vorangetrieben haben. Dabei ist sicherlich an erster Stelle Tertullian (Quintus Septimus Florens Tertullianus, ca. 150/170–220 n. Chr.) zu nennen, von dem ein umfangreiches und vielfältiges Schrifttum überliefert ist. Dabei kann man das Gesamtwerk in apologetische Schriften (z.B. Ad nationes, Apologeticum, De Testimonio animae, Adversos Iudeos), in praktisch-asketische Schriften (z.B. Ad martyras, De spectaculis, De baptismo) und in dogmatisch-polemische Schriften (z.B. De praescriptione haereticorum, Adversos Praxean) gliedern. Seine literarischen Modelle sind zum einen bei den zeitgenössischen christlichen griechischen Autoren zu suchen, aber auch in der klassischen Philosophie (Platon, Stoa). Ein prägendes Moment ist dabei auch die Auseinandersetzung mit aktuellen Strömungen wie dem aufkommenden Gnostizismus. Dabei legt Tertullian nicht nur die Grundlage für eine facettenreiche religiöse Literatur des Lateinischen im Allgemeinen, sondern schafft mit seiner Art der Apologetik (werbend und verteidigend zugleich) ein neues Subgenre, welches so zuvor weder in der lateinischen noch in der griechischen Tradition existierte (cf. Albrecht 2012 II:1315–1324).
Ein wahrscheinlich etwas jüngerer Zeitgenosse Tertullians ist Minucius Felix (2./3. Jh. n. Chr.), von dem nur die Schrift Octavius überliefert ist.208 In dieser dialogisch gestalteten erstmaligen Auseinandersetzung mit den paganen Überzeugungen aus christlicher Perspektive werden Vorbilder wie Homer, Platon, Cicero, Seneca oder Vergil sichtbar (cf. Albrecht 2012 II:1337–1340).
Als ein weiterer nicht unbedeutender Vertreter aus dem Kreis der frühen Kirchenlehrer ist Cyprian (Thascius Caecilius Cyprianus, ca. 200/210–258 n. Chr.) zu nennen, der im Zuge der Profilierung der frühen katholischen Lehre sowohl wichtige Bekehrungsschriften (z.B. Ad Donatum, Ad Detrianum, De ecclesiae catholicae unitate) wie auch die Gattung der Erbauungsschriften (z.B. De habitu virginum, De dominica oratione) hervorgebracht hat (cf. Albrecht 2012 II:1348–1351).
Ebenfalls zu den Großen und Einflußreichen gehört Laktanz (Lucius Caecilius Firmianus Lactantius, ca. 250–320), der in seinen Divinae institutiones Elemente aus der juristischen Tradition mit solchen aus der Rhetorik verbindet. Neben weiteren wichtigen apologetischen Schriften wie De opificio Dei, De ira Dei oder De mortibus persecutorum – wobei vor allem letzteren eine größere Nachwirkung beschieden war, nicht zuletzt als Geschichtsquelle – soll er auch weltliche Schriften verfaßt haben, die allerdings nicht erhalten sind (Symposium, Itinerarium, Grammaticus) (cf. Albrecht 2012 II:1370–1371).
Was die sogenannten großen Kirchväter anbelangt, so ist zunächst Ambrosius zu nennen, der ein vielseitiges Œuvre hinterlassen hat, bestehend aus moralisch-asketischen Schriften (De officiis ministorum, Exhortatio virginitatis, De Tobia), dogmatischen Schriften (De fide, De spiritu sacto, De incarnationis dominicae sacramento), einer politischen Flugschrift (Contra Auxentium de basilicis tradendis), Trauerreden, Hymnen und einer verlorenen philosophischen Abhandlung (De philosophia). Dabei war auch bei ihm, wie im Falle anderer Kirchenlehrer, der griechische Einfluß durch seine klassische Vorbildung gegeben. Er hat unzweifelhaft Philosophen wie Plotin (Πλωτῖνος, 205–270 n. Chr.) oder Porphyrios (Πορφύριος, ca. 233–305 n. Chr.) genauso rezipiert wie römische kanonische Autoren (z.B. Cicero, Vergil) (cf. Albrecht 2012 II:1402–1406).
Hieronymus ist vor allem wegen seiner Bibelübersetzung in die Geschichte eingegangen, der Vulgata.209 Dabei ist bemerkenswert, daß er nicht nur selbsverständlicherweise Griechisch konnte, sondern auch Kenntnisse des Hebräischen hatte, um eine bessere Übertragung bzw. Exegese leisten zu können. Seine schriftstellerische Tätigkeit umfaßte auch weitere Übersetzungen (vor allem exegetischer Predigten), Kommentare zu biblischen Büchern, Briefe, Predigten sowie Streitschriften (z.B. Adversos Rufinum, Contra Pelegianos), Hagiographien und eine christliche Literaturgeschichte (De viris illustribus) nach griechischem Vorbild (cf. Albrecht 2012 II:1415–1417).
Der wirkungsmächtigste Kirchenvater war wohl Augustinus mit einem umfangreichen Gesamt-Opus, darunter philosophische Schriften (Soliloquiorum libri duo, De magistro, De immortalitate animae), philosophisch-rhetorische (De grammatica, De doctrina christiana), apologetische (De divinatione daemonum, De civitate Dei), dogmatische (De fide et symbolo, De agone Christiano, De trinitate libri XV), dogmatisch-polemische (De libro arbitro) und hermeneutische (De doctrina christiana), von denen viele für die christlichen Theologie fundamental wurden. Die breiteste Rezeption erfuhr er aber wohl mit seiner autobiographischen Schrift, den Confessiones. Augustinus bedient sich in seinen Einzelwerken der gesamten Bandbreite griechisch-lateinischer Literatur, die zu seiner Zeit gängig war (cf. Albrecht 2012 II:1431–1436).
Gregor d. Große (Gregorius, ca. 540–604 n. Chr.) schließlich, Papst (590–604 n. Chr.), verfaßte anhand eines Bibelkommentars eine Moraltheologie (Moralia in Job), zahlreiche Homilien, Pastoralen (Regula pastoralis) und hinterließ ein umfangreiches Korpus an Briefen. Insbesondere seine Heiligenlegenden in Form von Dialogen (Dialogi) wurden in den folgenden Jahrhunderten häufig rezipiert (cf. Heim 2001:147).
Der Wissenschaftsbereich der Historiographie wird durch Historiker wie Ammian (Ammianus Marcellinus, 330–395 n. Chr.) mit seinen an Tacitus anknüpfenden in annalistischer Tradition stehenden Res gestae oder Jordanes (6. Jh.) mit seiner Gotengeschichte (Getica) und einer Weltchronik (De summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum) weiter gepflegt (Kleine Pauly 1967 II:1439).210 In der Philosophie sei vor allem auf Boethius (Anicius Manlius Severinus Boethius, ca. 480–525 n. Chr.) verwiesen, der durch seine Consolatio philosophiae breite Nachwirkung erfuhr, aber auch durch seine Übersetzungen, Kommentare und weiteren Schriften zu anderen Fachbereichen wirkte (z.B. Logik: De categoria syllogismis, Mathematik: Institutio arithmetica) (cf. Albrecht 2012 II:1470–1475). Die Grammatikschreibung zeitigt mit den Werken Donats (Aelius Donatus, ca. 310–380 n. Chr., Ars grammatica) und Priscians (Priscianus Caesariensis, 5./6. Jh., Institutio de arte grammaticae) in dieser spätlateinischen Phase die wichtigsten Inspirationsquellen der folgenden Jahrhunderte (cf. Brodersen/Zimmermann 2000:145, 492).
Die schöne Literatur wird ebenfalls weiterhin gepflegt, wenn auch nicht mehr in gleichem Umfang und vor allem nicht mehr mit gleichem Rezeptionsgrad wie zuvor. Exemplarisch soll hier in erster Linie der Dichter Ausonius (Decimus Magnus Ausonius, ca. 310–393/394) genannt werden, dem mit Werken wie der Mosella, Bissula oder dem Ordo urbium nobilium ein gewisser Nachruhm beschieden war. Gerade mit letzterem, bei dem er Elemente des griechischen Epigramms und der descriptiones verbindet, schafft er einen neuen Gedichttypus, genauso wie mit seiner commemoratio, dem Weih- oder Gedenkgedicht, welches eine Mischung aus laudatio und Epikedeion darstellt (cf. Albrecht 2012 II:1129–1131). Erwähnt sei auch noch der Dichter Prudentius (Aurelius Prudentius, 348–405 n. Chr.), insofern sich in seinem Werk christliche Inhalte mit antiken Traditionen verbinden, wie beispielsweise in dem Lehrgedicht Psychomachia, in dem in Hexametern christliche Allegorien und Tugendvorstellungen mit Bezügen auf Vergils Aeneis ausgearbeitet wurden. In Contra Symmachum setzt er sich mit dem restaurativ-paganen Dichterkreis um Symmachus (Quintus Aurelius Symmachus, ca. 340–402 n. Chr.) auseinander,211 während in anderen Werken rein christliche Themen dominieren (Peristephanon, Apotheosis, Kathemerinon) (cf. Brodersen/Zimmermann 2000:497).
Aus der Sicht des sprachlichen Ausbaus ist zu konstatieren, daß sich in der spätlateinischen Phase am Zustand des Lateins im Sinne einer vollausgebauten Sprache nichts Wesentliches ändert. Die meisten Diskurstraditionen wurden weiter gepflegt, mitunter nicht in gleichem Umfang, aber dafür kamen durch neue Themenbereiche, und zwar in erster Linie solche mit christlichem Bezug, neue Arten von Textgattungen auf, wie z.B. Hagiographien, Predigten, dogmatische oder apologetische Schriften, die es zumindest in dieser Form zuvor im Lateinischen noch nicht gegeben hatte (v. supra). Der ganze Fachbereich der Theologie im weitesten Sinne erfuhr somit einen Ausbau, der vor allem mit zahlreichen Entlehnungen aus dem Griechischen einherging. Eine gewisse variatio ist aber durchaus auch bei etablierten Textgattungen festzustellen (cf. z.B. Lyrik des Ausonius), so daß sich vereinzelt neue Subgenres herausbildeten. Ein „Niedergang“, wie er aus der traditionellen, wertenden Perspektive der Klassischen Philologie meist festgestellt wurde, ist aus sozio-linguistischer Sicht, also in Form eines Rückbaus der Sprache, sicherlich nicht festzustellen, da ja nicht nur weiterhin die bereits kanonische Literatur tradiert und rezipiert wird, sondern eben neue Bereiche oder Subbereiche für das Lateinische erschlossen werden.
In Hinsicht auf die sprachliche Situation ist für die Spätantike mit einer weiterhin zunehmenden Romanisierung und Latinisierung zu rechnen, vor allem in den Regionen des Imperium Romanum, die erst später erobert wurden, sowie solchen die infrastrukturell eher entlegen waren oder sozio-strukturell divergierend. So schließen beispielsweise Berschin/Felixberger/Goebl (2006:162) aus einer Passage bei Hieronymus, daß gegen Ende des 4. Jh. in Trier an der Mosel (römische Randzone, aber auch Kaiserresidenz) noch Keltisch gesprochen wurde, immerhin über 400 Jahre nach der Eroberung Nordgalliens. Für die Iberische Halbinsel, die wie Gallien insgesamt als bereits tiefgreifend romanisiert gelten kann, vermutet Curchin (1991: 179–181, 190–192), daß sich im Siedlungsgebiet der Kantabrer (lat. Cantabrii) bedingt durch die dort vorherrschenden Gentilverbände und die fehlende urbane Struktur, die Romanisierung partiell bis ins 5. Jh. hingezogen habe, womöglich vollständig erst nach dem Zusammenbruch des Imperiums erfolgt sei. Trotz gewisser Einzelfälle und Randzonen wie Britannien oder Dakien mit geringerem Grad an Romanisierung und Latinisierung ist insgesamt für das Imperium im Laufe der Jahrhunderte von einer starken sprachlichen und kulturellen Assimilation von weiten Teilen der Bevölkerung auszugehen, nicht zuletzt auch durch die von Caracalla (Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus, 188–217 n. Chr., Ks. ab 211) erlassene Constitutio Antoniniana (212 n. Chr.), mit der allen Reichsbewohnern das uneingeschränkte Bürgerrecht verliehen wurde. Das römische Reich blieb zwar ein Raum der Mehrsprachigkeit, nicht zuletzt weil in der Spätphase größere Kontingente von Völkern mit verschiedenen germanischsprachigen Idiomen innerhalb der Reichsgrenzen angesiedelt wurden bzw. dorthin vordrangen, was entgegen dem gängigen Modell von Dietrich/Geckeler (2007:172) eine Gleichzeitigkeit von Sub- und Superstratsprachen ergeben konnte.212 Auf der anderen Seite nahm durch die zunehmende Latinisierung auch die Zahl der Personen, die muttersprachlich nur eine lateinische Varietät zur Verfügung hatten, deutlich zu. Wie man exemplarisch an den christlichen Kirchenlehrern sieht, blieb das Griechische dabei Bildungssprache für die römische Elite im gesamten Imperium,213 die sich somit weiterhin in einer Art Diglossie-Situation befanden, wobei das Schriftlatein allerdings nun endgültig auch den Rang einer high-variety in allen Bereichen innehatte.
Durch die Verbreitung und Etablierung des Lateins in zahlreichen Regionen Europas und rund ums Mittelmeer (mare nostrum) entsteht einerseits eine allgemeine gesprochene lateinische Sprache, die man in Anlehnung an die griechische Konstellation als koiné bezeichnen kann, und andererseits isoliert sich ein vorwiegend schriftlich gebrauchtes Latein, welches als Bildungssprache morphologisch erstarrt und in seiner Grammatik konserviert ist (cf. latinitas perennis). Das nachmalig als „klassisch“ apostrophierte Latein entsteht, indem das Latein ausgewählter Autoren einer bestimmten historischen Epoche kanonisiert wird und dem natürlichen sprachlichen Erneuerungszyklus enthoben wird (cf. Poccetti/Poli/Santini 2005:325–326).
4.1.2 Der Varietätenraum
Bei einer Beschreibung des Varietätenraumes des Lateinischen als lebendige Sprache ergibt sich zunächst einmal, wie aus oben ausgeführter Periodisierung hervorgeht, die Problematik, daß sich das Latein im Laufe seiner über tausendjährigen Sprachgeschichte nicht nur bezüglich einzelner sprachlicher Merkmale verändert hat, sondern durch seine Expansionskraft auch seine Verbreitung in den verschiedenen Regionen der Welt sowie damit einhergehend die Zahl seiner Benutzer enorm gestiegen ist. Dies wiederum bedingt einen erheblichen Zuwachs an sprachlicher Beeinflussung durch Substrat- und Adstratsprachen, die im Latein ihre Spuren hinterlassen haben. Durch diese im Laufe der Zeit sich stark verändernden Konstellationen ist es notwendig, daß auch eine historische Komponente bei der Erfassung der Architektur des Lateinischen Berücksichtigung findet.
Traditionell wird in der Klassischen Philologie der sprachlichen Variation relativ wenig Raum gegeben bzw. spielt allenfalls im Rahmen von stilistischen Betrachtungen eine Rolle. Die Frage nach der Existenz verschiedener Varietäten scheint hierbei eher untergeordnet und wird meist ohne größere Diskussion um eine eventuell mögliche linguistische Verortung abgehandelt, was nicht nur an der für das Lateinische als nicht mehr lebendige Sprache nicht immer einfachen Belegsituation zusammenhängt.
Exemplarisch für die traditionelle Sicht und die ältere Forschung sei hier auf Leumann/Hoffmann (1928) verwiesen, die die komplette Variation inklusive diachroner Implikationen in einem einzigen Kapitel abhandeln (ibid.: 9–11), und zwar unter dem Titel Vulgärlatein und Romanisch, Umgangssprache, Schriftsprache. Hierbei sind bereits mit den Termini ‚Umgangssprache‘ und ‚Vulgärlatein‘ die beiden wichtigsten Varietäten jenseits der standardisierten Schriftsprache in der traditionellen Betrachtung angesprochen. Diese finden sich genauso in der modernen Forschung: In dem Überblick bei Irmscher (1986:84–85), bei Reichenkron (1965)214 wie auch in der aktuellen Einführung zur Klassischen Philologie von Willms (2013:230, 239). Dies bedeutet auch, daß die komplette diasystematische Variation im Wesentlichen an einem Begriff aus der Germanistik, der eigentlich Verhältnisse des Deutschen wiedergibt, aufgehängt ist (‚Umgangssprache‘)215 sowie an einem Terminus, der in der Forschung mit den unterschiedlichsten Konzepten aufgeladen wurde (‚Vulgärlatein‘).216 An diese Tradition der Bezeichnung und Kategorisierung knüpft auch der Klassische Philologe und Romanist Kramer (1997) an, der fast alle Varietäten in dem Kapitel Die lateinische Umgangssprache behandelt (ibid.: 156–162), dort allerdings den Begriff, unter dem der größte Teil der Variation fällt, dann kritisch beleuchtet. Ein anderen Ansatz hat Müller (2001), der von den lateinischen Bezeichnungen (sermo rusticus, sermo agrestis, sermo plebeius etc.) ausgeht und deren Verwendungsweisen bei den antiken Autoren analysiert, um daraus abzuleiten, welches Sprachbewußtsein im Hinblick auf Varietäten in der Antike herrschte.
Im Folgenden soll jedoch versucht werden, die Variation im Lateinischen, soweit sie erfaßbar ist, mit Hilfe des Diasystems strukturiert darzustellen wie es in ersten Ansätzen bereits von Herman (1996), Müller-Lancé (2006:45–58), Koch (2010:188–189), Reutner (2014:199–203) oder Lüdtke (2019:450–453) geleistet wurde.
4.1.2.1 Die diatopische Ebene
Da die Verbreitung der lateinischen Sprache sich im Laufe der Jahrhunderte erheblich verändert hat, d.h. ein regional sehr begrenztes Idiom entwickelte sich zur wichtigsten Sprache in großen Teilen Europas und darüber hinaus, ist auch eine Betrachtung der diatopischen Gliederung des Lateins nicht ohne eine diachrone Perspektive möglich (v. supra).217
Die indogermanischen Proto-Latiner, Träger der lateinischen Sprache, die ab dem 10 Jh. v. Chr. in Teilen der Region Latium seßhaft wurden und dort Streusiedlungen errichteten (präurbane Phase), die sich bis zum 6. Jh. v. Chr. teilweise zu kleineren urbanen Zentren entwickelten, gliederten sich ursprünglich in politisch gleichberechtigte populi in autonomen Gemeinden. Die sich in diesem Zeitraum konstituierende cultura laziale bildete mit ihren Ansiedlungen und Sakralverbänden eine lose Gemeinschaft. Mit dem Wandel zur Urbanität ab dem 6. Jh. v. Chr. und der Gründung des Latinischen Städtebundes (nomen Latinum bzw. nomen Latium) gewinnt die Gesellschaftsstruktur in Latium Kontur. Es ist anzunehmen, daß die einzelnen gentes dieser Region Träger von Idiomen mit sprachlichen Eigenheiten waren, die sich voneinander abgrenzten (cf. Palmer 1990:62; Neue Pauly 1999 VI:1165–1169; Aigner-Foresti 2003:19–20).
Appliziert man nun die auf sozio-politisch, historischen Merkmalen beruhende Unterkategorisierung der dialektalen Ebene nach Coseriu (v. supra), so kann man mit Müller-Lancé (2006:45) diese Varietäten der Latini als primäre Dialekte des Lateinischen deklarieren. Der Dialekt der Stadt Rom war dabei zunächst nur einer unter vielen. Erst mit der beginnenden regionalen Expansion Roms und den Auseinandersetzungen mit den latinischen Nachbarn (Latinerkriege) ab dem frühen 5. Jh. v. Chr., die mit der Auflösung des Latinerbundes (338 v. Chr.) endeten, gewinnt das stadtrömische Latein an Prestige gegenüber den anderen verwandten Varietäten der Region.
Angesichts der bescheidenen Quellenlage für die Frühzeit, für die nur wenige, laut Palmer (1990:65) „nichtssagende Fragmente“ zur Verfügung stehen, ist es schwierig, den sprachlichen Abstand zwischen den einzelnen Varietäten festzustellen. Im Gegensatz zu Seidl (2003:522), der die dialektalen Unterschiede im frühen Latium als eher gering einstuft,218 postuliert Müller-Lancé (2006:47), daß der Dialekt der Stadt Rom „stark“ von denen seiner Nachbarn abwich. Allerdings zieht er zum Vergleich als erstes Beispiel eine Inschrift aus Falerii heran, die üblicherweise als faliskisch eingeordnet wird (cf. Meiser 2010:9–10, § 6.1) und nicht als lateinisch. Hinzu kommt, daß er diese frühfaliskische Inschrift aus dem 4. Jh. v. Chr. dem klassischen Latein und nicht dem Altlatein gegenüberstellt, doch selbst zur altlateinische Periode wäre eine noch nicht unerhebliche zeitliche Diskrepanz zu konstatieren.219 Das faliskische Original lautet: foied uino pipafo cra carefo – foied uino pafo cra carefo (cf. Baldi 2002:125). Dies würde im Altlatein die Entsprechung hodie vinom bibabo, cras carebo (cf. Quiles 2009:63) haben und im klassischen Latein hodiē vīnum bibam, crās carēbō (cf. Baldi 2002:125), also übersetzt ‚heute will ich Wein trinken, morgen werde ich es mir versagen‘ (Müller-Lancé 2006:47). Immerhin ist aber auf diese Weise der Abstand vom nah verwandten Faliskischen zum Lateinischen zumindest nährungsweise erkennbar. So ist intervokalisch faliskisch f bzw. lateinisch b aus indgerm. bh > b (lat.) bzw. > f (falisk.) zu erklären (cf. carefo vs. carebo), im Faliskischen ist der Verlust der Auslautkonsonanten (cf. uino vs. vinom; cra vs. cras) sichtbar220 und im Lateinischen die Weiterentwicklung zu h, also indogerm. gh > f > h (cf. foied vs. hodie). Morphologisch ist die Futurbildung mit f im Faliskischen auffällig wie in carefo und pipafo (Palmer 1990:62–63; Quiles 2009:63).
Das zweite Beispiel, um den großen Abstand der latinischen Varietäten aufzuzeigen, ist von Müller-Lancé (2006:47), der hier Palmer (1990:63–64) folgt, ebenfalls nicht optimal gewählt, da die Echtheit der Fibula praenestina als umstritten gilt (v. supra). Geht man jedoch von einer authentischen Inschrift aus, zeigen sich an dem Wortlaut Manios : med : vhe : vhaked : Numasioi (klat. Manius mē fēcit Numerio, dt. ‚Manius hat mich für Numerius gemacht‘) einige Eigenheiten der Varietät von Praeneste.221 Dazu gehört die Endung der 3. Person Singular auf –d, die Dativendung -oi und das reduplizierte Perfekt (cf. vhe vhaked), in der sich auch die Verwandtschaft zum Oskischen zeigt (cf. osk. fefakid, fefacust). Palmer (1990:64–65) gibt im Folgenden noch weitere sprachliche Phänomene der frülateinischen Inschriften an, die in Lautung und Morphologie vom späteren standardisierten Latein abweichen, wie z.B. die Entwicklung von d > r vor Labial, was eventuell lat. arbiter als Dialektwort identifizierbar machen würde, außerdem häufige Synkope unbetonter Vokale (z.B. dedront vs. klat. dedērunt) oder die Bewahrung des Nominativ Plural auf –ās (z.B. matronas vs. klat. mātrōnae).
Aufgrund der Tatsache, daß das Lateinische erst ab dem 3. Jh. v. Chr. in längeren Texten faßbar wird, ist ein Vergleich für die Frühzeit schwierig. Es kann allerdings wie anhand der Beispiele ersichtlich, festgehalten werden, daß es eine diatopische Differenzierung gab, über den Grad der Abweichungen insgesamt Aussagen zu treffen bleibt problematisch, genauso wie das Verhältnis zum nahverwandten Faliskischen – also ist hier der Abstand tatsächlich deutlich größer als zu den Dialekten Latiums bzw. um wieviel größer? Ausgehend von der festgestellten Variation ist jedoch festzuhalten, daß der zu Beginn recht kleine geographische Raum – Müller-Lancé (2006:45) spricht von einer Nord-Süd-Ausdehnung von ca. 50 km – in noch kleinere sprachliche Varietäten gegliedert ist. Bei den primären Dialekten des Lateins handelt es sich nach gängigem Verständnis eher um Mundarten (frz. parlers locaux, cf. Müller 1975:109), also areal sehr begrenzte diatopische Varietäten (cf. Sinner 2014:92; v. supra), d.h. kleine urbane Zentren mit dem zugehörigen Umland. Rekurrieren wir auf die Fundorte der frühen Inschriften sowie auf die Städte des Latinerbundes, die die einzelnen populi repräsentieren, so können wir für das Lateinische die Mundarten des Römischen, Pränestinischen, Lanuvinischen, Tiburinischen, Tusculanischen, Satricanischen, Aricianischen, etc. postulieren.
Mit dem Ausgreifen Roms auf seine latinischen Nachbarn beginnt das Lateinische, die anderen Varietäten zu überdachen, zunächst nur aufgrund seiner politischen Vormachtstellung im mündlichen Bereich, später auch im schriftlichen. In Bezug auf die Schriftsprache stand das Latein, außer natürlich mit dem Griechischen und Etruskischen, anfänglich auch in Konkurrenz mit dem Faliskischen, Oskischen, Umbrischen oder Volskischen (nur wenige Inschriften, cf. Meier-Brügger 2002:34, E 429).
Bei der Frage nach der Herausbildung des stadtrömischen Dialekts, der uns zu einem späteren Zeitpunkt in der schriftlichen, standardisierten Form des Klassischen Lateins gegenübertritt, zieht Müller-Lancé (2006:48) die Parallele zur Herausbildung des Französischen aus dem Franzischen von Paris bzw. der Île-de-France.222 Es ist jedoch passender den Befund von Poccetti/Poli/Santini (2005:65) zugrundezulegen, die für Praeneste analog zu Rom von einem Latein mit dreifacher Wurzel sprechen, nämlich einer latinischen, einer etruskischen und einer italischen, welches zusätzlich von griechischen und phönizischen Einflüssen überlagert wird, so scheint es vielmehr so, daß Rom wie auch andere zentrale Orte in Latium ganz allgemein in einem viel größeren Raum kultureller Schnittstellen lagen.223 Der Beitrag der latinischen Nachbarvarietäten zur Formung des stadtrömischen Lateins war sicherlich gegeben,224 ist aber schwierig einzuschätzen. Eindeutig hingegen ist, daß diese Varietäten die lateinischen koiné beeinflußt haben, die sich in der Folgezeit durch die Expansion Roms herausgebildet hat.
Durch das Ausgreifen Roms auf die benachbarten Regionen und die im Folgenden sich in mehreren Etappen vollziehende Eroberung der gesamten italienischen Halbinsel sowie schlußendlich die Beherrschung des gesamten orbis entwickelten sich nach erfolgter Romanisierung und Latinisierung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Westteil des Reiches sekundäre Dialekte des Lateinischen, welches weit über seinen autochthonen Entstehungsraum hinausgetragen wurde. Dabei erscheint es wichtig, neben der von Müller-Lancé (2006:48–49) vorgenommenen arealen Unterscheidung von sekundären Dialekten innerhalb und außerhalb Italiens – was aufgrund einer gewissen Sprachbund-Dynamik durchaus gerechtfertigt ist225 – auch den sprachlichen bzw. typologischen Abstand zwischen den Kontaktsprachen als Kriterium der Differenzierung anzusetzen. Benachbarte nicht verwandte oder nur weitläufig verwandte Sprachen wie das Etruskische oder das Griechische hatten einen gewichtigen Einfluß auf die Herausbildung des Lateinischen, die nahverwandten italischen Sprachen hingegen unterlagen einer „progressiven Assimilation“ (Poccetti/Poli/Santini 2005:89) und teilten nicht wenige Konvergenzphänomene mit dem Lateinischen mit zunehmender unidirektionaler Beeinflußung seitens der prestigeträchtigeren Sprache Roms.
Während also die nicht direkt verwandten, durch einen größeren sprachlichen Abstand gekennzeichneten Sprachen im Laufe des Latinisierungsprozesses eine Marginalisierung erfahren, die die Sprecher zum Sprachwechsel bewegt, so daß diese Sprachen schließlich untergehen und als Substrate wirken, unterliegen die italischen Nachbaridiome zwar prinzipiell dem selben Prozeß, jedoch mit der Nuance, daß sie zuvor vom Lateinischen dialektalisiert werden. Im Zuge der Überdachung durch die lateinische koiné – mündlich wie schriftlich – werden Sprachen wie das Sabinische, Faliskische, Volskische, Samnitische in den Status von Dialekten zurückgedrängt, d.h. wie die meisten Dialekte, nur noch im mündlichen Nähebereich gebraucht.
Poccetti/Poli/Santini (2005:89) sprechen diesbezüglich von einer langen Phase der Diglossie, die bereits recht früh beginnt, also vor der systematischen Romanisierung nach dem Bundesgenossenkrieg (91–89 v. Chr.), was beispielsweise aus der Bitte der Einwohner von Cumae hervorgeht, die im Jahre 180 v. Chr. den römischen Senat darum ersuchen, offiziell das Lateinische übernehmen zu dürfen (cf. Livius XLI, 42). Das autochthone Idiom wird somit schriftlich wie mündlich in die Domänen der privaten Kommunikation und der lokalen religiösen Traditionen verwiesen.226
Nach ihrem Untergang und ihrer Substratisierung, die womöglich aufgrund der zahlreichen Konvergenzen – bedingt durch die genetische Verwandtschaft und durch den sehr engen Sprachkontakt – in anderer, eventuell gradueller Form ablief als beispielsweise bei einem abrupten Sprachwechsel Etruskisch-Lateinisch, trugen die italischen Sprachen wesentlich zur Entstehung von sekundären Dialekten des Lateinischen bei.
Im Zuge der Verbreitung des Lateinischen, welches ab dem 2. Jh. v. Chr. und vor allem ab der Zeitenwende vermehrt in außeritalische Regionen vordringt und schließlich weitestgehend flächendeckende Verwendung in großen Teilen Westeuropas und Nordafrikas findet, ist zu berücksichtigen, daß hierbei nicht nur stadtrömisches Latein exportiert wird, sondern durch viele italische Kolonisten auch deren bereits bestehende sekundäre Varietäten des Lateins.227
Man müßte demgemäß von verschiedenen Schichten sekundärer Dialekte ausgehen, denn die diatopische Differenzierung des Lateinischen in Italien ist früher anzusetzen als diejenige in den entfernteren Provinzen, die zunächst noch nicht romanisiert waren. Die dortigen sekundären diatopischen Varietäten konnten deshalb Elemente aus primären und sekundären Dialekten Italiens enthalten, also z.B. sprachliche Charakteristika des ursprünglichen Latein von Praeneste, des Faliskischen, Oskischen, Etruskischen oder Griechischen.228
Dieser zentrifugalen Verbreitung sprachlicher Eigenheiten aus Italien mit dem unbestrittenen Zentrum Rom sind Migrationsbewegungen verschiedenster Art (Legionen, Kolonisten, Händler, Sklaven, etc.) gegenüberzustellen, die in gewisser Weise quer dazu wirkten. Das stadtrömische Latein – mündlich wie schriftlich – war zwar Bezugspunkt und Referenzgröße, doch die Mobilität im späteren kaiserzeitlichen Reich war nicht unidirektional von der Mitte zur Peripherie. Sprachlich hatte dies zur Folge, daß ein gewisser Ausgleichseffekt entstand, der eine starke Diatopisierung – die bei der Größe des Imperiums ja denkbar gewesen wäre – solange verhinderte, bis das Westreich unterging, die politische und administrative Klammer den Zusammenhalt nicht mehr gewährleistete.229