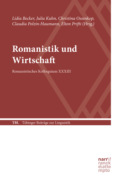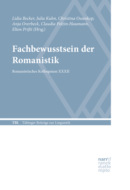Kitabı oku: «Das Verständnis von Vulgärlatein in der Frühen Neuzeit vor dem Hintergrund der questione della lingua», sayfa 14
Coseriu (1954, 1978, 2008) wiederum folgt zwar Herman hinsichtlich der diasystematischen Vielfalt des Lateins, geht aber bezüglich der Terminologie und der Chronologie eigene Wege. Dabei resümiert er zunächst systematisch die „klassischen“ Probleme in der Bestimmung des Vulgärlateins, die wie folgt synthetisiert werden können:
1 Wie ist das Verhältnis zwischen Vulgärlatein und dem klassischen Latein bzw. dem Gesamtlatein?Ist das Vulgärlatein eine eigene, vom klassischen Latein abzugrenzende Sprache?Wenn es keine eigene Sprache ist, wie war dann das Verhältnis dieser spezifischen Form des Lateins zum Gesamtlatein?
2 Welcher Epoche ist das Vulgärlatein zuzurechnen bzw. ist es zeitlich überhaupt begrenzt?274
3 Welcher Art ist die Charakteristik des Vulgärlateins – war es eine eher homogene oder eine heterogene Sprache?275
4 Wie ist die Forschungsdiskrepanz zwischen Latinisten und Romanisten zu bewerten?Das Vulgärlatein besteht auch aus anderen Formen, die nicht im engen, latinistischen Sinne als ‚vulgär‘ zu charakterisieren sind.276Es gibt auch Formen im Vulgärlatein, die mit denen des klassischen Lateins übereinstimmen bzw. bei denen es keine Notwendigkeit der Differenzierung gibt.277Es gibt auch Formen, die man dem Vulgärlatein zurechnet, die nicht in Texten überliefert sind, die man aber aus den romanischen Sprachen rekonstruieren kann.278
Innerhalb dieser von Coseriu (2008:108–110) aufgeworfenen Problemstellungen sind einige, die sich in der heutigen Forschung überholt haben bzw. marginalisiert sind (z.B. Problem der Konnotation von ‚vulgär‘), andere hingegen bleiben weiterhin virulent (z.B. Frage nach dem Verhältnis Vulgärlatein vs. Gesamtlatein und die zeitl. Verortung). Coseriu verweist außerdem auf das Problem der Protosprache und der Rekonstruktion, denn für die Romanistik wird das Vulgärlatein als Vorläufer (Ursprache) der einzelnen romanischen Sprachen gesehen und analog zur Tradition der Indogermanistik arbeitet man auch hier mit rekonstruierten Einzelformen (neben den zahlreichen belegten). Er löst dieses und die oben angeführten Probleme schließlich in streng strukturalistischer Manier und postuliert das Vulgärlatein und das klassische Latein als zwei getrennte, „funktionelle Sprachen“ (Coseriu 2008:111), die innerhalb des Systems einer historischen Sprache existieren. Weiterhin versucht er dabei, latinistische und romanistische Positionen zu verschmelzen und entwickelt eine Chronologie, in der er das Gesamtlatein in fünf Perioden einteilt und jeweils der Entwicklung des Schriftlateins diejenige des mündlichen Sprachgebrauchs gegenüberstellt: Archaisches Latein vs. Latein ohne feste Norm, Literarisches Latein vs. Lateinische Umgangssprache, Klassisches Latein vs. Vulgärlatein, Spätlatein vs. Vorromanische Phase, Mittelalterliches Latein vs. Romanische Sprachen (cf. Coseriu 2008:127).279 Dabei stellt er apodiktisch fest: „Es gab kein Vulgärlatein als solches vor der Existenz des klassischen Lateins“ (Coseriu 2008:119). Andererseits wird in seinen Ausführungen doch deutlich, daß es vulgärlateinische Elemente auch in anderen Epochen der lateinischen Sprachgeschichte gab – er benennt sie eben nur nicht so. Er versteht damit das Vulgärlatein dann doch vorwiegend aus romanistischer Sicht als Protoform der romanischen Sprachen und setzt den zugehörigen Zeitraum zwischen 100 n. Chr. – 400 n. Chr. an, bei gleichzeitiger – nicht gängiger – Verortung des klassischen Lateins in eben dieser Epoche.280 Mit der Umgangssprache quasi als Vorläufer des Vulgärlateins in älterer Zeit zollt er offenbar der latinistischen Tradition Tribut, engt aber auch diesen Begriff damit deutlich ein. Coseriu erliegt hier womöglich einer Übersystematisierung, auch in Bezug auf die Chronologie, die er zuvor noch großzügiger handhabte und die Hauptperiode der vulgärlateinischen Elemente in die Zeit zwischen 200 v. Chr. – 600 n. Chr. verortet (cf. Coseriu 1978:268).281
Die inhaltliche Bestimmung dessen, was unter ‚Vulgärlatein‘ zu verstehen ist, bleibt in der Forschung umstritten, manchmal nur in Bezug auf bestimmte Details, mitunter geht es aber auch um grundsätzliche Vorstellungen, die voneinander abweichen. Bereits 1937 konstatiert Furman Sas leicht resigniert, angesichts der von ihm gezählten 19 existierenden Begriffe in der damaligen Forschung, um „non classical language spoken or written“ zu charakterisieren, daß zwar ‚Vulgärlatein‘ nicht einheitlich verwendet werde, weitere terminologische Neuschöpfungen jedoch nur zur weiterer Verwirrung beitragen (Furman Sas 1937:491).282
An dieser Lage hat sich bis heute grundsätzlich nichts geändert, außer daß – horribile dictu – noch einige Definitionen mehr hinzugekommen sind.
Möglichst vielen Einzelbestimmungen Spielraum einräumend, versucht Stefenelli (2003) eine definitorische Annährung an die Kernelemente, auf die man sich heute vielleicht – zumindest in der Romanistik – verständigen kann:
Angesichts der diasystematischen und diachronischen Vielschichtigkeit bzw. Variation des Sprechlateins versteht sich ‚Vulgärlatein‘ hierbei heute in der Regel als komplexer Sammelbegriff für verschiedene v.a. diastratische (soziokulturell), diatopisch (geographisch) und diachronisch differenzierte Varietäten der mündlich konzipierten Spontansprache (Stefenelli 2003:530)
Diese Umschreibung klammert freilich fast alle wichtigen Streitfragen aus und ist daher eher als ein kleinster gemeinsamer Nenner inhaltlicher Bestimmung zu begreifen.
Lüdtke (2019) definiert Vulgärlatein vor allem als Abweichung vom klassischen Latein, das er wie folgt definiert:
Das klassische Latein ist innerhalb der historischen Sprache Lateinisch eine geschriebene und gesprochene urbane Sprache. Wenn nun wenig Schreibgeübte und wenig Gebildete aus anderen Schichten als der Oberschicht in Rom und in romfernen Regionen des Imperiums schreiben, gelten die Abweichungen von der urbanen Tradition als Vulgärlatein. (Lüdtke 2019:442)283
Dabei weist er zusätzlich daraufhin, daß auch die nicht urbanen Varietäten von weniger gebildeten Personen wie Soldaten geschrieben wurden, so daß eine schlichte Dichotomie, in der das klassische Latein mit Schriftlichkeit und Vulgärlatein mit Mündlichkeit gleichgesetzt wird, nicht greift (cf. Lüdtke 2019:442–443).
Selbst wenn man nun inhaltliche Differenzen und Nuancen großzügig beiseite läßt und sich auf wenige konstituierende Aspekte konzentriert, bleibt die Frage der adäquaten Bezeichnung für diese Art des Lateins ebenfalls im Raume stehen. Durchforstet man die einschlägige Forschungsliteratur, so begegnet einem als roter Faden ein nicht enden wollendes Lamento über den Begriff ‚Vulgärlatein‘, der gleichsam gottgegeben wie unausrottbar scheint und menetekelhaft von weiterem terminologischen Unglück kündet oder die Wissenschaft zu beeinträchtigen scheint, wie die wenigen Exzerpte deutlich machen:
The present use of the term „Vulgar Latin“ is so vague that we find it used now to refer to the language of Plautus, now to the language of the royal charts of the 8th century, now to the language of Gregory of Tours, now to a theoretically constructed language which exists only in the minds of certain scholars. (Furman Sas 1937:491)
Il termine latino volgare, è ormai così radicato nei nostri studi, da non poter essere estirpato, quindi lo subiamo, prendendo nota della sua inadeguatezza ed imprecisione. (Battisti 1949:23)
Não foi fácil problema estabelecer, rigorosamente, o conceito de latim vulgar. Durante muito tempo lavrou imensa confusão, em prejuízo dos métodos e do progreso da Romanística. (Silva Neto 1957:11)
Sanctionné par un usage centenaire pour désigner les divers faits latins qui ne s’accordent pas avec les norms classiques, le terme de latin vulgaire a les avantages et les inconvénients d’un terme consacré. (Väänänen 2002:3)
Couramment employée, en philologie latine et en linguistique romane, l’expression „latin vulgaire“ n’en constitue pas moins un des termes techniques les plus discutés de nos disciplines. (Herman 1967:9)
Den vorgeschlagenen Alternativen bzw. korrespondierenden Ausdrücken wie ‚lateinische Umgangssprache‘,284 ‚Sprechlatein‘ (frz. latin parlée, it. latino parlato), Spontanlatein,285 latin commun (it. latino comune)286 oder latino borghese287 haftet allerdings nicht selten eine ähnliche Problematik an – geschweige denn den heutzutage nicht mehr gebräuchlichen wie ‚Volkslatein‘ oder ‚Plattlatein‘,288 so daß man nolens volens wieder zum ungeliebten ‚Vulgärlatein‘ zurückzufinden scheint und sich dabei tendenziell terminologisch möglichst wenig festlegt, um nicht immer über die oben aufgeführten Grundsatzfragestellungen zu stolpern.289
Dies führt schließlich dazu, daß auch in der aktuellen Forschung einerseits die Klage nach dem vertrauten, aber scheinbar unpassenden Begriff nicht aufhört, man sich aber auch nicht durchringen kann ihn abzuschaffen:
Obwohl es sich um einen nicht sehr glücklich gewählten Ausdruck handelt, ist der Terminus Vulgärlatein in der Romanistik stark verankert. Es scheint den Romanisten bis heute schwer zu fallen, sich von ihm zu trennen und sich für die Bezeichnung gesprochenes Latein zu entscheiden. (Pirazzini 2013:13–14)
Dies fällt natürlich u.a. deshalb so schwer, weil ‚gesprochenes Latein‘ eben nicht exakt das Gleiche beschreibt, was der ein oder andere Linguist mit ‚Vulgärlatein‘ ausdrücken möchte.
Wenig glücklich erscheint auch eine Gliederung des Lateins, in der versucht wird, partieller Gradation zwischen literarischem Latein und Vulgärlatein zu etablieren, wie es in einer aktuellen Studie Nedeljković (2015) auf Basis von Banniard (1992) und Chahoud (2010) referiert:
En résumé, ces considérations aboutissent à deux dichotomies indépendantes, l’une concernant les registres plus ou moins formels, l’autre le sociolecte haut ou bas. Leur croisement donne naissance à trois – et non pas quatre – variété linguistiques : 1° le „haut formel “, qui est le latin littéraire, 2° le „haut informel “, qui est le latin familier, et 3° le latin vulgaire, qui a l’air informel, puisqu’il ressemble bien plus au familier qu’au littéraire, mais qui, à proprement parler, n’est point susceptible de gradation sur l’axe de formalité. (Nedeljković 2015:4)
Die Verschränkung von diaphasischer und diastratischer Ebene sowie die Nichtbeachtung der Diskrepanz zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit läßt diese Unterteilung wenig systematisch erscheinen. Eine ergänzende, chronologische Unterteilung seitens Chahouds, die das Vulgärlatein als rein postaugusteisches Phänomen charakterisiert und dabei negativ bewertet, läßt die komplette Systematik als „absurd“ erscheinen, wie Nedeljković (2015:5) zurecht anmerkt, ohne jedoch selbst eine adäquate Alternative anzubieten.
Eine Möglichkeit, die zumindest implizit in einigen anderen, neueren Publikationen zum Latein und seiner Geschichte anklingt,290 aber nie wirklich dezidiert verfolgt wurde, wäre eine Aufsplittung der Begriffe für eine rein diachrone romanistische Forschung einerseits und eine synchrone-diachrone Forschung zum Latein andererseits, ohne dabei die alte Sezession in latinistische und romanistische Tradition wiederaufleben zu lassen.
In diesem Sinne sei hier auch im Interesse der vorliegenden Arbeit eine Definition des Vulgärlateins versucht, die ausschließlich als terminologisches Konstrukt zur Erfassung der Ursprache bzw. Protosprache der einzelnen romanischen Idiome heranzuziehen wäre – mit inhaltlich weitgehendem Bezug auf Voßler (1922) und unter Berücksichtigung weitere wichtiger Aspekte, wie sie u.a. bei Herman (1967) oder Coseriu (2008) zur Geltung kommen:291
Vulgärlatein ist das gesprochene Latein der Antike, welches für uns nicht in einem homogenen Korpus von Texten erschließbar ist, sondern nur in Reflexen einzelner, vorwiegend substandardlich markierter Merkmale und Phänomene des geschriebenen Lateins aller Epochen, von den ersten Schriftzeugnissen des Lateinischen bis zum Beginn romanischer Schriftlichkeit, wobei die vulgärlateinischen Elemente tendenziell in einer späteren Phase zunehmen, natürlich in Abhängigkeit von der Textsorte. Aufgrund der Konvergenzen zwischen der gesprochenen und der geschriebenen Sprache, die beide innerhalb des gleichen Diasystems verortet sind, ist das gut dokumentierte und als Referenzgröße am besten greifbare, sogenannte Klassische Latein in Bezug auf zahlreiche Merkmale aller sprachlichen Ebenen übereinstimmend mit dem Vulgärlateinischen, so daß letzteres vor allem durch seine Abweichungen von der normierten Sprache faßbar wird, alle weiteren Erscheinungen der Mündlichkeit sind zu rekonstruieren.
Der Terminus ‚Vulgärlatein‘ könnte deshalb prinzipiell durch den Begriff ‚Sprechlatein‘ ersetzt werden, doch ist ersterer zu bevorzugen, und zwar nicht nur ob seiner langen Tradition in der Wissenschaft, sondern weil dadurch auch das Problem der Faßbarkeit und Überlieferung deutlicher zum Ausdruck kommt und ‚Sprechlatein‘ oder ‚gesprochenes Latein‘ für die abstrakte diasystematische bzw. diamediale Betrachtung reserviert werden kann.
Unter diesen Voraussetzungen erfüllt das Konstrukt ‚Vulgärlatein‘ eine angemessene Funktion, indem es hilft die zentrale Fragestellung der diachronen romanistischen Forschung zu beantworten, nämlich die nach dem Ursprung der einzelnen romanischen Varietäten und Sprachen. Eine in einem romanischen Idiom auftretenden erbwörtliche Form kann somit kategorisch auf eine vulgärlateinische Basis zurückgeführt werden; diese kann mit einer klassisch lateinischen Form korrespondieren oder auch nicht, kann in einem antiken oder frühmittelalterlichen Text belegt sein – aus welcher Epoche auch immer – oder aber rekonstruiert werden.
Für eine synchrone Betrachtung des Lateins der Antike hingegen aus Perspektive der Latinistik, wie sie in Kap. 4 vorliegender Arbeit vorgenommen wurde, bei der eben nicht die Weiterentwicklung zu den romanischen Sprachen im Vordergrund steht, sondern die Erfassung der diasystematischen Schichtung des Lateins – natürlich auch in Bezug auf seine Entwicklung innerhalb dieses als synchron gesetzten Zeitrahmens –, ist der Begriff des Vulgärlateins hingegen wenig dienlich. In diesem Kontext erscheint es vielmehr adäquat, darauf zu verzichten und stattdessen mit den Termini der Varietätenlinguistik zu operieren (diatopische, diastratische, diaphasische Varietäten des Lateins), um die Architektur der Sprache zu erfassen. Dies erscheint umso wichtiger, als damit auch deutlich wird, daß das Latein als einst lebende Sprache die gleiche diasystematische Variationsbreite aufweist wie eine moderne Sprache und keineswegs von zwei Systemen, einem vulgärlateinischen und einem des klassischen Lateins auszugehen ist, wie einst suggeriert wurde (zu dieser reductio ad unum bzgl. des Urromanischen bzw. Protoromanischen cf. Vàrvaro 1977:149).292
Si deve insomma considerare la lingua di Roma e dell’Impero come un vero e proprio diasistema contenente varietà diatopiche (geografiche ed areali), diastratiche (sociali) e diafasiche (attinenti ai diversi registri espressivi e di stile) oltre che ovviamente diamesiche (legate all’uso di mezzi espressivi diversi: in sostanza scritto ~ parlato) e non ultimo diachroniche o relative alla variabilità lungo l’asse temporale: in altre parole, un insieme (relativeamente) ordinato nel quale stratificazione, varietà e variabilità debbono necessariamente adeguarsi ai principi naturali ed universali che le determinano. (Zamboni 2000:71–72)
Der Übergang vom Lateinischen ins Romanische bzw. die einzelen sich ausdifferenzierenden romanischen Sprachen ist demgemäß ein schrittweiser Prozeß, währenddessen ein komplexes heterogenes Sprachsystem, nämlich das des Lateinischen, sich durch die verschiedensten Einflußfaktoren verändert (interne Sprachwandelprozesse, Sprachkontakte, Migrationen, Veränderung des Sprachraumes und der Sprechergemeinschaften)293 und neue Relationen zu den sich nach und nach abspalteten Teilsysteme aufbaut (Kontinuität und Diskontinuität), so daß am Ende eine Diglossie-Situation mit einem idealisierten mittelalterlichen Latein der Scholastiker bzw. später der Humanisten und den romanischen Sprachen mit sich vom Schriftlatein emanzipierenden Literatursprachen steht (cf. Zamboni 2000:80–81).
Für vorliegende Arbeit wirft diese Synopse der neueren vulgärlateinischen Begriffsgeschichte, die eng an die Entstehung der Sprachwissenschaft gebunden ist und in der die terminologische Variationsbreite sowie das Ringen um eine adäquate Beschreibung des Lateins, aber vor allem der romanischen Ur- und Protosprache deutlich wird, die Frage auf, inwiefern diese Annährungsversuche an die sprachliche Realität sich von denen der frühneuzeitlichen Betrachtungen unterscheiden. Dies kann im Kern bereits a priori damit beantwortet werden, daß die neuere Forschung von einer dezidiert linguistischen Sichtweise geprägt ist, während die humanistischen Untersuchungen meist andere Zielsetzungen haben und die Sprachbetrachtung zu diesem Thema oft nur als ancilla einer anderen Debatte fungiert; zudem sich diese Diskussionen hinsichtlich der Linguistik in einem vorwissenschaftlichen Raum abspielen. Es bleibt dennoch zu klären, inwieweit einzelne Grundgedanken dessen, was unter ‚Vulgärlatein‘ zu verstehen ist, in dieser Vorphase der Sprachwissenschaftsgeschichte bereits zu Tage treten bzw. nach und nach Gestalt annehmen, sich verfestigen und welche Aspekte tatsächlich erst mit der Etablierung einer Forschung in der Tradition von Diez und Schuchardt erschließbar werden.
6. Der Beginn für das Verständnis der Architektur des Lateinischen der Antike in der Frühen Neuzeit
6.1 Die Rahmenbedingung: La questione della lingua
Die vorliegende Untersuchung zur Entstehung eines grundsätzlichen Verständnisses über die Sprachsituation der römischen Antike, d.h. die Überwindung der mittelalterlichen Vorstellung (cf. Kap. 6.1.5) von der statischen und überzeitlich gültigen Distribution der Sprachen sowie der Invariabilität von Sprachen an sich bzw. des Lateins insbesondere, ist eng verzahnt mit der in Italien über mehrere Jahrhunderte geführten Debatte zur Frage nach der adäquaten (Literatur-) Sprache, der sogenannten questione della lingua. Diese Sprachenfrage zeitigte verschiedene Aspekte, die je nach Epoche unterschiedlich virulent waren. Welche Teildebatten nun genau zur questione zu rechnen sind und über welchen Zeitraum sich diese letztendlich erstreckte, ist Bestandteil umfangreicher sprachwissenschaftlicher Forschungsdiskussion. Im Folgenden soll es jedoch nicht um die hinlänglich in allen Facetten untersuchte questione im eigentlichen Sinne gehen, sondern allein darum, die hier im Fokus stehende Fragestellung in den Rahmen des allgemeinen geistesgeschichtlichen Kontext der Zeit und dieser weitgefächerten Gelehrtendiskussion in einzuordnen.
6.1.1 Die questione vor dem Hintergrund von Renaissance und Humanismus
Bevor nun einige Aspekte der italienspezifischen Sprachenfrage (it. questione della lingua) erläutert werden, um die vorliegende Fragestellung adäquat zu verorten, sei zunächst der allgemeine geistesgeschichtliche Hintergrund des hier untersuchten Zeitraumes abgesteckt.
Zentrale Begriffe, die in vorliegender Arbeit eine tragende Rolle spielen, um das intellektuelle Klima und die historischen Implikationen dieser Epoche zu charakterisieren, sind ‚Renaissance‘, ‚Humanismus‘ und ‚Frühe Neuzeit‘. Nicht selten werden diese Termini quasi-synonym gebraucht, um eine bestimmte Geisteshaltung jener Zeit zum Ausdruck zu bringen. Dabei sind sie keineswegs deckungsgleich, betonen sie doch verschiedene Aspekte einer Strömung bzw. einer historischen Konstellation, die im Folgenden herauszustellen sind.
Die scheinbare Austauschbarkeit dieser Schlüsselbegriffe rührt auch daher, daß sie als Epochenbezeichnungen äußerst facettenreich und schwer zu fassen sind, wie schon Jacob Burckhardt bzgl. der ‚Renaissance‘ feststellte:
Die ‚Renaissance‘ wäre nicht die hohe weltgeschichtliche Notwendigkeit gewesen, die sie war, wenn man so leicht von ihr abstrahieren könnte. (Burckhardt 2009:137)294
Mit ‚Renaissance‘ wird heutzutage tout court eine Kulturepoche bezeichnet, d.h. die Kunst und Literatur ist das konstituierende Element. In diesem Sinn definiert auch Schreiner (1995:710–711) im Lexikon des Mittelalters den Begriff, der auf ein von verschiedenen Bezeichnungen der Gelehrten des 14. und 15. Jh. zurückgeht, um eine Lebens- und Wachstumsmetaphorik zu versprachlichen, d.h. neben rinascere wurden auch revivere, risuscitare, reflorescere verwendet. Dabei sollten das Wiederaufleben der Künste und Wissenschaften und die bewußte Hinwendung zur Antike sowie, damit einhergehend, die Erneuerung der Latinität zum Ausdruck gebracht werden. Mit der entsprechenden Bedeutung verwendet Giorgio Vasari (1511–1574) in seinen Vite (1550) erstmals diese Metapher als Substantiv (rinascità) und das französische renaissance schließlich der Naturforscher Pierre Belon (1517–1564) in seinen Observations von 1553. Mit der heutigen Implikation, die eine Beschreibung einer bestimmten Geistesströmung und eines dezidierten Kunstideals einer Umbruchszeit beinhaltet, wird der Begriff jedoch erst sehr viel später aufgeladen, und zwar vor allem durch die prägenden Schriften Jean Michelets (Histoire de France, 1855) und insbesondere Jacob Burkhardts (Die Cultur der Renaissance in Italien, 1860):
Als Kulturbegriff im allgemeinen Sinne erst seit Mitte des 19. Jh. in Gebrauch […], bezeichnet R[enaissance] seitdem in der Regel jene Epoche der europäischen Kunst- und Kulturgesch[ichte], die sich zeitl[ich] gesehen vom 14. Jh. bzw. Anfang des 15. Jh. bis zur Mitte des 16. Jh. erstreckt und deren Ursprungsland und fast ausschließl[iches] Verbreitungsgebiet während der hier interessierenden, bis ca. 1490 reichenden Periode der Früh-R[enaissance] Italien war. (Schreiner 1995:710)
Diese hier gegebene, interessensbedingte Begrenzung im Lexikon des Mittelalters zur Frührenaissance ist insofern zu ergänzen, als die Renaissance bald über Italien hinaus wirkte und ihre Rezeption meist zeitlich versetzt in Korrelation zur räumlichen Distanz erfolgte. Von Florenz und Oberitalien wirkte sie vor allem nach Frankreich,295 aber auch nach England und Deutschland, eher eingeschränkt auf andere mitteleuropäische Regionen und die Iberische Halbinsel (Münkler/Münkler 2005:341).
Wichtige historische und geistesgeschichtliche Veränderungen, die für die Epoche der Renaissance konstitutive Elemente bilden, sind zum einen neben dem Auftreten neuer Adelsdynastien das Erstarken des Bürgertums in den ober- und mittelitalienischen Städten, das durch wirtschaftliche Prosperität, bedingt durch die zunehmende Bedeutung der Geldwirtschaft, ein politisches und ethisches Selbstbewußtsein ausprägte, welches sich unter anderem in der Forderung nach größerem Mitspracherecht und der Ausbildung einer standesbezogenen virtù äußerte. Zum anderen ist die Zeit der beginnenden Erneuerungsbewegung des 14.–16. Jh. geprägt von der Hinwendung zum Individuum, zur Weltlichkeit und dem Diesseits mit all seinen Erscheinungsformen; in den Wissenschaften verbinden sich dabei die Anerkennung einer ratio naturae,296 die Beobachtungen der realen Welt sowie die lebenspraktischen Aspekte der Wissenschaften mit einer erstarkenden Modellbildung des theoretischen Wissens der Antike in Kunst, Architektur, Literatur und Philosophie (Schreiner 1995:710–711).
Die Renaissance kann demnach als eine weitgespannte Bewegung charakterisiert werden, die in Korrelation mit bestimmten historischen Konstellationen, vor allem in Italien, einen Umbruch im Denken markierte und in den verschiedensten künstlerischen Ausdrucksformen ihre Wirkung entfaltete, zunächst in ihrem Entstehungsraum, dann weit darüber hinaus.
Der Humanismus, zeitlich und ideengeschichtlich eng verknüpft mit der Renaissance, ist laut Schweikle (1990:208–209) ebenfalls eine Epochenbezeichnung, aber vor allem die „erste gesamteuropäische Bildungsbewegung zwischen Mittelalter und Neuzeit (14.–16. Jh.), erwachsen aus der Wiederentdeckung, Pflege und Nachahmung der klass[ischen] lat[einischen] und griech[ischen] Sprache und Literatur.“ Der Begriff ‚Humanismus‘ wurde erst im 19. Jh. geprägt,297 die Bezeichnung ‚Humanist‘ (it. umanista) ist hingegen zeitgenössisch,298 wird sie doch ab dem ausgehenden 14. Jh. für einen (universitären) Gelehrten, einen vir humanus et doctissimus gebraucht, der sich den studia humanitatis (auch: studia humanitas) verschrieben hat, die im Rahmen der septem artes liberales eine Neuorientierung darstellten.299 Dabei ergab sich im trivium aus einer ursprünglich dominanten Beschäftigung mit der Logik und Dialektik eine verstärkte Hinwendung zur Rhetorik und Grammatik, d.h. das oft sehr abstrakte, scholastische Analysieren und Argumentieren (cf. Kap. 6.1.5) trat vor dem Hintergrund der Aufwertung der Antike und des Lateins als Literatur- und Verkehrssprache und der damit verbundenen Wissensvermittlung zugunsten der konkreteren rhetorischen und grammatischen Studien zurück (cf. Münkler/Münkler 2005:153; Schweikle 1990:209). Auch der Begriff des Humanismus unterliegt wie derjenige der Renaissance der Gefahr einer womöglich zu breiten Anwendung, einer Generalisierung, die ihn semantisch aushöhlt oder zumindest stark reduziert, so daß, wie Kristeller (1973:15) kritisch vermerkt, „nahezu jegliches Anliegen, das menschliche Werte zum Gegenstand hat, ‚humanistisch‘ genannt“ wird. Für vorliegende Arbeit, in der ja als eines der Hauptziele die Rekontextualisierung von zeitgenössischen Schriften und dem dort ausgedrückten Denken formuliert ist, soll jedoch der Begriff ‚Humanismus‘ – analog zu dem der ‚Renaissance‘ – nicht in diesem modernen allgemeinsprachlichen Sinn des Humanistischen Verwendung finden, sondern strikt an die historischen Implikationen dieser Umbruchsepoche gebunden sein – ganz in Konkordanz mit der Forderung Kristellers:
Wenn wir die Philosophie der Renaissance oder irgendeiner anderen Epoche verstehen wollen, müssen wir versuchen, nicht nur die Interpretation des authentischen Denkens dieses betreffenden Zeitraumes von der Wertbestimmung und Beurteilung seiner Leistungen zu trennen, sondern auch die ursprüngliche Bedeutung zurückgewinnen, in der jene Epoche bestimmte Kategorien und Klassifizierungen verwendete, mit denen wir entweder nicht mehr vertraut sind oder die verschiedene Nebenbedeutungen angenommen haben. (Kristeller 1973:16)
Vor diesem Hintergrund sei deshalb nochmal betont, daß der Humanismus in seinem historischen Verständnis an die besagte Epoche gebunden300 eine kulturelle und geistesgeschichtliche Erneuerungsbewegung darstellt, die jedoch mitnichten alle Bereiche des Geistesleben jener Zeit erfaßte, sondern sich im Kern auf die erwähnten studia humanitatis beschränkte. Dies bedeutet auch, daß universitäre Fächer wie Mathematik, Astronomie, Medizin, Jurisprudenz und Theologie explizit ausgenommen waren und auch im Bereich der Philosophie blieben Logik, Naturphilosophie und Metaphysik weitestgehend den traditionellen Methoden verbunden; allein die Ethik war Gegenstand humanistischer Studien, die ansonsten von der Beschäftigung mit der Literatur (und ihrer Sprache) geprägt waren (cf. Kristeller 1973:17–18).
Allgemein lehnten die humanistischen Gelehrten die Spekulation über die Natur, wie sie in der Physik oder Naturphilosophie betrieben wurde, als sinnloses Unterfangen ab, genauso wie die scholastischen Spitzfindigkeiten in der Logik, da für sie die konkreten Fragen des Lebens, der Lebensgestaltung und die möglichen Leitbilder (recte vivere), also Themen der Moralphilosophie, im Vordergrund standen (cf. Buck 1984:15).
Der Humanismus kann somit als Bildungsreform der Renaissance verstanden werden, geboren aus dem Wunsch einer Erneuerung des tradierten Wissens, dessen Ausdruck die studia humanitatis sind.
Insofern sich die ‚studia humanitas‘ als eine Bildungsreform verstanden, gingen sie von der Überzeugung aus, daß die aus dem Mittelalter überlieferte Bildung überholt sei und durch eine neue ersetzt werden müsse. Von Petrarca angefangen kritisierten die Humanisten den zeitgenössischen Wissenschaftsbetrieb, vor allem den Rückgang des Studiums der Grammatik und Rhetorik mit der daraus resultierenden Entartung des Lateins, sowie das Ausufern der sich in einem unfruchtbaren Spiel mit Definitionen, Distinktionen und Syllogismen erschöpfenden Dialektik, die nicht nur im Trivium vorherrschte, sondern auch innerhalb der Philosophie der Ethik in den Hintergrund gedrängt wurde. (Buck 1984:14)
Die Hinwendung zur Antike, zu ihrer Literatur, zu dem dort gepflegten Stil (der klassischen Autoren) und nicht zuletzt durch die auf diese Weise vermittelten Moralvorstellungen geht zu einem wesentlichen Anteil auf Petrarca zurück.301 In seiner Dichterkrönung zum poeta laureatus (8. April 1341), die gleichzeitig eine theoretische Lehrberechtigung für die artes liberales enthält, wird die Begeisterung für antike Literatur (Sprache, Form, Motivik) und Studieninhalte (studia humanitatis) gleichermaßen zum Ausdruck gebracht. Als systematisches Bildungsziel mit einem konkreten Programm werden die humanistischen Studien jedoch erst von Coluccio Salutati (1331–1406) formuliert, der darin die Verwirklichung von virtus und doctrina sieht. Dies beinhaltet gleichzeitig eine bewußte Abkehr von den im (spät)mittelalterlichen Schulbetrieb dominierenden octo auctores morales hin zu den Studien nach dem Leitbild der ciceronianischen humanitas, den bonae artes, in denen ein nach neuen Kriterien geschultes, moralisch agierendes Individuum ausgebildet werden sollte (cf. Buck 1984:11–15).
Die studia humanitatis wurden schließlich in fünf kanonische Fächer gefaßt, wie sie bei Tommaso Parentucelli (Nikolaus V., 1447–1455) überliefert sind: Grammatik, Rhetorik, Poetik, Geschichte,302 Moralphilosophie. Die beherrschende Sprache war zunächst das Lateinische, das die Grundlage jedweden Studiums bildete,303 später kamen jedoch auch das Griechische und seine Literatur als fachliche Bereicherung hinzu (cf. Buck 1987:163).304