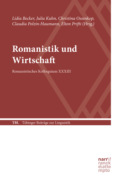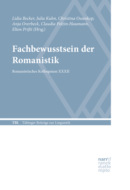Kitabı oku: «Das Verständnis von Vulgärlatein in der Frühen Neuzeit vor dem Hintergrund der questione della lingua», sayfa 15
In Florenz wurden erstmals auf Einladung von Coluccio Salutati und Niccolò Niccoli im Jahre 1397 Vorlesungen von Manuel Chrysoloras (1353–1415) gehalten, die von einer Anzahl wichtiger italienischer Gelehrter, darunter Bruni, begeistert aufgenommen wurden. Chrysoloras, der auch im Folgenden noch zahlreiche Schüler hatte, die auf seine Anregung hin z.T. auch nach Konstantinopel gingen (z.B. Guarino Veronese), fungierte dabei – so könnte man postulieren – durch seine Vermittlung des Griechischen und des byzantinischen Kulturschatzes als „Katalysator“ für die humanistische Bewegung.
Ein wichtiger Part innerhalb der humanistischen Erneuerungsbewegung war die Reform des Lateins. Vorbild sollte der Sprachgebrauch der „klassischen“ antiken Autoren sein (nicht unbedingt das Ideal der antiken Grammatiker), wobei in erster Linie Cicero hierbei als Maßstab diente (sowie Quintilian), später dann zunehmend Tacitus. Zu diesem Zweck wurden auch neue Lehrbücher und Grammatiken verfaßt, wie beispielsweise die Elegantiae Lorenzo Vallas (1407–1457), der ganz konkret eine restitutio linguae latinae fordert (cf. Buck 1984:16; Münkler/Münkler 2004:164–165).
Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Paradigmenwechsels des 14./15. Jh., der eng mit dem gesteigerten Interesse an der Antike zusammenhängt, ist die Begeisterung für Bücher und Handschriften. Auch hier spielt Petrarca eine wichtige Vorreiterrolle. Das Buch wird für ihn gleichsam zum Lebensbegleiter. Die tiefe Verbundenheit mit den antiken Autoren, mit denen er im Geiste vertrauliches Zwiegespräch hält, bringt ihn dazu, seinen „Freunden“ und Vorbildern Briefe zu schreiben.305 So finden wir in den Familiares Episteln, die an Cicero, Seneca, Varro, Quintilian, Livius, Pollio oder Homer adressiert sind. Petrarca stellt nicht nur eine Liste mit seinen Lieblingsbüchern zusammen (libri mei peculiares), sondern kommentiert auch einzelne Schriften und setzt sie in bewußte Korrelation zu Ereignissen aus seinem eigenen Leben. (cf. Buck 1987:138–141).
Diese tiefe Wertschätzung für die alten Autoren in Zusammenhang mit dem erwachenden Interesse am Historischen führt schließlich dazu, daß sich die Humanisten auf die Suche nach Originalausgaben bzw. alten Handschriften ihrer geliebten Werke machen und die europäischen Archive und Klosterbibliotheken durchforsten: Petrarca findet in Lüttich zwei in Vergessenheit geratene Reden Ciceros (1333) und ein Manuskript mit Ciceros Briefen (Epistolae ad familiares) in Verona (1345), Coluccio Salutati entdeckt weitere Cicero-Briefe (v. supra Kap. 1.1), Niccolò Niccoli (1365–1437) läßt aus den Klöstern Corvey und Monte Cassino das historische Œuvre des Tacitus zusammentragen und Poggio Bracciolini (1380–1459) erwirbt bei seinen Reisen rund um das Konstanzer Konzil (1414–1418) neben weiteren Reden Ciceros und zahlreichen Manuskripten unterschiedlichster Autoren (Silius Italicus, Lukrez, Manlius, Ammianus Marcellinus, Valerius Flaccus, Statius, Petron, etc.) in St. Gallen die bisher nur fragmentarisch bekannte Rhetorik Quintilians (Institutio oratoria). Dies bildet letztendlich den Auftakt für eine umfangreiche Recherche nach alten Handschriften und möglichst originalgetreuen Ausgaben (cf. Walther 2007:671–672). Zu den sogenannten „Bücherjägern“ (engl. book-hunters) gehörten außer den bereits Genannten auch Gelehrte wie Leonardo Bruni (1370–1444), Guarino Veronese (1374–1460), Giovanni Aurispa (1376–1459) oder Palla Strozzi (1373–1462) (cf. Niederkorn-Bruck 2012:106–107; Frank 2014:217–218).
Ein weiterer Folgeeffekt der Liebe zum Buch und zu den Schriften der alten Autoren ist die Entstehung von zahlreichen Bibliotheken, zunächst vor allem Privatsammlungen, die erst später in öffentliche Bibliotheken umgewandelt werden bzw. deren Bestand dort Eingang findet. Auch hier spielte wiederum Petrarca eine wichtige Rolle, und zwar insofern er seine Bibliophilie zum Ausdruck brachte – „Che anzi nei libri c’è un fascino particolare“ (Petrarca, Fam. III, 18; 1978:109).306 Die Privatsammlungen der Humanisten waren – soweit rekonstruierbar – zum Teil beträchtlich: Die Bibliothek Coluccio Salutatis wird auf ca. 800 Bände geschätzt, diejenige von Niccolò Niccoli soll ca. 600–800 Bücher umfaßt haben, Giovanni Pico della Mirandola (1469–1533) brachte es auf 1160 und Willibald Pirckheimer (1470–1530) sogar auf 2100. Eine der ersten halb-öffentlichen Bibliotheken war die von Oddo Colonna (Martin V., 1417–1431) im Jahre 1417 begründete Biblioteca Vaticana, in deren Archiv 1455 immerhin schon 1200 Bände aufgenommen waren (cf. Buck 1987:142–143).307
Dies sind nur einige sehr selektive Aspekte des Humanismus, und zwar solche, die im Hinblick auf die vorliegende Fragestellung von Relevanz sind, denn das Interesse an Historischem und Philologischem der Humanisten bildet den Nährboden für die daraus entstehenden sprachtheoretischen Fragestellungen.
Als letztes sei noch auf die Datierungs- und Strukturierungsproblematik von Renaissance und Humanismus verwiesen. Im Supplementband des Kleinen Pauly zur Rezeption der Antike in eben jener Zeit arbeitet Landfester mit dem Doppelbegriff des ,Renaissance-Humanismus‘, wobei er den Terminus der ‚Renaissance‘ als Epochenbegriff auffaßt und ‚Humanismus‘ als Kulturbegriff. Renaissance ist für ihn damit die erste Phase der Frühen Neuzeit im westeuropäischen Kulturkreis, einer Epoche, die durch eine neue aus politischer Sicht plurale Ordnung anstelle der mittelalterlichen Universalmonarchie gekennzeichnet ist, in der sich die humanistische Kulturbewegung entfaltet. Diese umfaßt zahlreiche Bereiche der Kultur und löst die von christlichen Dogmen bestimmte Weltanschauung des Mittelalters ab, durch eben ihr Leitbild der humanitas. In diesem Sinne läßt Landfester den Renaissance-Humanismus im 14. Jh. beginnen, symbolisch mit Petrarcas Dichterkrönung (1341), und setzt ihr Ende mit der beginnenden Konfessionalisierung ab der zweiten Hälfte des 16. Jh. an. So wie sich die Bewegung aus den engen, theologisch bestimmten Lehrpfaden des Mittelalters emanzipierte, findet sie auch ihr Ende in der Beschränkung der freien Betrachtung der paganen Antike durch die im Zuge der Konfessionsspaltung entstehenden Denkverbote, was man ebenfalls mit einem symbolischen Datum fixieren könnte, nämlich der Verbrennung Giordano Brunos im Jahre 1600. Der Aspekt des Religiösen ist hierbei ein wichtiger, aber nicht der einzige, der die Dynamik von der Genese und dem langsamen Ausklingen dieser Bewegung bedingt, zahlreiche weitere externe und interne Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle (cf. Landfester 2014b:IX).
Eine Periodisierung zu erstellen ist insofern kaum möglich, da schon innerhalb Italiens die einzelnen Regionen unterschiedlich von dieser Erneuerungsbewegung betroffen sind und unter Einbezug anderer europäischer Länder erst recht mit einer zeitlichen Diskrepanz zu rechnen ist; hinzu kommt, daß auch bezüglich der einzelnen Kulturbereiche wie Architektur, Malerei, Bildhauerei oder Literatur der Paradigmenwechsel nicht einheitlich verläuft. Landfester (2014b:X-XI) strukturiert deshalb sehr grob in einen Humanismus der Früh- und Hochrenaissance mit der groben Datierung ca. 1350/1400 – ca. 1550 und einen Humanismus der Spätrenaissance mit dem zeitlichen Rahmen von ca. 1550–1600/1630. Alle weiteren Unterteilungen sollten an einzelnen Regionen und Kulturfeldern festgemacht werden.308
Die Datierungen sind dabei nur grobe Anhaltspunkte, denn wie Kristeller (1973:11–12) deutlich macht, gibt es zweifellos Kontinuitäten, wobei die schwierige Faßbarkeit der Epoche nicht dazu berechtigt, ihr eine eigene Prägung und Identität abzusprechen.
Zuletzt sei in vorliegendem Kontext noch auf den Begriff der ‚Frühen Neuzeit‘ hingewiesen, mit dem ebenfalls gelegentlich operiert wird. Dieser Terminus ist vor dem Hintergrund der historischen Periodisierung Antike – Mittelalter – Neuzeit zu sehen und gehört zur Geschichtswissenschaft, in der damit üblicherweise die Zeit zwischen ca. 1450/1500 und 1800/1850 – vor allem im anglophonen Raum oft tout court 1500–1800 – umrissen wird, deren Eckdaten gekennzeichnet sind von der Erfindung des Buchdrucks einerseits und dem Aufkommen der Eisenbahn als transnationales Transportmittel andererseits. In diesem allgemeinen historischen Verständnis ist der Begriff seit den 1950er Jahren geläufig, wurde aber schon zuvor in ähnlicher Form in der Wirtschaftsgeschichte (Werner Sombart: Frühkapitalismus) und dann in der Soziologie (Max Weber: beginnende Neuzeit) verwendet, die ihn wiederum aus der in der Sprachwissenschaft üblichen Kategorie des ,Frühneuhochdeutschen‘ (1350–1650) ableitet, wie sie von Jacob Grimm eingeführt (Kriterium: Lautverschiebungen) und von Wilhelm Scherer schließlich als Epoche etabliert wurde. Kennzeichen dieser weitgespannten Zwischenepoche sind die politischen Veränderungen in Europa (Staatsbildung und diplomatische Beziehungen), der Frühkapitalismus, die protestantische Ethik, Wissenschaftsrevolution, Agrarrevolution und der Beginn der Industriellen Revolution. Es sind also Umbrüche in der Politik, in der Kommunikation, dem Finanzwesen, dem Erziehungswesen und im kulturellen Bereich, die diesen Zeitraum situieren (cf. Behringer 2006:81–85).309
Die in vorliegender Arbeit wichtigen kultur- und geistesgeschichtlichen Rahmenbedingungen, die durch die Begriffe ‚Renaissance‘ und ‚Humanismus‘ abgesteckt wurden, sind durchaus Teil dieses historischen Gesamtkomplexes ‚Frühe Neuzeit‘ und der damit bezeichneten Neuorientierungen, wobei diese Epochenbezeichnung jedoch sowohl inhaltlich wie auch zeitlich weit über das abgesteckte Thema hinausreicht. Für vorliegende Fragestellung bilden diese geistesgeschichtlichen Strömungen den unabdingbaren Hintergrund; nur in diesem Kontext lassen sich die dann hervortretenden Diskussionen zu den verschiedenen Aspekten der Sprache (historisch und zeitgenössisch) adäquat einordnen und erklären.
6.1.2 Kurzcharakteristik der questione della lingua: Fragestellungen und Periodisierung
Die questione della lingua als Leitfrage einer Normdiskussion bezüglich der Herausbildung der italienischen Literatur- und Standardsprache ist ein Produkt der linguistischen Forschung des 20. Jahrhunderts. Der Begriff fand seine wesentliche Verbreitung mit dem gleichnamigen Werk von Vitale (1984 [11960]); das Phänomen dieser metasprachlichen Diskussion wurde aber bereits von Vivaldi (1894–1898) und Luzzato (1893) im ausgehenden 19. Jahrhundert beschrieben, wobei jedoch z.B. Vivaldi noch von controversie und Luzzato von polemica spricht (cf. Ellena 2011:20–22).310
Vitale beschreibt in seiner grundlegenden Monographie sowohl den zugrundeliegenden sprachlichen Prozeß der Selektion und Normierung unter dem Einfluß der literarischen Produktion der tre corone und ihrer prestigeträchtigen Nachwirkung bzw. ihrer Kanonisierung als Autoritäten, als auch den metasprachlichen Diskurs mitsamt seinen Fragestellungen bzw. kontroversen Einzeloptionen.
Il fiorentino antico e scritto, quale si fissa con procedimenti d’arte nei grandi scrittori trecenteschi, e si impone mediante il prestigio letterario e culturale dei sommi auctores fiorentini e nel solco della prodigiosa fortuna di Firenze borghese e mercantile nell’età comunale, ed è codificato dalla regolamentazione grammaticale cinquecentesca, è il fondamento dell’italiano comune; si può dir meglio che la lingua comune e nazionale italiana è il fiorentino quale è venuto affermandosi e imponendosi attraverso una serie complessa di vicende culturali e sociali in Italia come lingua di tutta la nazione nel corso della nostra storia civile. (Vitale 1984:9)
Dieser Prozeß der Herausbildung der italienischen Sprache im Sinne einer Literatursprache und einer Gemeinsprache ist in der Sprachbetrachtung systematisch strikt zu trennen (cf. Ellena 2011:17) von der über mehrere Jahrhunderte unter verschiedenen Vorzeichen sich vollziehenden Kontroverse über die „richtige“ Art eines zu normierenden Italienischen.
Il complesso dei problemi intorno al volgare, alla lingua grammaticale nuova che diventa lingua nazionale e comune d’Italia, che si pongono e si discutono con appassionato e vivace calore per tutti i secoli nel corso della nostra storia letteraria e grammaticale in conseguenza delle condizioni che si sono sommariamente illustrate (natura della lingua: fiorentina o italiana; norma del suo impiego: lingua scritta e lingua parlata; dilatabilità dei suoi confini: lingua antica e lingua moderna; adattabilità ai tempi nuovi: lingua morta e lingua viva; funzionalità in circostanze storiche rinnovate: lingua come letteratura o lingua come strumento sociale; etc.) costituisce la cosiddetta questione della lingua le cui ragioni hanno, dunque, profonde e salde radici storiche. (Vitale 1984:12)
Die questione della lingua umreißt dementsprechend den Findungsprozeß einer adäquaten Literatursprache (und später auch mündlichen Standardsprache) des Italienischen zu Beginn der Frühen Neuzeit im Kontext der Renaissance und eines sich entwickelnden Bewußtseins für die eigene Volkssprache in Auseinandersetzung mit dem Lateinischen. Die damit zusammenhängende Gelehrtendebatte, die sich über einen Zeitraum von mindestens mehr als einem Jahrhundert erstreckt, ist in erster Linie als eine Normdiskussion zu begreifen,311 in der versucht wird, vor dem Hintergrund des bereits seit der Antike normierten und diskurstraditionell weit gefächerten Lateins, auf der Basis einer schon früh kanonisierten Literatur mit stilistisch elaborierten Texten mit entsprechendem Prestige, das Italienische auf ein mehr oder weniger gleichwertiges Niveau zu heben.312 Das Prestige sollte dabei durch die Selektion von Varietäten – und dann im Einzelnen auch von Varianten – erreicht werden, sowie durch die im Zuge dieses Prozesses normative Fixierung dieser selegierten sprachlichen Formen. Die Selektion betrifft dabei sowohl grammatische wie auch lexikalische Formen bzw. Konstruktionen bzw. anders ausgedrückt, spielt sich unter Einbeziehung der dann später hinzukommenden Frage nach dem mündlichen Gebrauch auf allen Ebenen der Sprache ab (phonetischer, morphologischer, syntaktischer, lexikalischer). Referenz ist dabei vorrangig die noch „junge“ volkssprachliche Literatur mit ihren Hauptvertretern Dante, Petrarca, Boccaccio und den dadurch abgedeckten Literaturgattungen und Stilregistern. Marazzini (1993a) faßt dieses Gesamtphänomen mit seinen wichtigsten Einzelproblemstellungen konzis zusammen:
Risolvere questi problemi [di selezione] significa stabilire in via prioritaria che cosa l’italiano fosse, in qual luogo avesse avuto origine, quale città o regione potesse essere considerata culla della lingua, e potesse pertanto attribuirsi il diritto di controllare la lingua stessa nella sua crescita ed evoluzione […]; si dovevano stabilire i modelli della lingua, fissando l’elenco delle relative auctoritates. (Marazzini 1993a:231–232)
Daraus ergeben sich wiederum ganz konkrete Fragestellungen, darunter solche, wie eine adäquate Sprache der Poesie oder der Prosa und ihrer verschiedenen Gattungen beschaffen sein sollte, wieviel Varianz man dabei zulassen kann, welche Sprachform man als Modell für den Schulunterricht sinnvollerweise wählen sollte, wie im einzelnen entsprechende Grammatiken und Wörterbücher zu verfassen sind und vor allem auf Basis welcher Autoren und Werke sowie welcher Epoche dies geschehen solle (cf. Marazzini 1993a:232).
Die Frage nach der zeitlichen Verortung der questione della lingua hängt eng mit der Extension dieses Begriffes zusammen. Tatsächlich ist die italienische Sprachgeschichte – wie auch die anderer romanischer bzw. europäischer Sprachen – von dem Prozeß der Herausbildung einer adäquaten Varietät zum Ausdruck der distanzsprachlichen Kommunikation geprägt, wobei dieses potentielle Idiom sich vor allem in einer Frühphase in Konkurrenz zu der bisherigen dominierenden Kultursprache befand. Die italienische Situation ist jedoch insofern eine spezifische, als hier bedingt durch die politische und gesellschaftliche Heterogenität im Laufe der Geschichte die verschiedensten Optionen bestanden, die in der schließlich als questione bekannt gewordenen Kontroverse über Jahrhunderte von Gelehrten diskutiert wurden.313 Dabei ist es durchaus möglich, diese Suche nach einer Literatur- und Standardsprache ab ovo, also ab Beginn der Literaturproduktion im volgare, bis zur deren flächendeckender Verbreitung am Ende des 19. Jh. (Einigung Italiens, Einführung der Schulpflicht, Industrialisierung, Binnenmigration, etc.) und in letzter Konsequenz im 20. Jh. (Rückgang der Dialekte, Massenmedien, etc.) zu fassen oder aber dezidiert auf den Kern der Debatte im 15. und 16. Jh. zu begrenzen.
Peter Koch (1988b) geht hierbei insofern einen Mittelweg in seiner Periodisierung, als er sowohl eine Vor- und Frühphase aufzeigt als auch auf die entsprechenden Ausläufer bzw. Nachwirkungen verweist, die eigentliche questione aber deutlich in der Frühen Neuzeit verortet. Die Sprachgeschichte des Italienischen ist für ihn in ihrer ersten Periode der beginnenden Schriftlichkeit, die er nach Krefeld (1988:750) „polyzentrische Ausbauphase“ nennt, gekennzeichnet durch die „Sprachenfrage“ Latein oder Italienisch (volgare), wobei zu dieser Zeit das Lateinische noch relativ unangefochten die Literatur und die Gebrauchstexte dominiert, das volgare sich hingegen nur nach und nach in einigen wenigen Bereichen etabliert (z.B. frühe Lyrik, einzelne Gebrauchstexte). Innerhalb des Italienischen wiederum ergibt sich dabei eine weitere Option, und zwar stellt sich potentiell die Wahl zwischen einem eher latinisierenden Modell mit schwacher Diatopik (Zentrum Bologna) oder einer stark regional markierten Schriftsprachlichkeit, wie sie sich vor allem in Florenz (Toskana), aber auch in Sizilien, Umbrien oder Venetien herausbildet. Retrospektiv läßt sich dabei bereits die sich später noch verstärkende Dominanz der tre corone-Dichter erkennen und damit eine gewisse Präferenz für das Florentinische. Die geschilderte potentielle Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen diatopischen Varietäten, oder vielmehr zwischen Diskurstraditionen, beschränkt sich dabei auf die sogenannte hohe Literatur. Was die Gebrauchstexte anbelangt, so herrscht diesbezüglich weitgehend ein latinisierendes volgare-Modell mit eher schwacher diatopischer Ausprägung vor.
Im Zuge des Humanismus und einer erneuten Aufwertung des ohnehin schon seit jeher prestigereichen Lateins entsteht eine „Sprachenfrage“, die durchaus an die eigentliche questione gekoppelt ist, ihr jedoch chronologisch vorausgeht und deren zentrale Fragestellung ist, welche Art des Lateins für Literatur und Wissenschaft adäquat sei. Zur Disposition stehen dabei ein an dem Modellautor Cicero orientiertes Latein sowie ein eher eklektisches, sich aus verschiedenen Vorbildern speisendes (cf. Koch 1988b:345–346).
Nachdem sich jedoch das ciceronianische durchsetzt und zur Leitvarietät des Lateinhumanismus wird, verschärft sich dadurch der Gegensatz zwischen Italienisch (mündlich, schriftlich) und Latein (schriftlich) und es kommt endgültig zu einer stark ausgeprägten Diglossiesituation, welche im Mittelalter, zumindest von Gelehrten, mitunter noch als standard-with-dialect wahrgenommen worden war.314
Während die Sprachenfrage ‚Latein oder Volkssprache‘ im Prinzip alle westeuropäischen Sprachgemeinschaften tangierte, insofern überall dort, wo das Latein als dominierende Kultursprache die Schriftlichkeit beherrschte, die jeweilige Volkssprache ihr einzelne Bereiche nur mühsam abtrotzen konnte und sich dieser Prozeß meist über Jahrhunderte hinzog sowie die „Sprachenfrage“ innerhalb des Lateins eine des gesamten europäischen Humanismus war, ist die darauf folgende eigentliche questione della lingua eine sehr spezifisch italienische.
Koch (1988b:346) greift die bisher von ihm ausgemachten Diskussionen innerhalb der italienischen Sprachgeschichte, also ,Latein (ciceronianisch vs. eklektisch) vs. Volgare (schwach diatopisch, eklektisch und stark latinisierend vs. stark diatopisch)‘, noch einmal auf und integriert darin die eigentliche Sprachenfrage innerhalb der Gesamt-questione: d.h. die zentralen Alternativen, die dann den Kern der questione-Debatte ausmachen, sind vor allem innerhalb der Option ‚stark diatopisches Volgare‘ angesiedelt, und zwar mit den Möglichkeiten, sich zwischen einer florentinischen Varietät als Grundlage der Literatursprache oder einer anderen toskanischen Varietät (z.B. dem Senesischen) bzw. einer ganz anderen italienischen Varietät zu entscheiden,315 wobei sich in Bezug auf die Option ‚Florentinisch‘ daran anschließend die Frage stellt, ob man auf das Florentinisch der tre corone oder ein eher aktuelles, zeitgenössisches zurückgreifen sollte; diesen Alternativen steht schließlich noch die Möglichkeit einer lingua cortigiana als spezifische Ausformung des schwach diatopischen, eklektischen Modells gegenüber. Die hier aufgeführten Alternativen werden dabei nur zu Optionen vor dem Hintergrund der Aufwertung der Volkssprache im Zuge eines vor allem in Florenz aufkommenden Vulgärhumanismus (umanesimo volgare), der das Italienische als Ausdrucksmöglichkeit neben dem im Lateinhumanismus (umanesimo latino) präferierten ciceronianischen Lateins überhaupt erst in größerem Maße möglich macht.
Koch (1988b:346, 357) periodisiert die questione della lingua meist eher implizit als explizit, jedoch ist deutlich herauszulesen, daß für ihn der Höhepunkt der Kerndebatte im Cinquecento stattfand (Phase III), mit entsprechenden Vorläufern im Quattrocento. Zu dieser Frühphase gehört bei ihm sowohl die Frage ‚Latein oder Volgare‘ (Phase II) als auch die Diskussion um das adäquate Latein (Phase I). Als eine Art Vorphase kann man in seinem Sinne die von Krefeld (v. supra) als „polyzentrische Ausbauphase“ bezeichnete Periode ab ca. 1200 betrachten, in der das volgare Bereiche der Schriftlichkeit erobert. Analog dazu kann man die Periode vom 17. Jahrhundert bis zu Manzoni (I Promessi sposi: Ventisettana 1827/Quarantana 1840–42) und zur Einigung Italiens (1861) als eine Art Spätphase (bzw. Nachphase) betrachten, da trotz einer sich bereits abzeichnenden tendenziellen Ausrichtung am tre corone-Modell, gestützt durch die Academia della Crusca, die Diskussion um Details und Alternativen weitergeführt wird. Koch (1988b:357) schematisiert dabei diese letzte Phase durch die Optionen ,cruscanisches (tre corone-) Florentinisch vs. aktuelles gebildetes Florentinisch vs. anticruscanisches (eklektisch liberales) Italienisch‘.
Da zwar einerseits tatsächlich (fast) die gesamte italienische Sprachgeschichte von Sprachenfragen geprägt ist, andererseits die metasprachliche Auseinandersetzung nur ein bis zwei Jahrhunderte besonders virulent ist, spiegelt sich dies auch ein wenig in der Darstellung von Koch, der sich nicht ganz entscheiden kann, was genau er nun zur questione della lingua in Italien strictu sensu rechnen möchte.316 Hier sei als Kernphase der questione das 16. Jh. definiert, wie es auch sonst in der Forschung meist üblich ist (v. infra).
Michel (2005) übernimmt weitgehend das Modell von Koch, d.h. sowohl die Kategorisierung (Arten der einzelnen Sprachenfragen) als auch die Periodisierung, erweitert dies jedoch in entscheidender Weise dadurch, daß er es mit der Geschichtstheorie Nietzsches in Verbindung bringt. Dessen Geschichtsauffassung, die er im zweiten Teil seiner Unzeitgemäßen Betrachtungen von 1874 unter dem Titel Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben dargelegt hat und die drei Arten der Historie bzw. der historischen Betrachtung beinhaltet, nämlich die monumentalistische,317 die antiquarische und die kritische, ergänzt nun Michel (2005:354) noch um die eklektische Perspektive, bei gleichzeitiger Synthetisierung der antiquarischen und monumentalistischen, da diese beiden in der Renaissance in Bezug auf die questione nicht unterscheidbar seien.318 Dies führt ihn schließlich dazu, daß er anhand dieser Kriterien die Vertreter der Kern-Diskussion der questione della lingua im 16. Jh. folgendermaßen zuordnet:
| Hauptvertreter der questione della lingua (16. Jh.) – Phase I/ II | |||
| Latein | Volgare | ||
| Apologeten des Lateins | Trecento-Florentinisch | Modernes Florentinisch | Höfische Koiné andere Varietäten |
| ROMOLO AMASEO (1489–1552) (De linguae usu retinendo, 1529) | PIETRO BEMBO (1470–1547) (Prose della volgar lingua, 1525) | NICCOLÒ MACHIAVELLI (1469–1527) (Dialogo intorno alla nostra lingua, ca. 1515) | VINCENZO COLLI (CALMETA) (ca. 1460–1508) (Della volgar lingua, in: Bembo, Castelvetro) |
| FRANCESCO FLORIDO (SABINO) (1511–1547) (Apologia, 1537) | SPERONE SPERONI (1500–1588) (Dialogo delle lingue, ca. 1542) | CLAUDIO TOLOMEI (1492–1556) (Il Cesano, 1555) | ANGELO COLOCCI (1474–1549) (in: Piero Valeriano, Dialogo della volgar lingua) |
| CELIO CALCAGNINI (1479–1541) (De institutione Commentatio, 1544) | ACCADEMIA DELLA CRUSCA (Vocabulario degli Accademici della Crusca, 1612) | GIOVAN BATTISTA GELLI (1498–1553) (Ragionamento sopra le difficoltà del mettere in regola la nostra lingua, 1551) | GIOVANNI FILOTEO ACHILLINI (1466–1538) (Annotazioni della volgar lingua, 1536) |
| Gemäßigte Apologeten-Position | LEONARDO SALVATI (1540–1589) (Avvertimenti della lingua sopra ’l „Decamerone“, 1586) | PIER FRANCESCO GIAMBULLARI (1495–1555) (Gello, 1546) (Della lingua che si parla e si scrive in Firenze, 1551) | BALDASSARE CASTIGLIONE (1478–1529) (Il Cortegiano, 1528) |
| CARLO SIGOMIO (1520–1584) (De Latinae linguae usu retinendo, 1566) | BENEDETTO VARCHI (1503–1565) (L’Ercolano, 1570) | GIAN GIORGIO TRISSINO (1478–1550) (Il castellano, 1529) | |
| UMBERTO FOGLIETTA (1518–1581) (De linguae Latinae usu et praesentia, 1574) | CARLO LENZONI (1501–1551) (Difesa della lingua fiorentina e di Dante, 1556) | MARIO EQUICOLA (1470–1525) (Istituzioni al comporre in ogni sorta di rima volgare, 1541) | |
| Gegner des Latein (Volgare Befürworter) | ALBERTO LOLLIO (ca. 1508–1568) (Orazione in laude della lingua toscano, 1555) | Sienesisch | |
| ALESSANDRO CITOLINI (ca. 1500–1582) (Lettere in difesa de la lingua volgare, 1540) | GIROLAMO RUSCELLI (1504/1518–1566) (De‘ Comentarii della lingua italiana, 1581) | ORAZIO LOMBARDELLI (ca. 1542–1608) (Della pronunzia toscana, 1568) | |
| VALERIO MARCELLINO (ca. 1536–1593) (Lettera, over Discorso intorno alla lingua volgare, 1564) | BERNARDINO TOMITANO (1517–1576) (Ragionamento della lingua toscana, 1545) | Bolognesisch | |
| FILOTEO ACHILLINI (1466–1538) (Annotazioni della volgar lingua, 1536) | |||
Abb. 4: Hauptvertreter der questione Phase I/II (modifiziert und ergänzt; Michel 2005:359, Tab.147)
| Hauptvertreter der questione della lingua (16. Jh.) – Phase III | ||
| Florentinisch | ||
| Antiquarisch-monumentalistische Position (Altflorentinisch) | Eklektische Position (Alt- und Neuflorentinisch) | Geschichtskritische Position (Neuflorentinisch) |
| GIOVANNI FRANCESCO FORTUNIO (ca. 1470–1517) (Regole grammaticali della volgar lingua, 1516) | NICCOLÒ LIBURNIO (ca. 1474–1557) (Le vulgari elegantie, 1521) | NICCOLÒ MACHIAVELLI (1469–1527) (Dialogo intorno alla nostra lingua, ca. 1515) |
| PIETRO BEMBO (1470–1547) (Prose della volgar lingua, 1525) | FABRICIO LUNA (Vocabulario di cinquemila Vocabuli Toschi, 1536) | CLAUDIO TOLOMEI (1492–1556) (Il Cesano, 1555) |
| NICCOLÒ LIBURNIO (ca. 1474–1557) (Tre fontane, 1526) | GIOVAN BATTISTA GELLI (1498–1553) (Ragionamento sopra le difficoltà del mettere in regola la nostra lingua, 1551) | |
| LUCILIO MINERBI (15./16. Jh.) (Il Decamerone di M. Giovanni Boccaccio col Vocabulario di M. Lucilio Minerbi, 1535) | PIER FRANCESCO GIAMBULLARI (1495–1555) (Gello, 1546) (Della lingua che si parla e si scrive in Firenze, 1551) | |
| FRANCESCO ALUNNO (ca. 1485–1556) (Osservazioni sopra il Petrarca, 1539) (Ricchezze della lingua volgare sopra il Boccaccio, 1543) (Fabrica del mondo, 1548) | ||
| ALBERTO ACARISIO (ca. 1497–1544) (Vocabulario, Grammatica, et ortographia della lingua volgare, 1543) | ||
| SPERONE SPERONI (1500–1588) (Dialogo delle lingue, ca. 1542) | ||
| LEONARDO SALVATI (1540–1589) (Avvertimenti della lingua sopra ’l „Decamerone“, 1586) | ||
Abb. 5: Hauptvertreter der questione Phase III (modifiziert und ergänzt; Michel 2005:359, Tab. 148)