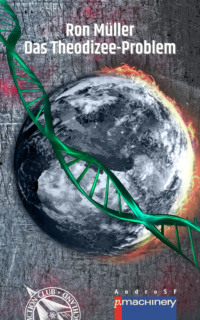Kitabı oku: «DAS THEODIZEE-PROBLEM», sayfa 3
»Nicht!«
Ein an der Seite stehender Museumsangestellter wies auf das Messingschild neben dem verglasten Durchgang.
KEINESFALLS BERÜHREN!
Die M109 wurde in einem hochaufwendigen Verfahren teildekontaminiert, dennoch besteht eine radioaktive Reststrahlung, der wir mit einer kompletten Bleiauskleidung des Raumes und dieser Schutzscheibe, die aufgrund der Strahlungsaufnahme regelmäßig gewechselt wird, begegnen.
Die Museumsleitung
Zoe starrte auf den Metallkoloss und konnte sich nicht erklären, warum. Schließlich hatte sie für Kriegstechnik wenig übrig. Aber das verschmolzene Aluminiumgehäuse des Geschützes faszinierte sie. Womöglich weil es mehr zu sagen hatte als die restlichen Ausstellungsstücke. Weil es nur ihr etwas sagen wollte, das es allen anderen verschwieg.
Etwas vom 18. August 2023.
5
Der 18. August war ein Donnerstag.
Man hatte die M109 bei Tagesanbruch durch eine Transportfirma auf die Hügelkette südlich der Stadt schleppen lassen.
Wenn der Preis stimmte, fragte niemand nach den Hintergründen des Auftrages.
Die Zugmaschine schob das Waffensystem auf die Erdsporne, koppelte ab und machte sich auf den Rückweg. Zurück blieben ein milder Morgen und eine Besatzung, die aus drei Männern bestand. Zwei zu wenig, um das Geschütz mit der Geschwindigkeit zu betreiben, für die es konzipiert worden war. Aber Geschwindigkeit war für das Vorhaben nicht von Relevanz. Die Mannschaft hatte vom ersten Schuss an eine halbe Stunde, um das Ziel zu treffen – in artilleristischen Größenordnungen war das alle Zeit der Welt.
Anfangs würden sie Projektile ohne Zünder verschießen und nach jedem einzelnen die Ausrichtung des Rohres korrigieren. So lange, bis sie sich an das Objekt herangetastet hätten. Für das Personal des Reaktors wäre nur ein entfernter Knall der Treibladung zu hören, im Anschluss daran das bedrohliche Surren, wenn Stahl Luft trennte, und dann ein krachender Einschlag. Einer ohne Detonation.
Der Vorteil an der zünderlosen Munition in Kombination mit einer Anvisiertechnik, bei der man Probeschüsse von unten immer weiter an das Ziel heransetzte, war eine Verdopplung der Trefferwahrscheinlichkeit. Ging das Geschoss zu tief und hatte keinen allzu steilen Winkel zum Boden, entstand ein Abpraller. Es setzte in diesem Fall auf der Erde auf, prallte ab und überschlug sich mehrfach in Richtung Zielobjekt, um es mit etwas Glück doch noch todbringend zu erreichen. Dann explodierten zwar nicht die darin enthaltenen elf Kilogramm Sprengstoff, aber die Wucht von dreiundvierzig Kilogramm, die mit einer Geschwindigkeit von dreitausend Stundenkilometer aus dem Rohr geprügelt wurden, reichte, um einen feindlichen Panzer, an der Wanne getroffen, auf das Dach zu werfen. Das, so glaubte die Mannschaft des Geschützes, müsste auch einem thermonuklearen Reaktor genügen.
Zumindest die ersten drei, vier Schüsse lang sollte das Kraftwerkspersonal in Chaos verfallen und keine Idee haben, was in ihrer unmittelbaren Nähe einschlug. Und alle dreißig Sekunden würde die Besatzung nachladen und die Feinjustierung des Zielfernrohres geringfügig dem Atommeiler näherbringen.
Bis es Zeit für Munition mit Zündern wäre.
»Brüder, es ist so weit.«
Jamal löste den Verschluss mit einem Schlag auf den Arretierungshebel. Unter metallischem Krachen schloss er den ersten Boten ein, den sie der Welt mitzugeben hatten.
»Drei, zwei, eins, FEUER!«
Jamal zog kräftig an der Leine und verursachte einen Donner, der das gesamte Geschütz erst rückwärts auf die Erdsporne und dann nach vorn schwanken ließ. Die Waffenanlage im Kampfraum rauschte an den Köpfen der drei vorbei, schlug innerhalb des Bruchteils einer Sekunde bis fast an die Rückseite des Geschützturmes aus und fuhr wieder in die Ausgangsposition. Der Verschluss stand offen und qualmte.
»Los, los, los, Männer!«, trieb Noah Bijan und Jamal an, die ein neues Geschoss ins Rohr hievten und es in die Züge und Felder pressten. Die Treibladung dahinter, Anzünder hinein und den Verschlussblock schließen.
»Feuerbereit!«, schrie Jamal von seiner Position rechts der Waffenanlage.
»FEUER!«
Den zweiten Schuss hatte Noah geringfügig höher angesetzt. Ein Abpraller, der krachend in einem der Nebengebäude endete.
Geschoss um Geschoss ging zünderlos im einen Kilometer entfernten Zielgebiet nieder. Im zweistelligen Meterbereich arbeitete man sich an das Ziel heran. Bis ein Projektil die Reaktorkuppel seitlich streifte und das erste Sprenggeschoss mit Verzögerungszünder in der Waffenanlage auf den Einsatz wartete.
»Brüder, lasst uns Geschichte schreiben! Seid ihr bereit?«
Nicken von Bijan.
Von Jamal kam keine Reaktion aus seinem versteinerten Gesicht, was als Zustimmung zu werten war.
»Dann sehen wir uns danach. Ich warte auf euch. DREI … ZWEI … EINS … FEUER!«
Das Geschoss trieb es grollend aus dem Rohr. Durch einen Rechtsdrall stabilisiert steuerte es auf den Reaktor zu, kam etwas tiefer als anvisiert, hielt aber dennoch auf den unteren Kuppelrand zu und schlug ein.
6
»Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden den zweiten Tag unseres Kongresses mit einem Vortrag beginnen, der definitiv hohe Wellen schlagen wird.«
Mit tiefer Männerstimme dröhnte der Satz durch das Kongresszentrum, das bis auf den letzten Platz besetzt war.
»Ich kenne Herrn Martens Ausführungen bereits und seine Sicht der Dinge hat mir gelinde gesagt schlaflose Nächte bereitet. Ich denke, Ihnen wird es genauso gehen. Lassen Sie die Argumente auf sich wirken. Sie haben mit unserer Arbeit auf den ersten Blick wenig zu tun, aber wenn William Marten recht behält, stehen wir vor ernsten Problemen. Doch ich will nicht vorgreifen. Nur noch eine Anmerkung. Der Beitrag musste stark eingekürzt werden, da er sich bedauerlicherweise eine Kieferverletzung zugezogen hat. Er konzentriert sich somit nur auf das Wesentliche. Umso erfreulicher, dass er trotz alledem hier ist. Ich übergebe also das Wort an William Marten.«
Der Applaus zog Marten auf die Hauptbühne des europäischen Luft- und Raumfahrtkongresses.
»Ich danke für die Einladung«, begann er. »Es freut mich, heute vor diesem Kreis sprechen zu dürfen, gerade weil alle von Ihnen weitaus mehr von der Raumfahrt verstehen als ich. Deshalb ist die Frage, was ich hier zu suchen habe, durchaus berechtigt. Aber wie bereits angedeutet kann ich zur Diskussion tatsächlich beitragen. Beispielsweise durch die Information, dass das, woran Sie fieberhaft arbeiten, nicht der erste Anlauf für eine Besiedlung eines benachbarten Planeten ist. Vor dreißig Jahren hat es eine ähnliche Planung gegeben, damals im Rahmen eines dänischen TV-Projekts mit einem eigenen Fernsehkanal, der Tag und Nacht jeden Schritt der Bewohner übertragen sollte. Das Vorhaben ist in einem sehr frühen Stadium aus moralischen Erwägungen gestoppt worden. Kein Produzent wollte verantworten, dass dort oben jemand ernsthaft erkrankt und mangels ausreichender medizinischer Versorgung vor laufenden Kameras zugrunde geht. Ich vermute, die Sache war zu kurz in den Medien und ist zu lange her, als dass sie einem von Ihnen noch in Erinnerung ist. Oder irre ich?«
Er ließ den Blick durch die Zuschauerreihen schweifen und hielt sich die Wange, in der es zu schmerzen begann.
»Ich bin durch einen Zufall darauf gestoßen, als mir vergangenes Jahr ein Beitrag in einem Fachblatt aus dieser Zeit in die Hände fiel, der das Thema einer generationsübergreifenden Gefangenschaft anriss. Für mich eine hochspannende Sache, mit der ich daraufhin die letzten Monate zugebracht habe. Für Sie wohl nicht ganz so spannend, da Sie als Praktiker die technische Umsetzung weit mehr interessieren dürfte als das, was der Typ auf der Bühne gerade über Gefangenschaft faselt.«
Marten grinste in sich hinein. Ihm war völlig klar, dass jeder Zweite im Publikum so dachte.
»Aber manchmal sollte man die Praktiker frühzeitig bremsen, damit sie nicht mit zu viel Enthusiasmus eine Idee verfolgen, die von Anfang an keine Zukunft hat – denn verehrte Zuhörer, lassen wir die Katze aus dem Sack: Die Kolonie, die Sie im Sonnensystem planen, egal wie groß die Population ist, wird nach spätestens vier Generationen keine positive Fortpflanzungsprognose mehr haben.«
Marten genoss den Anblick fassungsloser Gesichter und vereinzelte Zurufe. Nur sein Unterkiefer machte ihm heftigst zu schaffen. Wenn er den Mund beim Sprechen nicht allzu weit öffnete, ging es, aber das ließ sich bei dieser Veranstaltung unmöglich durchhalten. Während er weitersprach, zog er die Geldbörse hervor und fing an, darin zu kramen.
»Verstehen Sie mich richtig. Ich finde Ihr Vorhaben großartig und würde mir wünschen, dass es gelänge. Aus meiner fachlichen Sicht jedoch kann es nur scheitern. Denn nach zwei Generationen kommt die Fortpflanzung zwar noch nicht zum Erliegen, aber die Populationsentwicklung wird derart zurückgehen, dass ein dauerhaftes Überleben ihrer Probanden nahezu unwahrscheinlich ist.«
Die Proteste der Zuschauer wurden lauter.
Martens hatte zwischen dem Kleingeld gefunden, wonach er suchte, und zog ein winziges Tütchen hervor.
»Einen Augenblick.«
Er riss es an der schmalen Seite auf und sog das darin befindliche Gel heraus.
»Es schmeckt beschissen«, hatte ihm der Inhaber der Boxhalle versichert, als dieser ihm das Schmerzmittel in die Hand gedrückt hatte. »Bevor du auch nur darüber nachdenkst, das Zeug runterzuschlucken, ist es längst dabei, in deiner Birne einen Schalter umzulegen. Und danach läufst du einen Marathon, selbst wenn ich dir vorher den Fuß breche.«
Obwohl Marten den Typen mit dem permanenten Schweißgeruch grundsätzlich für einen Schwätzer hielt, so hatte er dieses Mal nicht zu viel versprochen.
Mit dem letzten Tropfen auf der Zunge begann der Schmerz aus den Knochen zu weichen und er spürte, wie das hoch dosierte Mittel wirkte.
Ich muss langsam erwachsen werden und mich nicht jedes Mal herausfordern lassen, dachte er, während er das Tütchen verschwinden ließ und sich wieder dem Publikum zuwandte. Wenn es jemand mit zehn Kilo weniger auf den Rippen ohne Probleme schafft, mir den Kiefer mit einer geraden Linken anzubrechen, dann sind meine aktiven Zeiten eindeutig zu lange her. Bin schließlich keine achtzehn mehr.
Eine Viertelstunde später verließ Marten die Bühne und kurz darauf den Saal.
Er ging davon aus, dass er zwar viele im Publikum erreicht hatte, aber nachdenklich stimmen konnte er wohl nur die Wenigsten. Doch das kümmerte ihn nicht – sein Auftrag war es zu informieren, nicht zu bekehren.
Im Foyer befanden sich eine Frau an der Garderobe, ein älterer Mann im Eingangsbereich und zwei Herren in dunklen Anzügen, die auf ihn zukamen.
»Folgen Sie uns«, sagte einer von beiden mit einer Selbstsicherheit, die keine Gegenwehr zuließ.
»Einen Teufel werde ich«, entgegnete Marten empört.
»Es geht um Ihre Arbeit.«
»Ich kenne Sie nicht einmal«, regte sich der Psychologe auf und bekam einen Regierungsausweis vors Gesicht gehalten.
»Wir brauchen mehr Informationen zu dem, was Sie im Vortrag angesprochen haben.«
»Dann lesen Sie meine Studie, so wie ich es jedem da drinnen angeboten hatte. Laden Sie sie herunter. Sie ist frei verfügbar.«
»Lassen Sie das! Sie werden persönlich benötigt.«
»Kein Interesse!«
Marten ließ die Männer stehen und machte sich auf, das Kongresszentrum zu verlassen.
»Ich habe zu Hause einen Teenager. Der stellt mich schon vor genug Probleme. Da brauche ich Ihre nicht auch noch.«
»Sind Sie sicher?«
Die Frage klang bedrohlich.
»Wenn Sie jetzt gehen, sehen wir uns in kürzester Zeit unter anderen Umständen wieder.«
»So motivieren Sie niemanden, junger Mann«, erwiderte Marten, zog sich Atemfilter und Cape über und verließ das Foyer.
Ihm blieben an diesem Tag noch zwölf Minuten, die er im Freien zubringen konnte – zwei, um bis zur RegioMed eine Straße weiter zu gelangen, und zehn für den Heimweg.
Die RegioMed-Stellen waren ursprünglich geschaffen worden, um die flächendeckende ärztliche Versorgung vor allem in ländlichen Gebieten sicherzustellen. Nun drei Jahrzehnte und ein Kassensterben später verkörperten sie den beklagenswerten Rest, der vom staatlichen Gesundheitswesen übrig geblieben war – kleine Geschäftsstellen mit einem Mitarbeiter, der in einem Schalter saß, der Tag und Nacht geöffnet hatte. Einer auf fünfzigtausend Einwohner. Wer einen Arzt brauchte, ging als Erstes dorthin, trug der Person hinter der schusssicheren Scheibe das Problem vor und bekam in seltenen Fällen einen Behandlungsschein. Mit diesem stellte man sich dann in einer der heruntergekommenen Arztpraxen in der Nähe vor. Ein Verfahren, bei dem der Staat zumindest ein Viertel der Kosten für eine Handvoll diagnostischer Maßnahmen und einige Medikamente übernahm. Den Rest musste jeder selbst zahlen.
In Martens Fall bedeutete dies, dass drei Tagesgehälter für die Untersuchung seines Unterkiefers als Eigenanteil fällig werden sollten, wobei der Arzt nichts anderes tun würde, als den Knochen abzutasten und sich von der Funktion der Kiefergelenke zu überzeugen. Eine Computertomografie bei einem Verdacht auf eine Fraktur würde die Kosten verdoppeln. Käme dabei heraus, dass der Bruch operativ versorgt werden müsste, wäre dies für ihn finanziell nicht machbar. Genauso wie der Abszess in Martens Stirnhöhle, den er seit der Scheidung nicht entfernen lassen konnte. Das Gleiche galt für die Nierenpunktion, die er vor sich herschob, seitdem seine Werte nicht mehr stimmten. Allerdings war er mit den Jahren nicht mehr sicher, ob er die Diagnose, die hinter den Beschwerden stand, wirklich wissen wollte. Es gab nur drei Erkrankungen, die zu den Symptomen passten. Zwei waren zu annähernd hundert Prozent heilbar, aber die Therapiekosten machten einige Jahresgehälter aus und lagen außerhalb seiner Reichweite. Variante drei hieß Krebs und würde unweigerlich eine nicht zu stoppende Maschinerie von Konsequenzen nach sich ziehen: Im ersten Schritt müsste Marten akzeptieren, dass ihm die Mittel für die Tumortherapie fehlten. Rücklagen hatte er nicht und jede Bank verweigerte ihm einen Kredit mit einem Krebseintrag in den Daten. Also würde er dem Karzinom Tür und Tor öffnen und es im Grunde genommen auffordern, im Körper Metastasen zu streuen. Während er monatelang darauf wartete, sollte es ihm gesundheitlich immer unmöglicher werden zu arbeiten. Es wäre nur eine Frage der Zeit, bis er vollständig ausfiel. Und dann? Dann wäre die Kündigung unausweichlich und würde ihm langfristig jegliche Existenzberechtigung nehmen. Wenig später würde er ebenso wie seine Ex-Frau aus dem System fallen.
7
Geschafft ließ sich Marten in den Sessel fallen und riss ein Tütchen des Schmerzgels auf.
»Bist du wieder da?«, fragte er, als die Wohnungstür leise geöffnet wurde.
»Kann dir doch egal sein«, kam es von Zoe zurück, die versuchte, in ihr Zimmer zu verschwinden.
»Mädchen, jetzt warte mal. SO LÄUFT DAS NICHT! Entweder finden wir einen gemeinsamen Nenner, oder wir lassen das Ganze hier.«
»Mann, was willst du denn von mir?!«
Trotzig blieb die Schwarzhaarige stehen.
»Ich habe wirklich Verständnis für deinen Unmut, für die Pubertät und alle anderen widrigen Umstände, aber …« Marten war anzusehen, dass er sich vor Schmerzen kaum auf das Gespräch konzentrieren konnte. »Allerdings geht es mir gerade auch nicht besonders. Ich hatte mittags einen Abstecher in die Boxhalle gemacht, um den Kopf freizubekommen, und mich von Steve zu einer kleinen Runde verleiten lassen. Er hat mir eine Fraktur irgendwo beim Kiefergelenk verpasst. Also nimm dir meinetwegen ein Bier – gern auch etwas anderes, wenn dich das runterbringt. Aber wir beide haben ein ernsthaftes zwischenmenschliches Problem, welches wir entweder jetzt aus der Welt schaffen, oder mein früheres Schlafzimmer wird ab morgen wieder mein Schlafzimmer. Verdammter Mist, tut das weh!«, fluchte Marten und drückte das Schmerzmittel aus der Verpackung.
Als Zoe in der Tür stand und von einem Lagerbier kostete, entkrampften sich allmählich die Falten zwischen seinen Augenbrauen und er konnte wieder klare Gedanken fassen.
»Da hat jemand den Steve unterschätzt, was?«, grinste die Dreizehnjährige.
»Ich hatte nur einen schlechten Tag.«
Marten wusste, dass das gelogen war, aber etwas Gegenwehr von ihm war für den Gesprächsverlauf durchaus förderlich.
»Genau!«, belächelte sie ihn. »Hast du dir mal Steves Arme angesehen und mit deinen verglichen?! Der ist bestimmt drei Mal die Woche im Fitnessstudio. Brauchst du Tiefkühlgemüse?«
Er nickte und sah, wie Zoe im Flur verschwand. Kurz darauf hatte sie die Brieftasche des Vaters in der Hand und erleichterte sie um einen Schein.
Ohne den Hauch eines schlechten Gewissens kam sie mit einer Packung Erbsen zurück, mit der Marten die rechte Wange kühlte.
»William?«
Er hatte im vergangenen Jahr den Zeitpunkt verpasst, etwas dagegen zu tun, dass seine Tochter ihn mit dem Vornamen ansprach. Aus Gründen, die er jetzt nicht mehr nachvollziehen konnte, ließ er es damals durchgehen. So lange, bis es zu spät war.
»Was denn?«
»Das Internet ist tot.«
»Sicher?«
»Es geht seit dem Nachmittag bei niemandem in der Nachbarschaft.«
»Okay. Kümmere mich morgen drum. Hab die nächsten Tage frei.«
»Die Polizei kannst du auch vergessen.«
»Wie meinst du das?«
»Vorn am Eckhaus hat man heute eingebrochen. Die Familie kam vorhin zu uns, weil sie dachten, ihr Telefon sei kaputt. Aber es liegt nicht an den Telefonen. Es geht überhaupt keine Polizeinummer mehr.«
»Das ist merkwürdig.«
Marten stand auf, um sich aus der Vitrine ein Glas zu holen und einen Scotch einzuschenken.
»William?«
»Hmm.«
»Die Nachbarn haben auch gesagt, dass gerade reihenweise Leute aus dem System fallen.«
Marten wusste genau, worauf die Bemerkung hinauslief.
Wie oft haben wir das bereits besprochen, Zoe? Wie oft?
Es war der Frühling nach dem Judgement Day, als die Geburtenrate erstmals auf null Komma fünf sank. Ein halbes Baby auf zwei Erwachsene bedeutete, dass die Bevölkerung mit jeder neuen Generation auf ein Viertel schrumpfte. Zehn Jahre später erschien bei der Quote sogar die erste Null hinter dem Komma. Und als wäre das nicht schon dramatisch genug, kam die Masse des Nachwuchses mit genetischen Fehlern auf die Welt. Der Sozialkollaps 2035 war die logische Konsequenz. Immer mehr Rentner, immer weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter und kaum gesunde Kinder. Selbst als wochenlange Proteste folgten, gab es keinen Weg, um das Renten- und Arbeitslosigkeitsversicherungssystem zu halten. Der Sozialstaat war unwiederbringlich gescheitert.
Bis zu diesem Punkt handelte es sich bereits um harte Rahmenbedingungen, die für den Einzelnen nur einen Rest an Planungssicherheit boten, solange man ein gewisses Alter nicht überschritten hatte. Man musste nur arbeitswillig sein und von Anfang an privat vorsorgen.
Der endgültige Genickbruch stand jedoch erst bevor und kam vonseiten der Krankenkassen. Deren völlig überalterter Versichertenstamm beanspruchte immer mehr Leistungen und erbrachte nur noch einen Bruchteil der früheren Einnahmen. Als das Kassensterben 2039 einsetzte und es darum ging, wenigstens einen bundesweiten Versicherungsträger am Leben zu erhalten, funktionierte dies nur mit einem schmerzhaften Einschnitt. Er bestand darin, dass die aus dem System ausschieden, die zu teuer wurden. Kurzum: Wer die Diagnose Krebs oder etwas Vergleichbares bekam, verlor zuerst seine Krankenkasse und aus gesundheitlichen Gründen zwangsweise auch irgendwann den Job. Was blieb, war eine Wohnung, für die das entsprechende Einkommen fehlte. Im Regelfall überschrieben die Betroffenen diese dann einer Agentur, die das Inventar verkaufte und so einen Betrag erzielte, mit dem es möglich war, sich einige Wochen über Wasser zu halten. Oft reichte das, denn die Erkrankten lebten nicht viel länger.
Ein Jahr später war auch die letzte Kasse zahlungsunfähig und das Gesundheitssystem verlor als Institution seine Berechtigung. Das, was im Sprachgebrauch als System übrig blieb, war das, was sich daraufhin entwickelt hatte – ein Markt, auf dem der Großteil der ärztlichen Leistungen bar bezahlt wurde und auf dem der Staat nur noch einen verschwindend geringen Anteil der immens angestiegenen Kosten übernahm. Das, was an medizinischem Fortschritt in den vergangenen zweihundert Jahren das Leben der Bevölkerung verlängert hatte, wurde auf einen Schlag für den überwiegenden Teil nicht mehr finanzierbar. Der Alzheimer-Impfstoff kostete ein durchschnittliches Jahreseinkommen, eine Blinddarm-OP die Hälfte. Den meisten Menschen war es von da an unmöglich, an einer umfangreichen ärztlichen Versorgung teilzuhaben. Damit reduzierte sich deren Lebenserwartung auf das Niveau des neunzehnten Jahrhunderts. Es profitierten nur noch die vom System, die über das entsprechende Vermögen verfügten. Alle anderen schieden über kurz oder lang aus.
Zoe wusste, wie das System funktionierte. Sie war intelligent genug zu erkennen, in welchen Situationen Personen herauszufallen drohten und wann es kein Zurück mehr gab. Doch selbst wenn sie das Prinzip verstanden hatte, hieß das noch lange nicht, dass sie es auch akzeptierte – denn seit zwei Jahren fehlte die Begründung, warum es ihre Mutter getroffen hatte. Ohne Vorankündigung. Ohne ein Wort der Erklärung. Sie hatte sich nicht einmal verabschiedet.
Das machte es Zoe unmöglich, den Verlust zu akzeptieren. Deswegen machte sie ihn immer dann zum Thema, wenn ein Gespräch auch nur ansatzweise in die Richtung ging.
»Du hast doch damals gesagt, dass du nach der letzten Nachricht von Mama auf deiner Mailbox keine Ahnung hattest, wo sie war.«
»Genau«, antwortet Marten, obwohl er lieber eine Grenze gezogen und ein für alle Mal klargestellt hätte, dass er diese Fragen nicht länger ertrug. »Ihre Handynummer hatte sie beim Provider abgemeldet und die Wohnung wurde zu dem Zeitpunkt gerade abgewickelt. Ich hatte lediglich die Freigabe, deine persönlichen Sachen zu holen. Es gab keinerlei Möglichkeit, an sie ranzukommen.«
»Weshalb hast du sie nicht hierher geholt?«
»Hörst du mir denn zu? An sie war überhaupt kein Rankommen. Und Zoe, wir waren seit Ewigkeiten getrennt«, sagte Marten und verschwieg, wie abwegig er diesen Gedanken fand. »Deine Mutter und Hilfe annehmen? Das hat noch nie zusammengepasst. Warum sollte das ausgerechnet an so einem Punkt anders sein? Sie ist einfach gegangen.«
»Sag schon, hättest du sie aufgenommen, wenn sie gefragt hätte?«
Zoes Stimme schlug bereits wieder ins Schrille um, so wie am Morgen, kurz bevor sie zur Schule aufgebrochen war.
»Sicher«, log Marten und nippte am Scotch. Am liebsten wäre ihm jetzt ein Doppelter auf Ex gewesen und gleich darauf ein zweiter. Aber seit er mit einer Schulpflichtigen zusammenlebte, gehörten solche Trinkgewohnheiten der Vergangenheit an.
»Warum gehen wir in keinen Distrikt?«, wechselte Zoe das Thema.
Nicht schon wieder. Ich ertrage das nicht mehr!
Wie gern hätte Marten diese Diskussion im Keim erstickt, die er mit seiner Tochter inzwischen im Wochentakt führte. Ein Leben im Distrikt kam für ihn nicht infrage. Alle aus dem Bekanntenkreis, die beschlossen hatten, in die Kolonie zu gehen, waren von da an komplett von der Bildfläche verschwunden. Kein Anruf, keine Nachricht. Nie wieder.
»Kannst du damit endlich aufhören?!«
»Heute war der Ausflug ins Museum.«
»Okay.«
»Liam ist immer nur still hinterher getrottet. Genau wie die letzten Tage schon. Selbst wenn man ihn angesprochen hat, sagte er kaum was. Am Ende ist er dann nicht mit uns zurückgefahren, sondern seine Mutter hat ihn abgeholt. Da gab’s ein kurzes Gespräch mit dem Lehrer und plötzlich hieß es, dass wir zukünftig nur noch zu sechst in der Klasse sind.«
»Vielleicht ziehen sie ja woanders hin?«, antwortete Marten.
»HÄLTST DU MICH FÜR BESCHEUERT?!«
Zoes Augen füllten sich mit Tränen, denen nur ein Wimpernschlag fehlte, damit sie auf die Wangen fielen.
»Es zieht überhaupt niemand um! NIE ZIEHT JEMAND UM! Mann, wir waren letztes Jahr noch acht in der Klasse.«
»Zoe«, beschwichtigte der Vater.
»Willst du eigentlich darauf warten, dass ich auch krepiere?«
»Jetzt dramatisiere doch nicht. Weißt du denn, ob er sich an die Ausgangszeiten gehalten hat? Womöglich lief er regelmäßig länger als die fünfundvierzig Minuten draußen herum. War er ständig mit Filter und Cape unterwegs? Hat er beides täglich getauscht? Besitzen die Eltern in ihrem Haus eine vernünftige Luftfilteranlage? Es gibt so viele Dinge, mit denen er oder seine Familie eine Verstrahlung selbst verursacht haben könnte. Was denkst du, warum ich diese Sachen immer wieder predige!«
Marten sprach das Gasnetz erst gar nicht an, weil wohl niemand in Zoes Klasse das Vermögen hatte, um sich daran anschließen zu lassen – auch wenn das das Beste war, was man tun konnte.
Mit dem Jahrtausendwechsel wurden kommunale Gasnetze für die Versorgung der Bevölkerung zunehmend uninteressant. Kaum jemand kochte noch mit Gas und immer weniger nutzten die fossilen Brennstoffe für die Heizung. Aber die Leitungen lagen in der Erde, obwohl sie keine wirtschaftliche Bedeutung mehr hatten. Damals ahnte niemand, dass sie ein Milliardengeschäft ermöglichen würden. Denn mit dem Judgement Day stieg die Nachfrage nach strahlungsfreier Atemluft dramatisch an. Luftfilteranlagen in den Wohnungen schafften es zwar, die Radioaktivität zu mindern, aber sie konnten sie nicht gänzlich beseitigen. Dies war nur möglich, wenn sich eine Familie zu horrenden Preisen an das Gasnetz anschließen ließ, durch das ab Mitte der Zwanzigerjahre reine Atemluft floss. Sie strömte kontinuierlich aus und erzeugte in den Räumen einen minimalen Überdruck. Sobald es dann kleinere Undichtigkeiten zum Beispiel an den Fenstern gab, sorgte der Überdruck dafür, dass Luft immer nur nach außen und nie in die Wohnung hineinströmte. In Verbindung mit einer Eingangsschleuse im Flur und konsequenter Dekontamination der Kleidung konnte die Strahlungsbelastungen in den eigenen vier Wänden im Vergleich zu herkömmlichen Haushalten auf unter zwölf Prozent reduziert werden.
»WEIL DIR NICHTS BESSERES EINFÄLLT!«, schrie Zoe. »Denn du hast auch keine Ahnung, wie man verhindert, dass neun von zehn Leuten an Krebs verrecken! Ist es so schwer zu begreifen, dass ein Distrikt die einzige Lösung ist?!«
Es machte Marten wahnsinnig, dass er emotional so tief in der Auseinandersetzung mit seiner Tochter steckte. Würde ihm ein Außenstehender die Situation schildern und hätte er ausreichend Abstand zu den Beteiligten, könnte er problemlos einen professionellen Rat geben, wie man mit einem Teenager dieses Kalibers umgehen sollte. Doch so wie er in den Fall verwickelt war, nutzte ihm weder sein Studium etwas noch die Berufserfahrung. Alles wühlte ihn derart auf, dass er kaum sachlich bleiben konnte. Das spürte er ein ums andere Mal, seit Zoe bei ihm lebte.
»Und was hat man in der Kolonie für eine Perspektive?«, fragte er. »Wie beschissene Laborratten im Käfig. Ohne freien Willen. Das hat doch nichts mit Leben zu tun.«
»WOHER WEISST DU DAS? WARST DU SCHON MAL DORT?«, schrie sie.
»DAS WEISS MAN EBEN!«, brüllte er zurück.
»Aber wenigstens ist es ein Leben!«, giftete Zoe ihn an. »Nimmst du wirklich in Kauf, dass ich irgendwann genauso wie Liam draufgehen werde?«
»VERZIEH DICH IN DEIN ZIMMER«, schrie Marten. »Und dann denke mal darüber nach, was ich dafür kann, dass deine Mutter sich sang- und klanglos verpisst hat. ICH KANN ES NICHT MEHR HÖREN!«