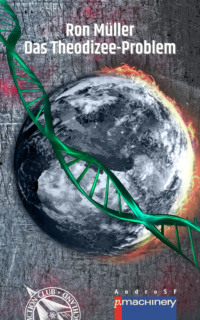Kitabı oku: «DAS THEODIZEE-PROBLEM», sayfa 4
8
Um drei Uhr vierzig wurde das Blaulicht heller und mit ihm kam eine Stimme aus einem Megafon näher.
»Es wurde eine Ausgangssperre verhängt. Bleiben Sie in Ihren Häusern. Ich wiederhole: Bleiben Sie in den Gebäuden und folgen Sie den Anweisungen! Es sind Notstandsgesetze in Kraft getreten, die die Räumung der Gebäude erforderlich machen. Leisten Sie keine Gegenwehr! Wir sind zum unangekündigten Waffeneinsatz berechtigt.«
»Papa!«
Zoe kroch auf allen vieren aus ihrem Zimmer, aus Angst, durch das Fenster von den Scheinwerfern der Militärfahrzeuge erfasst zu werden.
»PAAAPAAA!«, kreischte sie panisch, als ein Lichtkegelpaar mit Blick auf ihr Haus stehen blieb. Ihr war nicht mehr danach zumute, Marten mit Vornamen anzusprechen. Sie brauchte gerade niemanden auf Augenhöhe.
»Zoe, wo bist du?«
»Am Ende des Flurs. Hilf mir!«
»Komm her.«
Er winkte sie zu sich in die Küche.
Als sie den Vater erreichte, drückte sie ihn mit der festen Absicht, ihn nicht wieder loszulassen.
»Was sind das für Leute?«
»Ich weiß es nicht.«
Marten küsste ihre Stirn und registrierte, wie hinter einem Streifenwagen zwei Flecktarn-Lkw hielten und Soldaten ausstiegen.
»Ich sehe mir das schon eine halbe Stunde an. Sie sind bei fast allen Nachbarn gewesen und haben sie aus den Häusern geholt. Übrig bleiben nur noch wir und nebenan die Kanzlei.«
Nachdenklich verfolgte er das Geschehen durch das Fenster.
Es war ein Fehler, aus dem Zentrum wegzuziehen, dachte Marten.
Als die Strahlung dafür sorgte, dass sich die Stadtbevölkerung immer weiter zurückzog, kam es zu einer Verlagerung des Lebens – weg von den Straßen und tiefer hinein in ihre Häuser. Überall, wo es ging, brach man in den Kellern die Wände zu den Nachbargebäuden durch. Diese Gänge ergaben zwar kein zusammenhängendes Netz, es entstanden jedoch viele kleine Verbindungen, um die Sozialkontakte in der näheren Umgebung aufrechtzuerhalten. So konnte sich Marten vom Kellergeschoss des Mietshauses aus, in dem er nach der Hochzeit mit seiner Ex-Frau wohnte, in beide Richtungen fünf, sechs Hausnummern weit bewegen.
Eine Situation mit Begleiterscheinungen, die er damals furchtbar fand. Ständig liefen ihm fremde Gesichter im Treppenhaus über den Weg oder es klopften ominöse Personen an die Tür, um etwas unter der Hand zu verkaufen. Der Schwarzmarkt befand sich praktisch vor der Wohnung. Ein Umstand, der ihn derart nervte, dass er auf Zoes Mutter so lange einredete, bis sie mit ihm einige Viertel weiter nördlich das Haus kaufte – ganz bewusst eines ohne Keller und damit auch eines ohne den Fluchtweg, den er gerade so dringend brauchte.
Was würde ich jetzt für unsere alte Mietwohnung geben, ärgerte sich Marten.
»Was machen sie mit ihnen«, flüsterte Zoe und spürte, wie das Zittern ihrer rechten Hand nicht mehr aufhörte.
»Ich vermute, sie verladen sie. Man sieht es von hier schlecht. Zumindest fahren die Zehntonner irgendwann los und es geht niemand zurück in die Häuser.«
»Denkst du, die …«, etwas in Zoe hinderte sie, das auszusprechen, was sie dachte.
9
Beginnend mit Edward Snowdens Enthüllungen im Jahr 2013, spätestens jedoch mit der Akte Bailong Chén 2027 setzte man in Regierungskreisen bezüglich der Informationsübermittlung zunehmend auf Methoden vergangener Tage. Man entschied sich bei als geheim eingestuften Inhalten kaum noch für die Datennetzwerke der Regierungen. Denn das technische Wettrüsten, bei dem regelmäßig mit neuen Verschlüsselungssystemen versucht wurde, diese Leitungen sicher zu halten, konnte nur kurzfristig Schutz bieten. Nur so lange, bis man auf der Gegenseite gleichzog.
Der Wettstreit ähnelte den Bemühungen der Dopingeindämmung im Profisport. Dort wollte man in der Vergangenheit ebenfalls durch immer kompliziertere Kontrollen des Missbrauchs Herr werden. Nur mit dem Unterschied, dass man sich bei der Spionageabwehr noch nicht geschlagen geben musste.
Anstelle des Informationsaustauschs mittels aufwendig abgesicherter Telefon- und Datenleitungen waren von daher meistens Informanten in den europäischen Hochgeschwindigkeitszügen unterwegs. Sie trugen einen Metallkoffer, an dessen Oberseite sie tief in die Öffnung hinein fassten, um den Griff zu umschließen und damit einen Sicherheitsmechanismus zu aktivieren. Sollte der Träger ihn loslassen oder einen Knopf in der Handöffnung betätigen, wäre der Inhalt innerhalb einer Sekunde pulverisiert und ein Kollege würde sich mit der gleichen Information erneut auf den Weg machen. Eine Praxis, welche durch die gefälschte Nachricht des schwedischen Ministerpräsidenten im Jahr 2023 und dem dadurch entstandenen Judgement Day für einige Zeit infrage stand, doch mangels Alternativen nie aufgegeben wurde. Stattdessen war von da an neben der Akkreditierung des Entsendestaates auch die jeder einzelnen Zielnation erforderlich. Dieses Verfahren bewährte sich. Denn so konnte man den Informationsfluss zwar stören und verlangsamen, aber nicht mehr manipulieren.
P51 erreichte vom Warszawa Centralna kommend den Speckgürtel von Berlin.
Namen hatten sich bei der Informantenklientel als hinderlich herausgestellt. Man war dazu übergegangen, die in diesem Bereich eingesetzten Personen schlichtweg durchzunummerieren und den Anfangsbuchstaben des Herkunftslandes davor zu setzen.
Unter den Füßen des Informanten P51 durchzog ein auf minus zweihundertneunundsechzig Grad Celsius heruntergekühlter Supraleiter sämtliche Waggons und sorgte dafür, dass es keinen Kontakt, sondern einen fingerbreiten Abstand zur Schiene gab.
Sobald P51 durch das Fenster blickte, sah er kaum mehr als die Nacht. Doch selbst wenn es hell gewesen wäre, hätte er nur ein verzerrtes Bild der Umwelt wahrgenommen. Die gesamte Strecke Berlin–Warschau befand sich in einer schusssicheren Plexiglasröhre, in der ein annäherndes Vakuum herrschte. Das reduzierte den Luftwiderstand auf ein Minimum. So konnte bereits kurz hinter der deutsch-polnischen Grenze der Antrieb des Zuges heruntergefahren werden. Der Schub der sechshundertachtzig Stundenkilometer, mit der das Magnetschwebesystem bis dahin unterwegs gewesen war, reichte, um die verbleibenden Kilometer zurückzulegen und den Berliner Hauptbahnhof zu erreichen.
P51 verfügte über die Zulassung für Polen, Deutschland und eine Handvoll anderer Staaten. Er war seit zwei Jahren im Geschäft. Zielsicher steuerte er auf den Bahnhofsausgang zu, nachdem er acht Minuten zuvor seinen Bahnsteig erreicht und die Luftschleuse passiert hatte. Es wartete bereits ein Regierungsfahrzeug auf dem Vorplatz, welches ihn ins Kanzleramt bringen sollte.
Man wechselte im Wagen kein Wort. Ein »Hatten Sie eine gute Reise?«, was mancher Fahrer anfangs versuchte, wurde in der Vergangenheit spätestens dann unterlassen, als die Floskel zum wiederholten Mal unbeantwortet blieb. Also wartete man gemeinsam das Ende der Fahrt ab und ging von Fahrerseite irgendwann davon aus, dass Sprachkenntnisse kein zwingender Bestandteil der Informantenausbildung seien.
Gegen neun Uhr morgens öffnete der Fahrer den schwarzen Mercedes und übergab seine Begleitung dem Sicherheitspersonal des Kanzleramtes. Der Scan des im Unterarm implantierten biometrischen ID-Chips und die Signatur des Koffers wiesen P51 aus und erübrigten weitere Kontrollen.
»Einstufung?«, fragte ein Soldat aus Roths Team.
»Kanzler. Persönlich!«, antwortete der Informant in akzentfreiem Deutsch.
»Der ist außer Haus.«
»Dann über den Tresor.«
»In Ordnung. Folgen Sie mir.«
Der Soldat ging mit P51 zwei Türen weiter. In der videoüberwachten Kammer stand nicht mehr als eine metallene Schleuse, an deren Unterseite eine Aussparung in Größe des Koffers dafür vorgesehen war, dass dieser darin abgesetzt wurde.
Es klickte, als der Boden einrastete. Eine grüne Diode, die das Deaktivieren des Sicherheitsmechanismus anzeigte, leuchtete auf und P51 gab in einem Tastenfeld die Dringlichkeit der Nachricht mit der höchsten Stufe ein.
Einen Moment später hatte er seine verschwitzte Hand wieder und der Koffer wurde in die Vertiefung gezogen.
Danach verlor P51 den Informantenstatus mit den dazugehörigen Rechten und reiste auf Staatskosten unter seinem bürgerlichen Namen zurück nach Warschau. Er hatte keine Vorstellung davon, welche Mitteilung er vom polnischen Präsidenten überbracht hatte.
Verehrte Amtskollegen,
es bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen mitzuteilen, dass die Operation Theodizee in Polen als gescheitert angesehen werden muss. Trotz der geheimen Abstimmung im Parlament, welche zu unseren Gunsten verlief, ist der Rückhalt durch das Militär nicht gegeben. Sämtliche Bemühungen, das Abkommen mit dem erforderlichen Nachdruck ab Mitternacht durchzusetzen, sind zum Erliegen gekommen und hatten zu meinem Bestürzen eine klare Front aufseiten der Generalitäten gegen das Vorhaben offenbart.
Zählen Sie mich noch immer zu den Verfechtern unserer Sache. Aber wem ist geholfen, wenn wir sie hier ohne Aussicht auf Erfolg weiter vorantreiben und in letzter Konsequenz dafür in kürzester Zeit die politische Spitze ersetzt wird.
Seien Sie sicher, dass wir dem Brüsseler Protokoll entsprechen werden, und das nicht nur in meiner Legislaturperiode. Binnen Wochen sprengen wir sämtliche Brücken zu den Nachbarstaaten und verminen die Grenzen auf der gesamten Länge.
Hochachtungsvoll
Witold Król
10
Vor der Eingangstür stand ein Mann in Polizeiuniform im Nieselregen. Gelegentlich drangen Megafonansagen zu ihm durch und hallten weiter in die angrenzenden Straßen.
Ab und zu fielen entfernt Schüsse.
Der Beamte hatte gewartet, bis schräg hinter ihm ein Präzisionsschütze kniend in Anschlag gegangen war. Noch richtete dieser den Lauf der Waffe auf den Boden. Das sollte sich ändern, sobald die Tür geöffnet würde oder sich an einem der wenigen Fenster etwas regte. Ein zweiter Soldat derselben Einheit stand näher am Haus direkt neben dem Polizisten.
»Mindestens zwei Personen. Unten gibt es Bewegungen hinter einem Vorhang. Vermutlich der, den wir suchen. Oben ging das Licht an. Schmale kleine Silhouette. Ein Kind oder eine Frau.«
»Wir brauchen die Zielperson lebend«, antwortete der Polizist.
»Was ist mit der anderen?«
»Die auch«, sagte er und zog den Presseartikel aus den Dreißigerjahren mit dem Foto des Gesuchten aus der Brusttasche – eines aus dessen besten Zeiten. Eine Dekade her. In Boxerhose und mit einem überdimensionalen Gürtel um die Taille.
Ostdeutsche Meister.
»Das ist er?«, hatte der Polizist bei der Besprechung am Vorabend im Präsidium gefragt, als er eine Kopie des Zeitungsausschnitts erhalten hatte.
»Nein, das war er!«
Der Mann im Rang eines Polizeioberrats hasste es, wenn Mitarbeiter nicht mitdachten. Schließlich war das Datum unter dem Bild abgedruckt.
»Was heißt das?«
»Meine Fresse!«, schnauzte der Oberrat herum. »Das Foto ist halt einige Zeit her. Stellen Sie sich ihn zehn, zwölf Jahre älter vor. Kann ja nicht so schwer sein. Noch andere Kommentare? Vielleicht auch mal etwas Sinnvolles!?«
Keine, hatte der Polizist gedacht und beschloss, die übrigen Details mit den beiden Soldaten abzustimmen, die man ihm als Unterstützung zugeteilt hatte. Das erschien zielführender als ein Gespräch mit einem ranghohen Klugscheißer des Präsidiums, der meilenweit von der Praxis entfernt war.
11
Es klingelte.
Zoe schreckte auf.
»Geh nicht zur Tür«, flüsterte sie.
»Ich muss! Überall brennt Licht. Man sieht, dass bei uns jemand daheim ist.«
»Nein! Ich hab ein ganz mieses Gefühl.«
Ängstlich hielt sie sich an seinem Unterarm fest, ungeachtet dessen, dass der Vater ihre Furcht nicht verstand.
Marten drückte das Mädchen beiseite. »Vertrau mir.«
Sie wagte einen letzten Versuch in der Gewissheit, den Bogen bereits überspannt zu haben. »Mach nicht auf! BITTE!«
»ZOE, ES REICHT!« Sein verärgerter Blick sorgte dafür, dass sie den Mund hielt.
Er ging den Flur hinunter und öffnete.
Im gleichen Moment sah er einer Gewehrmündung entgegen. Rechts davon glich der Polizist im Licht der Taschenlampe ein Foto mit dem Erscheinungsbild des Mannes ab, dessen eine Körperhälfte noch die Tür verdeckte.
Zwei Blicke genügten und erübrigten den Scan seines ID-Chips unterhalb der Armbeuge.
»Mitkommen!«
»Was?«, fragte Marten verstört.
»AUFLADEN!«, ordnete der Polizist an.
Bevor Marten reagieren konnte, packte ihn der eine Soldat und zerrte ihn aus dem Haus, während der rote Laserpunkt des Präzisionsschützen ununterbrochen auf seiner Brust tanzte.
»DAS KÖNNEN SIE NICHT!«, schrie Marten und versuchte sich aus dem Griff zu befreien. »Was habe ich denn getan?«
Unter heftigstem Protest schleifte man ihn zur Straße.
»Was wird aus meiner Tochter?«
»Keine Sorge, die nehmen wir mit. Sie kommt in einen Distrikt.«
»Spinnen Sie?! SIE KOMMT NIRGENDWOHIN!«
Marten riss sich los und rannte zurück ins Haus.
»LAUF, KLEINE!«, schrie er.
»BLEIBEN SIE STEHEN!«, dröhnte es hinter ihm.
»LOS, ZOE! LAUF!«, brüllte er und hörte das Entsichern einer Waffe.
Erst als seine Tochter durch die Hintertür im Hof verschwand, stoppte er und hob die Arme.
Außer Atem konnte Marten geradezu fühlen, wie sich die Konsequenzen für seinen Widerstand näherten. Die Haare an den Unterarmen stellten sich auf. Es lief ihm kalt über den Rücken, als die Männer auf ihn zukamen. Doch er wagte nicht, nach hinten zu sehen.
12
Als es dämmerte, lag Marten bewusstlos auf der Ladefläche eines Militärfahrzeugs. Der Motor lief. Man wartete auf den Marschbefehl.
»Neunzig, hier achtzehn. Zielperson ist gefasst. Sind marschbereit. Kommen.«
Sekunden tat sich nichts auf dem Funkkanal, abgesehen von starkem Rauschen.
»Hier neunzig. Verlegen Sie zu Bravo zwo Uniform sechs eins Quebec. Kommen.«
Die Frau im Rang eines Oberleutnants suchte auf der Sprechtafel nach der Bedeutung des Codes.
Sie wurde fündig.
»Verstanden. Verlegen zum Zielort. Ende.«
Sie lehnte sich zurück und nahm einen Schluck aus der Wasserflasche.
»Distrikt A. Kennen Sie den Weg?«
Der Fahrer nickte und legte einen Gang ein.
Während er den Lkw beschleunigte, kamen ihm die letzten Militärfahrzeuge aus dem geräumten Bereich entgegen. Zwei Divisionen und alle verfügbaren Polizeikräfte der Region hatten in der Nacht zuerst ein breites Gebiet um die Distrikte evakuiert und anschließend die äußeren Zugänge dieser Zone mit Sperren unpassierbar gemacht. Lediglich die Nord-Süd-Achse war jetzt noch offen, bis sämtliche Konvois den Bereich verlassen hatten und man ihn endgültig schloss.
In den Vormittagsstunden wollte man dann den Damm öffnen, warten, bis die Zone überflutet wäre und so einen mindestens achthundert Meter breiten Graben um die Distrikte schaffen.
Seit dem letzten Hochwasser war klar, dass es keinen Ort geben würde, der sich besser verteidigen ließ. Davor hatte man auch über eine Nordseeinsel als Ort für die Kolonie nachgedacht. Aber der jährlich ansteigende Meeresspiegel und die zunehmenden Flutkatastrophen sprachen eindeutig für die künstliche Insel im Landesinneren, auf der vier Distrikte mit je achtzehntausend Wohneinheiten standen. Wie geschaffen für die Operation Theodizee.
13
»Wie kommen wir voran?«
Am Morgen stützte die Frau, die sich im Zenit ihrer beruflichen Laufbahn befand, die Arme auf die Tischplatte und sah sich einem Führungsstab von sechs Männern gegenüber. Fünf Augenpaare waren auf sie gerichtet – nur eines starrte an die gegenüberliegende Wand und hatte nicht vor, die Blickrichtung zu ändern. Wut und ein durchgebluteter Verband an der rechten Hand sorgte bei Friedemann dafür, dass er seinen Generälen das Reden überließ. Zu tief saß der Wunsch, es ihr mit gleicher Münze heimzuzahlen.
Es blieben noch zwei Minuten, bis der Kanzler kommen und einen Lagevortrag erwarten würde.
»Frau Staatssekretärin, die Zugänge sind um null achthundert geschlossen worden. Vereinzelt gab es Gegenwehr. Die Zahl der Opfer bei der Truppe liegt bei etwa drei Dutzend. Eine exakte Meldung kommt in einer Stunde«, antwortete der Generalinspekteur und schritt zur Karte. »Bei der Bevölkerung sind die Schäden erwartungsgemäß höher, aber bislang erträglich. Derzeit schätzungsweise neunhundert Tote mit Schwerpunkt hier«, er wies auf ein Gebiet nahe der Altstadt, »und im Norden, wo es zu den schwersten Gefechten kam. Wir rechnen mit dem Drei- bis Vierfachen an Verletzten. Die Zahlen müssten jedoch deutlich steigen, wenn die Flutung beginnt, da aufgrund der begrenzten Zeit nicht sämtliche Gebäude geräumt werden konnten. Vor allem die nicht, in denen sich bewaffnete Bürger verschanzt haben. Wir halten dann bis zu fünftausend Opfer und dreißigtausend Verletzte für realistisch.«
»Also läuft es nach Plan«, erwiderte die Staatssekretärin. »Was machen die Pioniere? Kann der Damm schnell genug geöffnet werden oder müssen wir sprengen?«
Ein hagerer General übernahm.
»Das kontrollierte Ablassen des Stausees sorgt frühestens in zwei Tagen für eine komplette …«
»Dann wird halt gesprengt!«, fiel ihm die Staatssekretärin ins Wort. »Wann kann es losgehen?«
»In neunzig Minuten.«
»Wie lange dauert es, bis die Stadt vollgelaufen ist?«
»Weniger als eine Stunde.«
»Gut. Dann werden Sie dem Kanzler genau das vorschlagen. Bis zum Mittag will er eine Insel sehen!«
Die Staatssekretärin hörte bereits die Schritte der Personenschützer des Kanzlers. Gleich sollten sie die Flügeltüren aufstoßen und dafür sorgen, dass sich jeder der Anwesenden ruckartig vom Sessel erheben und Haltung annehmen würde.
Es war Zeit, den Regierungschef über die aktuelle Lage zu unterrichten.
Zweihundert Meter entfernt schleppten zwei Sicherheitskräfte Marten in einen Verhörraum. Kurz zuvor hatte sich ihm ein Arzt mit einer guten und einer schlechten Nachricht genähert.
Die gute Nachricht war eine Spritze mit Botox, das er an verschiedenen Punkten tief ins Kiefergewebe injizierte. Binnen Stunden würde es die Übertragung der Nervenimpulse blockieren und den Schmerz für Wochen ausschalten. Solange bis die Fraktur verheilt wäre.
Die schlechte Nachricht enthielt ein Bewusstsein veränderndes Mittel, welches kurzzeitig dafür sorgte, dass er kaum einen Fuß vor den anderen bekam.
14
Marten erkannte einen der beiden Männer, die ihn am Vortag am Rande des Kongresszentrums angesprochen hatten.
Breitschultrig baute sich dieser auf und erwartete ihn grinsend. Diesmal nicht in Zivil, dafür in Uniform eines Leutnants mit Namensschild über der linken Brusttasche.
D. Roth.
»Ich hatte angekündigt, dass wir uns unter anderen Umständen wiedersehen werden«, sagte er und aktivierte ein Aufnahmegerät auf dem Tisch.
Neben ihm stand ein farbiger Mann in einem maßgeschneiderten Anzug. Er schwieg, musterte Marten jedoch, seit man diesen auf einen Stuhl in der Mitte des Raumes gesetzt und sich die Sicherheitskräfte wieder entfernt hatten.
»Was haben Sie mit meiner Tochter gemacht?«
Martens Wut war keineswegs verflogen und auch das Mittel, das man ihm gespritzt hatte, vermochte seinen Geist nicht ausreichend zu trüben.
»Verhalten Sie sich kooperativer als gestern und wir können später vielleicht darüber reden. Aber nur, wenn Sie mich bei Laune halten«, antwortete Roth und zog ein Papier hervor. »Wir haben für Ihre Person eine Sicherheitsüberprüfung veranlasst. Zu dieser gehört auch eine Verschwiegenheitserklärung. Unterschreiben Sie!«
Er legte einen Kugelschreiber dazu.
»Los!«
Marten zeigte keine Regung, stattdessen platzte es aus ihm heraus: »WO IST ZOE, VERDAMMT NOCH MAL!?«
Sein Zustand glich nur schwer dem eines Betrunkenen. Er war zwar ebenso benebelt, doch sobald er einen Gedanken hatte und ihn nur einen Augenblick zu lange im Kopf formte, zerfiel er plötzlich. Er ließ sich einfach nicht festhalten und Marten bekam ihn nur Sekunden später nicht mehr zusammen. Die einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, war, dass er das, was er dachte, sofort über die Lippen brachte.
»Darüber reden wir erst, wenn Sie unterschrieben haben!«
Marten machte keine Anstalten, der Aufforderung zu folgen. Taumelig hielt er sich auf dem Stuhl und versuchte, das Thema Kommunikationspsychologie aus seinen Studientagen abzurufen, von dem er meinte, dass es dort auch um Verhörtechniken gegangen wäre. Vergeblich. In seinem Kopf herrschte ein völliges Durcheinander.
»Niemals, du arroganter Affe!«
»Falsche Antwort!« Der Leutnant packte ihn am Hemd und zog ihn nach oben. »Ich könnte Ihnen jeden Fingernagel einzeln rausreißen und es gäbe hier niemanden, der damit ein Problem hätte.«
»Lecken Sie mich!«
»Wirklich?«
Schlagartig ließ Roth Marten los, der zurück auf den Stuhl sackte. Mit blitzschnellen Handgriffen hatte er dafür dessen Mittelfinger gepackt und presste ihm die Spitze des Kugelschreibers ins Nagelbett.
»Das wollen wir doch mal sehen!«
Als der Leutnant wütend auf den Knopf am Ende des Stiftes drückte, bohrte sich die Mine tief unter den Nagel. Marten schrie auf.
Er versuchte, sich loszureißen. Aber Roth hielt ihn und erhöhte den Druck, bis Blut aus dem Finger floss.
»ES REICHT!«
Der Farbige, der bislang nur zugesehen hatte, ergriff die Initiative. Mit nur zwei Worten sorgte er zwar dafür, dass der Leutnant von Marten abließ, doch dessen Überzeugung vermochte er nicht zu begrenzen.
»Was glauben Sie, wie schnell der den Stift in die Hand nimmt, nachdem ich ein kurzes Vier-Augen-Gespräch mit ihm hatte«, antwortete Roth. »Ohne Mikro, ohne Zeugen. Nur er und ich.«
»Die Unterschrift ist überflüssig!« Der Ton des Farbigen blieb unverändert hart. »Er behält alles für sich, solange wir seine Tochter haben. Sehe ich das richtig?«
Marten nickte mit schmerzverzerrtem Gesicht. Langsam spürte er, wie die Wirkung des Mittels nachließ.
»Und danach?«, intervenierte Roth. »Was ist, wenn er später mal redselig wird? Dann wird man uns nach genau diesem Papier hier fragen. Und ich habe keine Lust, meinen Kopf dafür hinzuhalten.«
Selbstgefällig wedelte er mit der Verschwiegenheitserklärung.
»Leutnant, ich denke, dass Sie auf dem Flur etwas Wichtiges zu tun haben.«
»Das sehen Sie falsch«, antwortete er.
»Ehrlich?« Der Blick des Farbigen fror ein. »Sie verkennen hier gerade Ihre Befugnisse?! Ich wusste nicht, dass Sie im Rang eines Ministers stehen und wir uns auf Augenhöhe unterhalten. Gehen Sie den Dingen nach, die ein Leutnant auf der anderen Seite der Tür zu tun hat!«
»Hören Sie doch!«
»Wie deutlich denn noch? Verschwinden Sie!«
Eine Geste des Gesundheitsministers Richtung Tür ließ Roth verstummen.
Widerwillig schlug er die Hacken zusammen, verkniff sich das, was er auf der Zunge hatte, und ging.
»Wir haben erfahren, dass es eine Studie gibt, mit der Sie beim Luft- und Raumfahrtkongress für Unruhe gesorgt haben«, begann der Minister.
Ruhig schritt er im Raum auf und ab. »Wir müssen mehr darüber wissen. Also nicht hinsichtlich der Raumfahrtsache. Das ist uns verhältnismäßig egal. Sondern welche Auswirkungen eine jahrzehntelange Gefangenschaft auf die Überlebensfähigkeit von Individuen hat.«
»Lesen Sie die Studien von mir. Das hatte ich Ihren Leuten im Kongresszentrum auch schon gesagt.«
»Würde uns das reichen, säßen Sie nicht hier. Lassen Sie uns die Dinge beim Namen nennen: Wie verhält es sich, wenn achtzigtausend Menschen über vier Generationen in Gefangenschaft leben?«
Marten überraschte die konkrete Frage.
Wer schließt achtzigtausend ein ganzes Jahrhundert ein?
»Es ist unerheblich, wie viele Sie einsperren. Das Ergebnis ist das gleiche, egal ob tausend oder eine Million. Nach zwei Generationen geht es steil bergab. Nach vier Generationen können Sie einpacken.«
»Woher wissen Sie das? Sie haben doch keine Ahnung, in welchem gesundheitlichem Zustand unsere Personen sind. Was ist, wenn wir nur die mit den besten Voraussetzungen auswählen?«
»Die Gesundheit der Probanden zu Beginn der Inhaftierung ist fast unerheblich. Vertrauen Sie mir! Vor der Tätigkeit als Gutachter war ich elf Jahre als Psychologe verschiedener JVA und Einrichtungen für psychisch Erkrankte unterwegs. Die dort untergebrachten Härtefälle hatten keine Chance auf eine Entlassung, da ihre Sicherheitsverwahrung beziehungsweise Haftstrafe höher als die Lebenserwartung war. Mit den Akten dieser Menschen habe ich mich lange befasst und den Gesundheitszustand zum Zeitpunkt der Inhaftierung mit dem kurz vor dem Ende verglichen. Das Ergebnis war erschreckend. Trotz zum Teil bester Anfangsvoraussetzungen verschlechterte sich der körperliche und seelische Zustand dramatisch. Und ich versichere Ihnen, dass meine Beobachtungen weit über das hinausgehen, was man mit altersbedingter Morbidität begründen könnte. Übertragen Sie das auf mehrere Generationen und Ihre Population ist im Eimer.«
»Wie kommen Sie zu der Behauptung? Sie konnten doch noch nie eine Personengruppe untersuchen, die seit mehr als einer Generation in Gefangenschaft lebte?«
»Mithilfe zoologischer Daten«, antwortete Marten und war sicher, mit dem Satz seine Glaubwürdigkeit verspielt zu haben. Das passierte regelmäßig, wenn er sich auf Diskussionen mit Kritikern einließ und auf Studien verwies, die nicht auf menschlichen Probanden beruhten.
»Zoodaten also.«
Der Gesundheitsminister ließ den Psychologen keinen Moment aus den Augen.
»Na los, sagen Sie es schon! Sie halten das für Quatsch, oder?« Marten verlor die Lust, jemanden überzeugen zu wollen, der von diesen Dingen nur einen verschwindend geringen Teil verstand.
Ihr werdet erst wieder Informationen von mir bekommen, wenn ich Zoe gesehen hab!
»Wissen Sie was? Mir ist es egal, ob Sie meine Methode nachvollziehen können. Schließlich hab ich die Studie nicht für die Regierung gemacht. Es ist nur verwunderlich, dass sich seit der Veröffentlichung derart viele dafür interessieren. Dann muss an dem, was da drinsteht, ja einiges dran sein.«
Der Farbige brauchte keine weiteren Informationen.
»Sie bleiben sitzen. Es wird ein wenig dauern, aber es kommt jemand und wird ähnliche Fragen stellen. Kooperieren Sie! Mehr kann ich Ihnen nicht raten.«
Er machte sich auf, den Raum zu veranlassen.
»Wo ist Zoe?«, fragte Marten.
»Sie kennen jetzt die Spielregeln. Geben Sie uns erst etwas und dann sehen wir weiter.«
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.