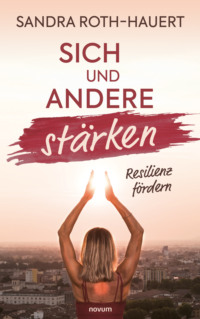Kitabı oku: «Sich und andere stärken», sayfa 3
Wer sich vertieft mit dem Thema Trauma auseinandersetzen möchte, findet in den Büchern von Peter A. Levine und Bessel Van der Kolk viele wertvolle Hinweise und Informationen dazu. Beide befassen sich seit Jahrzehnten intensiv mit der Thematik.
Suchtverhalten der Eltern
Kinder mit suchtbelasteten Eltern sind mehrfachen Risiken ausgesetzt. Suchtbelastete Personen sind in ihrem Leben mit vielfältigen Schwierigkeiten konfrontiert. Diese bleiben nicht ohne Auswirkung auf ihr Umfeld. „Mütterliche Alkoholabhängigkeit erweist sich – wohl aufgrund der engeren Mutter-Kind-Bindungen und der längeren Interaktionszeiten zwischen Müttern und Kindern – als risikoreicher als eine rein väterliche Abhängigkeit“ (Aichinger, 2011, S. 146). Schwierig wird es für die Kinder, wenn beide Eltern suchtbelastet sind. Kinder und Jugendliche mit alkoholabhängigen Eltern sind mehrfachen Belastungen ausgesetzt.
1 Sie erleben mehr Streit, konflikthafte Auseinandersetzungen und Disharmonie zwischen den Eltern.
2 Sie sind extremeren Stimmungsschwankungen und Unberechenbarkeiten im Elternverhalten ausgesetzt.
3 Sie geraten häufiger in Loyalitätskonflikte zwischen den Eltern.
4 Sie erfahren weniger Verlässlichkeit und Klarheit im familiären Ablauf. Versprechen, Ankündigungen oder Vorsätze werden häufig nicht eingehalten.
5 Vernachlässigung, sexueller Missbrauch und aggressive Misshandlungen kommen häufiger vor. (vgl. ebd.)Aichinger (2011) äußert sich zu Kindern von drogenabhängigen Eltern wie folgt: „Die Schädigung bei Kindern von drogenabhängigen Eltern sind in mehreren Bereichen gravierender als bei Kindern Alkoholabhängiger“ (S. 148). In der Schweiz kam Anfang 2020 der Film Platzspitzbaby in die Kinos. In diesem Film werden viele Aspekte aufgegriffen, welche zeigen, wie sich die Sucht einer Mutter auf die Mutter-Tochter-Beziehung auswirkt. Auch ist darin zu sehen, wie die Peers auf eine solche Situation reagieren.Biochemische und neurobiologische AspekteBiochemische Prozesse spielen bei jedem Lebewesen eine Rolle und haben Auswirkungen auf das Wohlbefinden. Damit diese wie vorgesehen ablaufen können, benötigt ein Mensch eine vitamin- und mineralstoffreiche Nahrung. Bei Mangelernährung, die unterschiedliche Ursachen haben kann, fehlen unter Umständen einzelne Stoffe. „Fehlt am Anfang der Produktionskette ein Vitamin, kann weiter hinten in der Herstellung auch nichts laufen, oder es müssen Umwege gemacht werden. Der Stoffwechsel verlangsamt sich und Ihre Leistungsfähigkeit fällt ab“ (Jopp, 2010, S. 16).Der Neurowissenschaftler Gerald Hüther hat sich den Risikofaktoren für die Gehirnentwicklung gewidmet. Er betont, dass bereits vorgeburtlich gemachte Erfahrungen sich im Hirn verankern und das Fundament für alle weiteren Lernerfahrungen bilden, da ein Mensch jede neue Erfahrung an etwas anknüpft, das bereits da ist. Je sicherer ein Mensch ist, desto größer ist seine Bereitschaft, etwas Neues auszuprobieren. Da der Mensch mit einem offenen, lernfähigen, durch eigene Erfahrungen formbaren Gehirn zur Welt kommt, können die Einflüsse aus dem Umfeld eines Heranwachsenden prägend wirken. Um die Hirnstrukturen ausformen zu können, brauchen bereits Neugeborene die lebendige Interaktion mit anderen Menschen. Immer dann, wenn zu einem späteren Zeitpunkt die gleichen neuronalen Netzwerke aktiviert werden, kommt es zu einem „Wiedererkennen“. Zudem wirken neue Erfahrungen bis auf die Ebene der Gene. Dies wiederum hat eine Wirkung auf die Gensequenzen, welche entweder abgeschrieben oder stillgelegt werden. Zu Beginn der Entwicklung wird die erfahrungsabhängige Neuroplastizität im Gehirn am stärksten geprägt. Dass die Lernfreude, Neugierde und Begeisterungsfähigkeit bei vielen Kindern bereits vor dem Schuleintritt verkümmert, hat mit den Bedingungen zu tun, unter denen eine Person aufgewachsen ist. Verunsicherungen, Angst und Druck lösen im Gehirn Unruhe aus. Diese Unruhe kann so groß werden, dass daraus ein Durcheinander entsteht, sodass auch bereits Gelerntes nicht mehr erinnert werden kann. Menschen fallen dann auf alte, festgefahrene Denkweisen (Angriff, Verteidigung, Rückzug) zurück (vgl. Hüther, 2008, S. 45 ff.).Zu biologischen Risikofaktoren gibt es bisher wenige Studien. In diesen wurden Zusammenhänge zwischen einem emotional-modulierten Schreckreflex und der Lateralisierung frontaler kortikaler Hirnaktivierung aufgezeigt. Diese lassen bereits im Alter von zehn Monaten die kindliche Reaktion auf eine vorübergehende, kurze Trennung von der Mutter vorhersagen. Des Weiteren wurde eine Studie durchgeführt, welche sich auf das Erforschen des serotonergenen Systems konzentrierte. Dabei wurde beobachtet, dass Menschen mit einer oder zwei Kopien des kurzen Allels des Serotonin-Transporter-Gens (5-HTT) mehr depressive Symptome in Abhängigkeit von belastenden Lebensereignissen zeigten als jene Menschen mit dem langen Allel desselben Gens. Eine weitere Untersuchung zeigte, dass sich delinquente Jugendliche von unauffälligen jungen Erwachsenen dadurch unterschieden, dass sie im Alter von 15 Jahren einen höheren Ruhepuls sowie eine erhöhte Hautleitfähigkeit aufwiesen. Auf diese Weise wurden vereinzelt Risikofaktoren oder protektive Faktoren im Bereich der biologischen und physiologischen Entwicklung ermittelt (vgl. Holtmann & Laucht, 2008, S. 32 ff.).Tabu-ThemenGesellschaftlich bedingt gibt es unterschiedliche Tabuthemen wie beispielsweise Scham oder Aggression. Familien, die Tabuthemen oder Familiengeheimnisse aufrechterhalten, können unter Umständen die Entwicklung der Kinder hemmen. „Zwischenmenschliche Beziehungen und die Entwicklung von Resilienz werden nicht durch den Schutz der Privatsphäre behindert, sondern vielmehr durch Heimlichtuereien“ (Imber-Black, 2012, S. 100). Wenn nicht in Frage gestellt werden darf oder gewisse Themen nicht aus- und angesprochen werden dürfen, kann dies unter Umständen für die Kinder zur Belastung werden.In Suchtfamilien wird mit Kindern meist nicht über die Sucht und die damit verbundenen Erfahrungen geredet, sie wird verharmlost, verdrängt oder tabuisiert. Diese massive Verleugnung dient der Abwehr der Familie, ist oft der einzig gangbare Weg, um trotz zahlloser Enttäuschungen, Verletzungen, Ängste und Schuldgefühlen weiter leben zu können. Daher ist es für Kinder, vor allem für Kinder unter zehn Jahren, äußerst schwer, über ihre Erlebnisse zu reden, ohne das Tabu der Familie zu brechen.(Aichinger, 2011, S. 152)In jeder Familie gibt es vermutlich Tabus. Manchmal sind diese nicht bewusst, die Kinder spüren jedoch, dass da Themen sind, über die nicht gesprochen werden darf. Es kann sein, dass diese die Entwicklung eines Kindes nicht beeinträchtigen. Manchmal ist es für die Kinder hilfreich, wenn sie außerhalb der Familie unbelastet sind von diesen Themen. So können sie sich unbeschwert erleben und werden nicht mit Mitleid konfrontiert. Mitleid wird oftmals als Belastung erlebt.SchamScham könnte unter die Tabu-Themen eingeordnet werden, da dieses Gefühl gesellschaftlich gesehen tabuisiert wird. Es ist jedoch ein so großes Themengebiet, dass es sich lohnt, darüber zu schreiben und nachzudenken. Beschämungen und Bloßstellungen erleben viele Menschen im Alltag, und erfahren dabei, wie zerstörerisch diese wirken können.Wir leben in einer Welt, in der die meisten Menschen immer noch der Meinung sind, dass Scham ein gutes Instrument sei, um jemanden ‚zur Ordnung zu rufen‘. Das ist nicht nur falsch, es ist auch gefährlich. Scham korreliert sehr stark mit Sucht, Gewalt, Aggression, Depression, Essstörungen und schikanösem Verhalten gegenüber Schwächeren.(Brown, 2013, S. 93)Scham ist so facettenreich und manchmal auch nicht eindeutig zu erkennen. Viele Menschen sind sich auch nicht bewusst, dass sie durch ihre Aussagen oder ihr Handeln andere beschämen oder beschämt haben. Selten wird es wohl auch Beschämte geben, welche diesen Umstand aus- und ansprechen. Viel eher ist es so, dass sich die beschämten Personen zurückziehen und darüber schweigen. Manchmal tun sie dies auch, weil sie die Schuld bei sich suchen. Leider beeinträchtigt dies auch die Beziehungen zu anderen Menschen. Der französische Psychotherapeut Boris Cyrulnik schreibt dazu: „Man passt sich an die Scham an – indem man ausweichende Verhaltensweisen annimmt, sich vergräbt oder sich zurückzieht. All das beeinträchtigt die Beziehungen“ (Cyrulnik, 2011, S. 30). Mit ein Grund für das Schweigen ist auch die Reaktion der anderen, die befürchtet wird. Diese können die Einsamkeit eines Menschen vertiefen, weil er sich weder gehört noch ernst genommen fühlt. Das ist der Grund, aus dem es für Opfer oftmals so schwierig ist, über das Erlebte zu sprechen. Die Reaktionen, die bei den Zuhörenden ausgelöst werden, können nicht vorausgesehen werden. Stephan Marks unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Scham. Er nennt die Anpassungsscham, welche nach außen gerichtet ist. Sie wird ausgelöst, wenn ein Mensch die Normen und Erwartungen der Gruppe oder der Gesellschaft nicht erfüllt. Darunter fällt auch die Körperscham, weil ein Körper nicht dem ‚Ideal‘ der Gesellschaft entspricht. Ein Mensch kann diese Scham sich selbst gegenüber empfinden oder durch Bemerkungen von außen beschämt werden. Zudem gibt es Menschen mit erblichen Krankheiten, welche sichtbare Auswirkungen auf den Körper haben. Die Betroffenen und ihre Familien leiden oftmals schon sehr darunter und werden in der Öffentlichkeit regelmäßig mit abschätzigen Bemerkungen konfrontiert, anders ausgedrückt beschämt. Zudem ist die Anpassungsscham kulturbedingt. Eine weitere Form von Scham ist die Gruppen-Scham. Diese Form von Scham kann einzelne Personen, Gruppen, Familienangehörige oder eine Nation betreffen. „Als Gruppen-Scham bezeichne ich die Schamgefühle in Bezug auf andere Personen, die von den herrschenden Normen, Werten oder Verhaltensweisen abweichen: Man schämt sich ‚für‘ sie“ (Marks, 2011, S. 25). Des Weiteren gibt es die empathische Scham. Diese wird dann empfunden, wenn ein Mitmensch beschämt wird und die Zeugen mitfühlen. Diese Art von Scham kommt unter anderem auch in Schulklassen vor. Die Intimitäts-Scham ist eine Art von Scham, welche die schützende Funktion von Scham anspricht. Sie spricht die Grenze der Privatsphäre eines Menschen an. Sie hat demnach auch zwei Ausrichtungen. Einerseits schützen wir Teile unserer Persönlichkeit und andererseits wägen wir stets ab, wie weit wir uns zeigen wollen. Dies hängt von unterschiedlichen Faktoren ab und wird uns meist erst dann bewusst, wenn eine Grenze verletzt wurde. „Intensive oder wiederholte Verletzungen der Intimitäts-Grenzen können zu pathologischer und im Extrem zu traumatischer Scham führen“ (Marks, 2011, S. 30). Eine weitere Form von Scham ist die Gewissensscham. Diese ist dazu da, die Integrität eines Menschen zu schützen, und sie verursacht Schuldgefühle, wenn wir nicht in Übereinstimmung mit unserem Gewissen gehandelt haben.Schutzfaktoren in der Entwicklung von KindernSchutzfaktoren wirken stärkend auf einen Menschen, der einer belastenden Situation ausgesetzt ist. Sie können vorhandene Risikofaktoren abschwächen. Schutzfaktoren haben bei Menschen ohne Belastungen oftmals keine Wirkung.Zu den Schutzfaktoren für Resilienz gehören:positive Lebensmodelle (Vorbilder),Entwicklung von guten Beziehungen zu Vertrauenspersonen,Entwicklung von Eigenverantwortlichkeit,Beziehungen, die auf Gegenseitigkeit angelegt sind,Glaube an die eigene Kraft, der es ermöglicht, Schwierigkeiten anzupacken, Überwindung der Tendenz, sich als Opfer zu fühlen,Entwurf realistischer Ziele im Rahmen einer Langzeitperspektive, gut für sich selber sorgen,mit Mut auf belastende Lebensereignisse zu reagieren.(Welter-Enderlin, 2010, S. 20)
Für Kinder ist es wichtig, dass sie viele Erfahrungen sammeln können, in denen sie sich selbstwirksam erleben. „Multiple schützende Bedingungen – also multiple Ressourcen – können die Chance für eine gute Anpassung trotz schwieriger Lebensbedingungen erheblich verbessern (sie summieren oder verstärken sich dann gegenseitig)“ (Wustmann Seiler, 2015, S. 47). Nachfolgend werden einige Schutzfaktoren näher beschrieben: 1) Sichere, wertschätzende Beziehungen, 2) Autonomie, 3) Interessen/Hobbys, 4) Humor, 5) Freundschaften, 6) Erziehungsstil, 7) Trennung der Eltern, 8) Biochemische Aspekte. Diese Auswahl erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Sichere, wertschätzende Beziehungen
Bindungssicherheit wird in der Resilienzforschung als Schutzfaktor betrachtet. „Mit Bindungssicherheit geht eine größere Kompetenz im Umgang mit emotionaler Belastung, d. h. einer effektiven Emotionsregulation, einher; ein sicheres Bindungsverhalten stellt insofern eine gute Voraussetzung dar, um Belastungen erfolgreich bewältigen zu können“ (Wustmann Seiler, 2015, S. 99). In der Kauai-Längsschnittstudie wurden die resilienten Kinder ebenfalls hinsichtlich ihrer Beziehungen zu anderen betrachtet.
The resilient children also found emotional support outside of their own families. They tended to have at least one and usually several close friends, especially girls.
(Werner & Smith, 2001, S. 58)
Die resilienten Kinder fanden auch emotionale Unterstützung ausserhalb ihrer eigenen Familie. Sie neigten dazu, mindestens einen, gewöhnlich sogar mehrere enge Freunde, vor allem Mädchen, zu haben.
(übersetzt von François Cueff)
Indem sich diese Kinder Hilfe holen konnten und diese Unterstützung erhielten, erlebten sie sich selbstwirksam. Brisch (2008) äußert sich wie folgt: „Sicher gebundene Kinder reagieren mit einer größeren psychischen Widerstandskraft (‚resilience‘) auf emotionale Belastungen, wie etwa eine Scheidung der Eltern“ (S. 140).
Warmes-wertschätzendes, ferner stimulierendes sowie wenig dirigierendes Verhalten von 90 Müttern gegenüber ihren Kindern in Verkehrsmitteln, Wartezimmern von Ärzten und Restaurants – durch Beobachter mitprotokolliert – hing zusammen mit größerer Spontaneität und Selbstständigkeit ihrer Kinder sowie mit harmonischer-gelöster-entspannter Beziehung zwischen Mutter und Kind.
(Tausch & Tausch, 1979, S. 150)
Laut Bowlby sind Menschen auf der biopsychischen Ebene daran interessiert, emotionale Bindungen einzugehen und aufrechtzuerhalten, weil ihr Überleben untrennbar damit verbunden ist. Nachfolgende Grundannahmen liegen der Bindungstheorie nach Bowlby zugrunde:
1 Enge emotionale Bindungen zwischen Individuen haben einen primären Status und eine biologische Funktion;
2 die Art, wie mit einem Kind umgegangen wird, ist von erheblichem Einfluss auf seine Entwicklung und auf das spätere Funktionieren seiner Persönlichkeit;
3 Bindungsverhalten muss als Teil eines Organisationssystems gesehen werden, das sich ein ‚inneres Arbeitsmodell‘ des Selbst und der andren zunutze macht, an dem sich Erwartungen und Verhaltensplanungen ausrichten können;
4 Bindungsverhalten ist grundsätzlich verhaltensresistent, es gibt aber ein immer vorhandenes Veränderungspotenzial, so dass es lebenslang sowohl schädlichen wie günstigen Einflüssen zugänglich bleibt.(Steele, 2009, S. 336)
Da die Prägung des Bindungsverhaltens grundlegend wichtig ist und sich auf späteres Verhalten auswirkt, sind die Pflege und Betreuung von Säuglingen relevant. Es wurde nachgewiesen, dass die Hirnstrukturen von Kindern, die Fürsorglichkeit und Geborgenheit erfahren haben, anders aussehen als jene von misshandelten Kindern (vgl. Steele, 2009). Karl Heinz Brisch schreibt, dass eine sichere Bindungsentwicklung für psychischen Schutz bei auftretenden Widrigkeiten im Leben sorge. Bindungspathologisch geschädigten Kindern kann durch das Vermitteln von viel Sicherheit und Ressourcen ein emotionaler Heilungsprozess angestoßen werden, sodass diese auf neue, emotional sichere Bindungserfahrungen zurückgreifen können (vgl. Brisch, 2009). Kinder spüren, unabhängig davon, was sie erlebt haben, welche Personen Sicherheit und Verlässlichkeit auf der Beziehungsebene geben. Dies können nebst Mutter und Vater auch NachbarInnen, Lehrpersonen, Verwandte oder FreundInnen der Eltern sein.
Diese positiven Erfahrungen im Bereich der Beziehung zu anderen Menschen können sich zu einem späteren Zeitpunkt als Schutzfaktor erweisen.
Autonomie
Das Autonomiebedürfnis ist eines der psychologischen Grundbedürfnisse. Viele Kinder wollen die Welt, die sich mit jedem Lebensalter erweitert, entdecken. Sie sind neugierig und wollen lernen. Bei ihren Erkundigungen stoßen sie an Grenzen und lernen mittels geeigneter Unterstützung auftretende Schwierigkeiten zu bewältigen. Frick (2011, S. 209) schreibt: „Die erfolgreiche Bewältigung von Schwierigkeiten und Krisen kann übrigens sogar die Entwicklung zusätzlich fördern (Erwerb von Handlungskompetenzen und Coping-Strategien, die auch für spätere Problem- und Stresssituationen nützlich sein können).“ Erwachsene, die dieses Streben achtsam begleiten und dafür sorgen, dass eine dem Kind angepasste Ausgewogenheit zwischen Entdeckerfreude und Schutz gewährleistet ist, ermöglichen Heranwachsenden Erfahrungen, welche ihre Autonomie fördern (vgl. Frick, 2011, S. 159). Die jungen Menschen erleben sich selbstwirksam und lernen sich selbst und ihre Möglichkeiten realistisch einzuschätzen. Bei jedem Menschen ist dieses Bedürfnis nach Autonomie unterschiedlich. Deshalb ist es wichtig, dass die Bezugspersonen individuell auf dieses Bedürfnis eingehen. Autonomie hängt auch mit Selbstbestimmung zusammen. Menschen wollen gerne selbst bestimmen, was sie zu tun gedenken oder lieber bleiben lassen. „Um dieses Bedürfnis befriedigen zu können, müssen Menschen sich selbst als Urheber/innen ihres eigenen Verhaltens wahrnehmen“ (Martinek, 2014, S. 7).
Interessen/Hobbys
Menschen, welche eigenen Interessen und Hobbys nachgehen, eignen sich erweiterte Fähigkeiten und Fertigkeiten auf einem Gebiet an. Die Heranwachsenden erfahren, dass sie in diesem Bereich Fortschritte machen und erleben sich selbstwirksam. Oftmals werden Hobbys innerhalb von Interessensgruppen ausgeübt. So kommen die Kinder miteinander in einen Austausch, teilen Freude und manchmal auch Frustration, beispielsweise wenn die eigene Mannschaft einen Wettkampf verliert oder ihr gestecktes Ziel nicht erreicht.
Freizeitbeschäftigungen bedeuten eine Abwechslung oder gar eine Gegenwelt zum belastenden Alltag und verhelfen unter günstigen Umständen zu einer Selbstwertstabilisierung. Besonders wenn sie mit FreundInnen geteilt werden können, können sie Trost, Abwechslung, Freude, Ablenkung oder Bestätigung vermitteln.
(Frick, 2011, S. 208)
Nachfolgend werden drei Interessensgebiete und deren mögliche Wirkung als Schutzfaktoren beschrieben. Manche Menschen wenden sich der Musik zu. Auf diese kann in unterschiedlicher Weise zurückgegriffen werden, einerseits durch Hören, andererseits durch das aktive Musizieren. Bereits ab der 28. Schwangerschaftswoche ist es dem Fötus möglich, Gehörtes zu verarbeiten, sei es die Stimme der Mutter, des Vaters oder Musik, welche die Mutter hört. Zusammen mit dem Gehörten werden auch die emotionale Stimmung und die Bewegungen zur Musik wahrgenommen. Null- bis Sechsjährige mögen es, Klangquellen sehend und hörend zu erkunden und zu fühlen. Zudem hat Musik (auch das Summen) Auswirkungen auf den Atem und den Herzrhythmus (vgl. Wybronik, 2016).
Junge Menschen spielen gern. Dabei erkunden sie die Welt und sammeln Erfahrungen. Das Spielen unterstützt die Entwicklung und regt die Kreativität an. Im Spiel erleben sich Menschen mit allen Sinnen und eignen sich ‚nebenher‘ diverse Fertigkeiten an. Manche Personen können sich diese Spielfreude bis ins hohe Lebensalter erhalten.
Viele Menschen brauchen Bewegung, um sich wohlzufühlen. Welche Art der Bewegung ein Mensch für sich wählt, hängt von seinen Vorlieben ab. Im Vorschulalter mögen es die Allermeisten, sich frei zu bewegen und ihre Umgebung auf diese Weise zu erkunden, sei es dass sie auf Bäume klettern, über Mauern balancieren, einen Bach durchwaten, Ski fahren lernen, schwimmen, Fahrrad fahren, Stelzen laufen oder akrobatische Übungen ausprobieren. Diese Bewegungserfahrungen sind im Körper gespeichert und können wieder abgerufen werden. Zudem erleben sich Menschen selbstwirksam, wenn sie eine neue Bewegungsqualität erfahren und erlernen.
Humor
Kinder lachen häufig. Ihr Lachen wirkt umso freier und unbeschwerter, je jünger sie sind. Humor, der nicht auf Kosten anderer geht, hilft Menschen, mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen. Dazu meint Frick (2011): „Mit Humor können schwierige Situationen emotional besser reguliert werden, etwa durch Ablenkung und Distanzierung. Humor ermöglicht zudem einen Perspektivenwechsel“ (S. 208).
Es gibt Humortraining oder Lach-Yoga. Dort werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie das Lachen und der Humor im Alltag vermehrt gelebt werden können.
Freundschaften
Soziale Einbindung ist eines der drei psychologischen Grundbedürfnisse. Wird sie ausreichend erfüllt, so wirkt sie als Schutzfaktor. Für alle Menschen sind soziale Kontakte zu anderen von Bedeutung. Freundschaften zu Gleichaltrigen sind für die Heranwachsenden wichtig. Sie lernen sich sozial-emotional zu verhalten und erleben Gemeinschaft.
Freundschaften verstärken sich durch ähnliche Vorlieben und Abneigungen und vertiefen sich dann besonders im Schulalter. Damit werden Freundschaften stabiler, Freunde weniger austauschbar und unverwechselbarer. Freundschaft bedeutet nun eine reziproke Beziehung, das heißt Freunde gehen gegenseitig auf ihre Bedürfnisse ein, sie unterstützen, trösten und helfen einander bei der Lösung von Problemen.
(Frick, 2011, S. 142)
Des Weiteren wirken auch freundschaftliche Beziehungen zu Erwachsenen, beispielsweise Großeltern, Nachbarn oder Tanten und Onkel, unterstützend, insbesondere dann, wenn die jungen Menschen sich dort Hilfe zu holen trauen. Werner (2008) schreibt: „Die Jungen und die Mädchen, die in ihrer Kindheit auf umfangreiche emotionale Unterstützungsangebote zurückgreifen konnten, erlebten weniger Stress im weiteren Lebenslauf als andere, die weniger emotionale Unterstützung erlebt hatten“ (S. 321).
Erziehungsstil
Wustmann Seiler (2015) weist darauf hin, dass die Förderung eines autoritativen Erziehungsstils, einer konstruktiven Kommunikation, eines positiven Modellverhaltens, effektiver Erziehungstechniken, des elterlichen Kompetenzgefühls und der elterlichen Konfliktlösestrategien einen positiven Effekt auf die Beziehung zum Kind nach sich zieht (S. 137). Der autoritative Erziehungsstil ist einerseits geprägt durch demokratisches Verhalten und andererseits durch das Festlegen von Grenzen, welche der Entwicklung des Kindes angepasst sind. Tausch und Tausch (1979) schreiben zu den Auswirkungen von Achtung-Wärme-Rücksichtnahme: „Achtung–Wärme fördert bei gleichzeitiger Echtheit und fördernden nicht-dirigierenden Einzeltätigkeiten die seelische Funktionsfähigkeit, die seelische Gesundheit und den gefühlsmäßigen Erlebnisreichtum des anderen“ (S. 146).
Frank (2008) orientiert sich an den Grundannahmen von Tausch und Tausch (1979), wenn sie über die Bedeutung der emotionalen Beziehung zwischen Lehrpersonen und Lernenden schreibt:
Demnach sind vor allem vier Elemente der emotionalen Beziehung zwischen Lehrer und Schüler von Bedeutung:
Achtung, Wärme, Rücksichtnahme
Vollständiges empathisches Verstehen
Echtheit, Übereinstimmung, Aufrichtigkeit
Förderliche, nicht-dirigierende Einzelaktivitäten
Diese bilden zusammen die Grundlage für personenzentrierte Unterrichtung und Erziehung. In diesen Elementen wird ein Zusammenhang zum Vertrauenskonzept ersichtlich.
(Frank, 2008, S. 77)
Die oben genannten vier Elemente können auf die Beziehung zwischen Eltern und Kindern übertragen werden.
Ein solcher Umgang ermöglicht es den Kindern sich weiterzuentwickeln und in ein selbstbestimmtes, selbstorganisiertes Handeln zu kommen. In einer solchen Atmosphäre gelingt es den Kindern eher mit Frustration umgehen zu können. Zudem wird die Beziehungsfähigkeit gestärkt. Dies ist besonders für Kinder wichtig, die Entwicklungsrisiken ausgesetzt sind oder waren. „Selbstvertrauen, Autonomie und Kompetenz entwickeln sich in einem Zusammenspiel von kindlicher Aktivität mit der unterstützenden Kommunikation durch fürsorgliche Erwachsene“ (Opp, 2008a, S. 234).
Familiärer Zusammenhalt
„Neben dem positiven Erziehungsklima erwiesen sich in den meisten Untersuchungen zu Resilienz familiale Stabilität und familiärer Zusammenhalt (Kohäsion) als wesentliche Schutzfaktoren“ (Wustmann Seiler, 2015, S. 110). Kinder, die über Jahre hinweg in einem angespannten oder konfliktreichen familiären Umfeld leben, können es als erlösend erleben, wenn sich Eltern trennen (vgl. Wustmann Seiler, 2015, S. 49). Zwar vermissen sie den anderen Elternteil, aber der entspanntere Alltag kann sich für sie als segensreich und entwicklungsfördernd erweisen, sofern die beiden Elternteile eine wertschätzende Beziehung gegenüber den Kindern pflegen. Bei einigen Eltern, die sich geschieden haben, kommen neue Partner dazu. Es kann sein, dass die neuen Partner des Vaters und der Mutter für ein Kind zu wichtigen Bezugspersonen werden. Hier geht es um das psychologische Grundbedürfnis nach sozialer Einbindung. Wird dieses innerhalb einer Familie erfüllt, auch bei Trennung von Mutter und Vater, so wird die Familie als Ort erlebt, der Geborgenheit und Sicherheit vermittelt.
Biochemische und neurobiologische Aspekte
Es gibt gewisse Genotypen, welche die Entwicklung von Resilienz bei Jungen, welche Risikobedingungen ausgesetzt waren, begünstigen (vgl. Holtmann und Laucht, 2008, S. 34 ff.). „Die höhere MAOA-Aktivität kann somit nach Überzeugung der Autoren als biologisches Korrelat von Resilienz gegen spätere psychische Folgen von Misshandlung im Kindesalter gelten“ (Holtmann & Laucht, 2008, S. 37). Mit MAOA ist das Enzym Monoaminooxidase A gemeint.
Die Aufnahme von vitamin- und nährstoffreicher Nahrung ist hilfreich für ein aktives Leben und Ausgeglichenheit. Jopp (2010) schreibt: „Es gibt viele gute Beispiele für die Wirkungsweise der B-Vitamine im Nervensystem. Vitamin B1 zum Beispiel ist an der Weiterleitung von Nervenimpulsen im Gehirn beteiligt“ (S. 77). Eine ausreichende Versorgung mit Nährstoffen wirkt schützend auf den Organismus.
Mit der Entdeckung der Spiegelneuronen gewannen die Neurobiologen neue Erkenntnisse. Die Frage nach Resonanz stand im Raum. „Die neurobiologische Resonanz, die wir in der Gegenwart anderer, von uns wahrgenommener Menschen erleben, beschränkt sich nicht auf die motorische und sensible Dimension. Spiegelungsvorgänge beziehen auch Wahrnehmungen unserer inneren Organe und das emotionale Befinden mit ein“ (Bauer, 2016, S. 49). Begibt sich ein Mensch in ein gesundes und mitfühlendes Umfeld, so wirkt dies stärkend auf seinen Organismus.
Wechselwirkungen
Da jeder Mensch einzigartig ist, gibt es keine allgemeingültige Regel, welches Maß an Risiko- und Schutzfaktoren für einen Menschen entwicklungsfördernd oder -hemmend sein könnte. Hinzu kommt das Betrachten einer Langzeitperspektive.
Je nachdem, welche personenbezogenen Faktoren ein Mensch mit sich bringt, können Schutzfaktoren zu Risikofaktoren werden. Das gesamte Resilienzthema braucht eine umsichtige Herangehensweise und hängt von vielen Feinheiten ab. Deshalb ist beim Prognostizieren der die Entwicklung begünstigenden Maßnahmen Vorsicht geboten. Die Wechselwirkungen zwischen den Risiko- und Schutzfaktoren sind hochkomplex, weil die unterschiedlichen Ebenen und die Lebensphase mit hineinwirken. „Die Komplexität der angenommenen Wechselwirkungen erhöht sich noch, weil solche Interdependenzen nicht nur zwischen Risiko- und Schutzfaktoren vermutet werden, sondern auch zwischen den auf den verschiedenen Ebenen (Kind, Familie, soziales Umfeld) angesiedelten Faktoren“ (Zander M., 2010, S. 42f). Hinzu kommt, dass jeder Mensch ein Individuum ist und sich somit alle Bereiche individuell gestalten, auch die Wechselwirkungen.
Wustmann Seiler (2015, S. 56ff) erläutert vier Resilienzmodelle, welche die Wechselwirkungen zwischen Risiko- und Schutzfaktoren beschreiben:
1 Modell der Kompensation: Das Ausmaß des risikoerhöhenden Faktors wird durch den risikomildernden Faktor kompensiert.
2 Modell der Herausforderung: Bei diesem Modell stellen die Risikobedingungen eine Herausforderung für das Kind dar. Kann es diese bewältigen, gewinnt es an Kompetenz.
3 Modell der Interaktion: Der risikomildernde Faktor wirkt dann, wenn ein risikoerhöhender Faktor vorhanden ist. Ansonsten zeigt er keine Wirkung.
4 Modell der Kumulation: Mehrere risikoerhöhende Faktoren bzw. risikomildernde Faktoren können sich kumulieren (vgl. ebd.).
Innerhalb des Modells der Kompensation wird zwischen zwei verschiedenen Formen unterschieden. Das Haupteffekt-Modell besagt, dass die risikomildernden und die risikoerhöhenden Faktoren direkt auf das Entwicklungsergebnis des Kindes einwirken. Werden Situationen mit diesem Modell betrachtet, so hat dies zur Folge, dass die Schutzfaktoren erhöht werden. Es werden die Kompetenzen des Menschen gefördert. Demgegenüber steht das Mediatoren-Modell, welches das Elternverhalten dazwischenschaltet. Dies bedeutet, dass die Risiko- und Schutzfaktoren indirekt auf ein Kind einwirken, da die Eltern als Mediatoren wirken. Hier werden die Eltern unterstützt und weitergebildet, damit sie in ihren Erziehungskompetenzen gestärkt werden.
Beim Modell der Herausforderung werden zu bewältigende Lebenssituationen als Chance zur Weiterentwicklung betrachtet. Bereits bewältigte kritische Lebensereignisse unterstützen einen Menschen dabei, neu eintretende kritische Lebensereignisse zu bewältigen und dabei an Kompetenzen zu gewinnen.
Im Modell der Interaktion wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und Schutzfaktoren in Interaktion sind. Risikomildernde Faktoren haben keinen Effekt, wenn keine Risikofaktoren vorhanden sind. Präventions- und Interventionsprogramme werden hier für Menschen erstellt, welche einer Risikogruppe angehören.