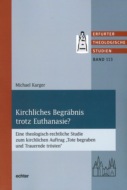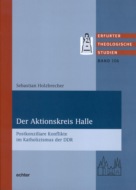Kitabı oku: «Der Aktionskreis Halle», sayfa 2
EINLEITUNG
Seit 1945 schwebte die Kernfrage – Ist Kirche und Christsein unter dem Kommunismus möglich und wenn ja, wie? – als Damoklesschwert über dem ostdeutschen Katholizismus. Nach einer anfänglich eher skeptischen Haltung, die sich an der Person Kardinal Preysings3 festmachen lässt, wurde diese Frage zunächst durch bischöfliche Metaphern zu beantworten gesucht. Dabei verglich man die Lage der katholischen Kirche in der DDR mit einer „Gärtnerei im Norden“, einem „fremden Haus“ und der Situation von „Daniel in der Löwengrube“, der den Löwen weder streicheln noch am Schwanz ziehen solle.4 Die weltanschauliche Distanz und eine gewisse Resistenz gegenüber der totalitären Diktatur der SED stellte bis 1989 ein zentrales Moment in der Identität katholischer Christen in der DDR dar. Dies führte zum Modus einer politisch abstinenten Kirche, zu der eine denkwürdige Sprachregelung gehörte: Kirchlicherseits vermied man es stets von der „Katholischen Kirche der DDR“ zu sprechen, weil man darin staatstragendes Potential erblickte. Die bleibende Distanz zur SED-Diktatur sollte durch eine Präposition kenntlich gemacht werden: „Katholische Kirche in der DDR“. Mit dieser Distanz zum Staat war jedoch zugleich eine Passivität gegenüber der ideologisch geformten, überwachten und seit 1961 eingemauerten Gesellschaft verbunden.5 Im Laufe der 40jährigen sozialistischen „Wüstenzeit“ der Kirche änderte sich jedoch das Verständnis dafür, welches Verhältnis die Kirche und die Christen gegenüber den hier lebenden Menschen einnehmen sollten. Zu diesem Prozess der kirchlichen Positionsbestimmung traten ab 1965 Aussagen und Anspruch des Zweiten Vatikanischen Konzils. Wie sollte die kleine Zahl von Katholiken in der DDR den geforderten Dialog mit der Welt, in diesem besonderen Fall auch einer atheistischen Einparteiendiktatur führen, wenn das Ziel staatlicher Kirchenpolitik die gesellschaftliche Zurückdrängung und Zersetzung der Kirchen war? Wie sollte die Brüderlichkeit des Gottesvolkes gelebt werden, wenn staatliche Organe und geheimpolizeiliche Spitzel nach Einfallstoren in die kirchliche Phalanx suchten? Wie sollte die missionarische Sendung der Kirche und des Einzelnen gestärkt werden, wenn das christliche Engagement durch die Staatsideologie manipuliert, vereinnahmt und missbraucht wurde?
Die innerkirchliche Beantwortung dieser und weitere Fragen führte seit Mitte der 1960er Jahre zu nicht unerheblichen Kontroversen auf verschiedenen Ebenen des kirchlichen Lebens. Vielen schritt die Umsetzung des Konzils nicht schnell genug voran, während anderen die anvisierten „Reformen“ zu weit gingen und eine Schwächung gegenüber der Diktatur zu bedeuten schienen. In dieser angespannten Situation gründete sich 1970 der Aktionskreis Halle, jene Gruppe aus Priestern und Laien, die vielen in der DDR als „Nestbeschmutzer“, den meisten als „entfant terrible“ des ostdeutschen Katholizismus galt und bis heute noch in bestimmten Kreisen gilt.
Die kirchengeschichtliche Arbeit ist darauf angelegt, historische, politische und theologische Dimensionen des Themas zu einer Synthese zusammenzuführen. Der Aktionskreis Halle hat sich in die konkrete geschichtliche Situation der DDR hineinbegeben und dabei dieses Land und seine Menschen als Ort und Ziel der kirchlichen Sendung realisiert und postuliert. Erscheint es nicht gerechtfertigt, aufgrund des Einsatzes all jener, die die DDR als ihre Heimat verstanden und hier Kirche für die Menschen sein wollten, von einem „Katholizismus der DDR“ zu sprechen? Eine solche Perspektive würde auch dafür sensibilisieren, dass sich die Kirche von ihrem Stiftungswillen und Auftrag distanziert, wenn sie sich aufgrund äußerer Einflüsse und Unwägbarkeiten von ihrem missionarischen Einsatz für das Evangelium dispensiert.
1.Forschungsgegenstand
Die zeitgeschichtliche Katholizismusforschung fokussierte in der ersten Dekade nach dem Fall der innerdeutschen Mauer 1989 auf den Ausgleich eines veritablen Informationsdefizites hinsichtlich der katholischen Kirche in der DDR.6 Es galt, die kirchlichen Strukturen und Entwicklungen seit 1945 anhand von Quellen zu erforschen und darzustellen.7 Themenschwerpunkte waren dabei unter anderem das Schicksal von Millionen katholischer Flüchtlinge und Vertriebenen, Biografien der ostdeutschen Bischöfe und bischöflich beauftragten Priester in den Bistümern und Jurisdiktionsgebieten in der SBZ/DDR sowie die Entstehung und das Wirken kirchlicher Institutionen am Beispiel der bischöflichen Caritas und der ostdeutschen Priesterausbildung in Erfurt. Mit der Erforschung des Aktionskreises Halle, für den sich allgemein die Kurzbezeichnung AKH durchgesetzt hat, drücken sich ein neues Forschungsmotiv und eine veränderte Forschungsperspektive aus. Der bisherige Fokus verschiebt sich dabei von den Strukturen und Personen der Institution Kirche zugunsten einer stärkeren Wahrnehmung des kirchlichen Lebens auf der Ebene der Gemeinden und Vereinigungen. Damit wird eine Zwischenebene in den Blick genommen, die einen Beitrag zu leisten vermag für eine zukünftig noch zu verfassende Sozialgeschichte der Kirche in der DDR.
Die Darstellung der Geschichte und Entwicklung des Aktionskreises Halle von 1969 bis 1989 ist zuerst im Kontext der Magdeburger Regional- und Bistumsgeschichte anzusiedeln.8 Wie es zur Gründung einer kirchlichen Gruppierung Ende der sechziger Jahre im Kommissariat Magdeburg, dem Ostteil des Erzbistums Paderborn, kam, was ihre pastoralen Ziele und theologischen Intentionen waren und wie sie sich im kirchenpolitischen Spannungsfeld zwischen SED-Staat und katholischer Kirche bewährte, sind entscheidende Eckpunkte bei der historischen Beschreibung und Einordnung dieser postkonziliaren Reformgruppierung. Da es sich beim Aktionskreis Halle um die einzige Gruppe dieser Art in der gesamten ostdeutschen katholischen Kirche handelt, die in alle Bistümer und Jurisdiktionsgebiete sowie in alle relevanten gesellschaftlichen und kirchlichen Themen hinein vernetzt war, avanciert er zu einem bislang einzigartigen Forschungsgegenstand. Die vielfältigen Verbindungen der Hallenser Protagonisten zu bundesdeutschen Priester- und Solidaritätsgruppen werfen natürlich auch die Frage nach grenzüberschreitenden kirchlichen und theologischen Interdependenzen auf.
Über den regionalgeschichtlichen Ansatz hinaus gewinnt die Darstellung des AKH im Hinblick auf die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962 – 1965) an Relevanz und Bedeutung. Aus der Art und Weise, wie diese basiskirchliche Gemeinschaft - damit ist eine Gruppe von Priestern und Laien definiert, die sich jenseits territorialer Strukturen zusammenfand - das Recht für sich in Anspruch nahm, eine freie Gemeinschaft zu gründen und dabei bestimmte Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen des Konzils ohne bischöfliche Autorisierung, ja oftmals gegen sie zu rezipieren, zu interpretieren und pastoral umzusetzen, ließen sich prototypische Rezeptionsweisen herausarbeiten, deren Legitimität vor dem Hintergrund ekklesiologischer Modelle zu analysieren ist. Darüber hinaus kann anhand exemplarischer Vergleiche mit den Positionen des Aktionskreises nachvollzogen werden, ob, wie und ab wann bestimmte Konzilsaussagen durch die ostdeutschen Bischöfe rezipiert wurden. Die komparative Auseinandersetzung mit dem Hallenser Aktionskreis und bestimmten Positionen der ostdeutschen katholischen Bischöfe ermöglicht die Diskussion verschiedener theologischer Fragen. Wie weit wurde die Geschwisterlichkeit des pilgernden Gottesvolkes umgesetzt und dadurch das bisherige eher klerikal dominierte Kirchenverständnis überwunden? Ist die katholische Kirche in der DDR in einen solidarischen Dialog mit ihrer Umwelt eingetreten und hat sie den von Gaudium et spes eingeforderten theologischen Ortswechsel hin zu einer Kirche in der Welt von heute vollzogen? Wurde das erneuerte Laienapostolat in der DDR wahrgenommen und von den Bischöfen gefördert oder distanzierte man sich von diesen konziliaren Aufbrüchen und verhalf dem Modell der „Katholischen Aktion“ letztlich zur Durchsetzung? Weshalb gab es in der DDR kein kirchliches Vereinswesen? Wie reagierte der totalitäre SED-Staat auf eine fest institutionalisierte katholische Reformgruppe und wie reagierte man schließlich kirchlicherseits unter den Bedingungen einer totalitären Diktatur auf interne Kritik und die zum Teil scharfe Infragestellung pastoraler und kirchenpolitischer Konzepte?
Innerkirchliches „Dissidententum“ und „Nonkonformismus“ waren in der katholischen Kirche in der DDR keine weit verbreiteten Phänomene. Ihre Erforschung ermöglicht daher kaum verallgemeinerbare Aussagen über den DDR-Katholizismus insgesamt, hinterfragt aber das Bild eines „monolithischen Blocks“, für den der ostdeutsche Katholizismus lange Zeit gehalten wurde. Dem Aktionskreis Halle kommt daher unter verschiedenen Blickwinkeln eine Sonderstellung als Kristallisationspunkt für die regionale Kirchen- und Theologiegeschichte Ostdeutschlands zu. Die Erforschung seiner Geschichte liefert daher einen pastoral sowie kirchenpolitisch angelegten Beitrag zu einer noch zu verfassenden Gesamtdarstellung der Kirchengeschichte der DDR.
Die leitenden Thesen dieser Dissertation lauten: Der Aktionskreis Halle hat theologisch legitimiert die Aussagen des II. Vatikanischen Konzils selbstständig und partiell autonom rezipiert und ist aufgrund der hieraus gefolgerten Positionen und Ansprüche in teils massiven Konflikt zum Magdeburger Bischof und der ostdeutschen Ordinarien- und späteren Bischofskonferenz sowie dem SED-Staat geraten. Durch seine Interpretation und Umsetzung von Geist und Buchstabe des Konzils in den 70er Jahren hat er Wege beschritten, die für einzelne Bischöfe Anfang der 80er Jahre anschlussfähig waren. Als wohl einzige öffentlich agierende katholische Vereinigung aus Priestern und Laien in der DDR hat er dazu beigetragen, dass sich kirchliches Leben jenseits von Pfarrgemeindestrukturen entwickeln konnte und hier neue Freiräume entstanden.
2.Forschungsstand
Beim Stand der Forschungen ist hinsichtlich der beiden Themengebiete Aktionskreis Halle und Konzilsrezeption in der DDR zu differenzieren. Zu Geschichte und Entwicklung des AKH liegen bislang eine Monographie9, ein Lexikoneintrag10 sowie verschiedene publizistische und wissenschaftliche Artikel11 vor. Auffallend ist, dass es vor allem Mitglieder des Aktionskreises selbst waren, die über ihn veröffentlichten.12 Darüber hinaus wurden die Gruppe und ihr Engagement in zeitgenössischen Kommentierungen bundesdeutscher Autoren13 ebenso thematisiert wie in jüngeren Beschreibungen zeitgeschichtlicher Sekundärliteratur.14
Der AKH wird dabei sowohl aus historischer, politikwissenschaftlicher, soziologischer und theologischer Perspektive betrachtet und als „innerhalb wie außerhalb der DDR[…]wohl bekannteste innerkirchliche Basisgruppe“15 beschrieben, die sich „kirchenkritisch, nicht kirchenfeindlich“16 „auf den Geist und die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils“17 berief und durch ihr Wirken ein „prophetisches Wächteramt“18 in der ostdeutschen Kirche wahrnahm sowie aufgrund der Konfrontation mit Staat und Kirche in einer „dreifachen Diaspora“19 existierte. Die bisherigen Publikationen über den Aktionskreis skizzieren zumeist knapp die Entstehung, Struktur und Tätigkeit der Gruppe und weisen in unterschiedlicher Ausführlichkeit auf die Auseinandersetzungen mit dem SED-Staat und den katholischen Bischöfen in einer „unheiligen Allianz“20 hin.21 Nur wenige Beiträge greifen in ihren Darstellungen und Einschätzungen auf Quellen zurück; zumeist handelt es sich um zeitgenössische Beobachtungen oder um Kompilationen bisheriger Darstellungen. Noch immer gibt es zum Teil erhebliche Differenzen darüber, was der Aktionskreis war und welche Ziele er verfolgte bishin, dass es nicht immer gelingt, die Abkürzung AKH exakt aufzuschlüsseln.22
Eine umfassende Analyse der ostdeutschen Konzilsbeteiligung und der anschließenden Konzilsrezeption in der katholischen Kirche in der DDR steht, ebenso wie für den bundesdeutschen Katholizismus23, noch aus. Erste Forschungen für die katholische Kirche in der DDR konnten Entwicklungslinien und zentrale Themen, beteiligte Personen und Institutionen sowie verschiedene Konfliktfelder der Konzilsrezeption herausarbeiten.24 Eine Verknüpfung beider Forschungsansätze in einer Geschichte der Konzilsrezeption durch den AKH ist bislang nur vereinzelt in den Blick gekommen.25
Trotz des keineswegs unprofilierten Forschungsstandes ergeben sich verschiedene Desiderate und offene Fragen. Bislang fehlt eine ausführliche Darstellung, Analyse und Einordnung dieser innerkirchlichen Basisgruppe aufgrund von Kategorien und Maßstäben, die sich am Selbstverständnis und dem historischtheologischen Kontext des Forschungsgegenstandes orientieren. Die bisher eher fragmentarische Übersicht zur tatsächlichen Aktivität des Kreises vermag es zudem nicht, die Relevanz seiner Beiträge für die katholische Kirche in der DDR überzeugend darzustellen und kritisch einzuordnen. Dies liegt nicht zuletzt im Mangel eines geeigneten Bezugssystems begründet, anhand dessen sein Wirken verglichen und beurteilt werden könnte. Die zahlreichen Darstellungen konstatieren zwar ausnahmslos die Konfliktsituation des Hallenser Aktionskreises zwischen Staat und Kirche und beschreiben die Auseinandersetzungen mitunter aus Sicht der Betroffenen. Der bisherige Forschungsstand entbehrt aber einer objektiven und umfassenden Darstellung dieser Konfrontationen anhand einer synoptischen Betrachtung unterschiedlicher Quellenüberlieferungen. Auch die Motive und Verantwortlichkeiten kirchlicher und staatlicher Stellen wurden bislang kaum thematisiert bzw. ausreichend zu ergründen und zu analysieren gesucht.26 Schließlich bleibt erläuterungsbedüftig, ob der Aktionskreis Halle nur ein Opfer staatlicher Zersetzungspraktiken war oder ob er nicht durch Unterwanderung und Infiltrierung durch das MfS passiv oder aktiv zum Vollzugsgehilfen staatlicher Interessen wurde.27
3.Aufbau und Methodik
Die vorliegende kirchengeschichtliche Arbeit gliedert sich entsprechend der historischen und theologischen Forschungsmotive in vier Hauptkapitel, denen sich ein resümierender Ausblick anschließt. Ausgehend von einer genetischen Darstellung der Geschichte, Struktur und des Wirkens des Aktionskreises Halle als postkonziliare Reformgruppe im ersten Teil wird im zweiten Kapitel die Konzilsrezeption durch den AKH konkret nachgezeichnet. Anhand dreier Themen von kirchlicher und gesellschaftlicher Relevanz wird die Konzilsrezeption des Aktionskreises exemplarisch analysiert und mit bischöflichen Rezeptionsbemühungen komparativ diskutiert.
Aufgrund der spezifisch ostdeutschen Situation einer Kirche im totalitären Staat ist es in einem dritten Hauptteil notwendig, die rein innerkirchliche Betrachtung des Aktionskreises um die staatliche Perspektive zu ergänzen. Dabei könnte der Eindruck entstehen, dass die Arbeit in zwei Teile - die Geschichte und Konzilsrezeption einerseits und die staatliche Auseinandersetzung andererseits - zerfällt. Um jedoch ein vertieftes Verständnis von dem zu erlangen, was der AKH war, durch sein Tun beabsichtigte und was er für die katholische Kirche in der DDR angestoßen und bedeutet hat, ist die Verschränkung beider Teile unabdingbar. Die Auseinandersetzung der Kirche mit der atheistischen Einparteiendiktatur sozialistischer Prägung ist für die DDR konstitutiv. Nur so kann das tatsächliche Umfeld, in dem sich die Rezeption der konziliaren Reformbemühungen bewähren musste, dargestellt werden. Diese Dimension unterscheidet die Situation des AKH elementar von der bundesdeutscher Priester- und Solidaritätsgruppen. Sie macht deutlich, dass die Verfolgung innerkirchlicher Reformanliegen in der DDR mit Repressionen und zum Teil existentiellen Gefährdungen verbunden sein konnte. Die politische und staatliche Bewertung sowie das daraus resultierende geheimpolizeiliche Vorgehen gegen einzelne Personen und den AKH insgesamt wird detailliert beschrieben, um die Menschenverachtung des SED-Staates herauszustellen und zugleich den Erfolg oder Misserfolg staatlicher Einflussnahme kritisch bilanzieren zu können. Dass eine gezielte staatliche Zersetzungsstrategie gegenüber dem AKH nicht ohne eine partielle Kooperation mit leitenden kirchlichen Stellen stattfinden konnte, wird eigens im vierten Kapitel aufgezeigt und kritisch hinterfragt. Der resümierende Ausblick bündelt die historisch-theologischen Darstellungen und synthetisiert die Ergebnisse in drei Begriffen und Modellen.
Grundlegend für die historische Arbeit ist das Quellenstudium in Archiven verschiedener Provenienz. Die zu bearbeitenden Quellen werden historisch-kritisch analysiert, eingeordnet und interpretiert sowie mit der Literatur zur zeitgeschichtlichen Katholizismusforschung vernetzt. Methodisch orientiert sich die kirchengeschichtliche Dissertation zunächst an der ereignisgeschichtlichen Darstellung von Vorgängen und Entwicklungen, um dabei nach auslösenden, hemmenden und begleitenden Faktoren zu fragen. Strukturgeschichtlich wird nach den Charakteristika der basiskirchlichen Gemeinschaft in der katholischen Kirche in der DDR gefragt. Theologie- und ideengeschichtlich kommen jene Auffassungen, Einstellungen und Konzepte in den Blick, die Personen und Gruppen wirksam beeinflusst und Handlungen legitimiert und motiviert haben. Als kirchengeschichtliche Arbeit ist die vorliegende Analyse der Hermeneutik theologischer Forschung verpflichtet. Kirchengeschichte wird dabei als theologische Disziplin betrieben, die nicht nur historische Fakten und Entwicklungen festhält, sondern auch zu theologisch relevanten Ergebnissen führt. Ein derartiger Zugang zum AKH legitimiert sich nicht nur a priori durch das fachspezifische Selbstverständnis und die damit verbundene Methodik. Eine theologisch ausgerichtete Heuristik empfiehlt sich auch durch das Forschungsobjekt selbst. Die Konzilsrezeption ist insofern keine bloß von außen an den Hallenser Aktionskreis herangetragene, analytische Matrix. Sie entspringt vielmehr dem Gründungsimpuls und der bleibenden Intention der Gruppe. Der in dieser Studie verfolgte historisch-theologische Ansatz vermag es deshalb, die Entwicklungen gerade nicht losgelöst vom Selbstverständnis des Forschungsobjektes zu deuten und einzuordnen. Ein explizit sozialgeschichtlicher, soziologischer oder politikwissenschaftlicher Zugang zum Thema AKH wird in dieser Untersuchung aufgrund der damit verbundenen Aporien aus Methodologie, Forschungsobjekt und Forschungsfrage nicht verfolgt. Die breite Quellenüberlieferung in den konsultierten Archiven erlaubt nicht zuletzt durch konkrete Überlieferungsvergleiche eine differenzierte Darstellung. Auf qualifizierte Zeitzeugeninterviews wurde nur dort zurückgegriffen, wo die ansonsten umfangreiche Quellenlage widersprüchlich oder inexistent ist oder Zeitzeugen zusätzliche Hintergrundinformationen geben können.28
4.Quellenlage
Die kirchengeschichtliche Bearbeitung des Aktionskreises Halle kann sich auf eine breite Quellenbasis stützen. Sowohl in privaten, kirchlichen als auch staatlichen Archiven und in universitären Forschungseinrichtungen finden sich Nachlässe, Korrespondenzen, amtliche Mitteilungen, Rundschreiben, Protokolle, Tonbandaufzeichnungen und Aktenvermerke des Kreises sowie in unterschiedlicher Ausprägung auch von kirchlichen und staatlichen Antagonisten. Diese Überlieferungsdichte wird durch die bereits edierten Quellenbände ergänzt und erlaubt in weiten Teilen eine detaillierte Darstellung und Erörterung.29
Der primäre Quellenbestand findet sich im Privatarchiv des Aktionskreises Halle, das als Depositum in der Forschungsstelle für kirchliche Zeitgeschichte in Erfurt lagert.30 Hier befinden sich Kopien der Rundbriefe, Protokolle der Vollversammlungen und Sprecherkreissitzungen, Mitgliederlisten, Empfängerlisten der Rundbriefe, Berichte über Aktivitäten, Vorträge sowie ein großer Teil der Korrespondenz des AKH und seiner Mitglieder. Das Archivmaterial ist durch verschiedene Vorarbeiten teilweise erschlossen und verzeichnet.31 Ergänzt wird dieses Privatarchiv, das den materiellen Ausgangspunkt der Forschungen darstellt, durch den Nachlass von Adolf Brockhoff 32 sowie durch private Aktensammlungen von Dr. Claus Herold33, Helmut Langos34, Joachim Garstecki35 und Dr. Peter Willms.36
Insgesamt vier Diözesanarchive in Magdeburg, Paderborn, Berlin und Erfurt beinhalten den kirchlichen Quellenbestand jener Bischöfe, Gremien und Institutionen, die sich offiziell und inoffiziell mit dem AKH befassten.37 Dieser Bestand ist im Vergleich zum Privatarchiv des AKH oder den staatlichen Quellen auffallend gering ausgeprägt und konzentriert sich vor allem auf die Jahre 1969/70 sowie 1984/85. Die Situation eines totalitären Staates und die latente Papierknappheit in der DDR haben die Amtskirche nicht selten von einer schriftlichen Fixierung bestimmter Fragen und Positionen Abstand nehmen lassen. Im Bistumsarchiv Magdeburg (BAM) konnten die Aktensammlungen zum Aktionskreis Halle eingesehen werden, die sich neben der Sammlung der AKH-Rundbriefe vor allem auf Briefe im Zusammenhang mit den „Magdeburger Vorgängen 1969/70“ konzentrieren. Die beiden Teilnachlässe von Weihbischof Friedrich Maria Rintelen38 und Bischof Johannes Braun39 sind hinsichtlich der bischöflichen Bewertung des AKH wenig aussagekräftig.40 Deutlicher tritt allein in der vorwiegend handschriftlich überlieferten Korrespondenz zwischen Weihbischof Friedrich Maria Rintelen und dem Paderborner Erzbischof Lorenz Kardinal Jaeger41 die Einschätzung von bestimmten Personen und Entwicklungen zutage. Eine Vielzahl von Akten des Bistumsarchivs beinhaltet personenbezogene Informationen, die aufgrund des Schutzes von Persönlichkeitsrechten nicht zugänglich sind. Hier erlauben die kirchlichen Akten keinen Vergleich zu privat überlieferten Quellen. Im Erzbischöflichen Archiv Paderborn (EAP) befinden sich Akten der kirchlichen Verwaltung sowie der amtlichen Korrespondenz zwischen Magdeburg und Paderborn. Vor allem bis 1970 ist durch die Akten des Magdeburger Kommissars und des Nachlasses von Lorenz Kardinal Jaeger eine detaillierte Rekonstruktion von Entwicklungen und Entscheidungen des Paderborner Erzbischofs möglich. Die vor allem im Nachlass Jaeger enthaltene Korrespondenz erlaubt einen weitreichenden Einblick in das Handeln des Erzbischofs hinsichtlich der Magdeburger Vorgänge. Der regelmäßige Briefverkehr zwischen Weihbischof Rintelen und Kardinal Jaeger scheint unter Bischof Braun keine Fortsetzung gefunden zu haben. Allerdings hat der Kardinal handschriftliche Aktenvermerke über die weitverzweigten Absetzungsbemühungen von Alfred Bengsch42 gegenüber Friedrich Maria Rintelen hinterlassen, die offensichtlich gezielt ein vom Berliner Kardinal konstruiertes Geschichtsbild korrigieren sollten. Im Berliner Diözesanarchiv (DAB) findet sich ein Teilnachlass des Berliner Erzbischofs Alfred Kardinal Bengsch.43 Dieser Quellenbestand erweist sich im Hinblick auf den AKH als wenig aussagekräftig, da er nur marginale Hinweise auf einzelne Personen des Aktionskreises enthält. Die ebenfalls im Berliner Diözesanarchiv befindliche Quellensammlung von Martin Höllen weist dagegen auch Hinweise und Schriftstücke zum AKH auf, die keinen Eingang in die dreibändige Quellenedition gefunden haben. Die wohl umfangreichste und aussagekräftigste Quellensammlung kirchlicher Provenienz stellen die Akten der Berliner Ordinarien- und späteren Bischofskonferenz dar, die sich im Regionalarchiv der Ordinarien Ost (ROO) im Bistumsarchiv Erfurt befinden. Die amtlichen Protokolle der Ordinarien- und späteren Bischofskonferenz sowie Quellen, Vermerke und Briefe aus dem Bestand der Bischofskonferenz zum AKH selbst erlauben eine Annäherung an die bischöfliche Bewertung der Hallenser Reformbemühungen, obwohl die Quellendichte hierbei auffallend gering ist.
In staatlichen Archiven sind Quellen derjenigen Institutionen und Organe der DDR überliefert, die sich mit dem Hallenser Aktionskreis auseinandergesetzt haben. Dazu zählen die Arbeitsgruppe für Kirchenfragen beim Zentralkomitee (ZK) der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), der Staatssekretär für Kirchenfragen und dessen Sekretariat im Rang einer Dienststelle sowie das Ministerium für Staatssicherheit. Der mit Abstand umfangreichste Quellenbestand findet sich in den Akten des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), die durch den Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU) zugänglich gemacht werden. Die quellenkritisch äußerst differenziert zu bewertenden Akten, die teilweise unvollständig oder fragmentarisch überliefert und aufgrund des Schutzes von Persönlichkeitsrechten teilweise anonymisiert sind, enthalten personenbezogene Dossiers, operative Vorgänge sowie Personal- und Berichtsakten inoffizieller Mitarbeiter des MfS. Der Staatssekretär für Kirchenfragen und dessen Dienststelle waren für die genuin staatliche Einordnung und Bewertung der katholischen Kirche insgesamt und daher auch für den Aktionskreis Halle verantwortlich. Das im Berliner Bundesarchiv überlieferte Quellendepositum enthält detaillierte Berichte und Einschätzungen über den AKH sowie die bischöfliche Bewertung des Kreises und ist daher, obgleich im Umfang wesentlich geringer als die Akten der Staatssicherheit, nicht minder aussagekräftig. Die politische und damit in der DDR letztlich entscheidende Einordnung des Aktionskreises fand in der Abteilung für Kirchenfragen beim ZK der SED statt. Der äußerst geringe, aber dennoch bedeutende Quellenbestand der Arbeitsgruppe zum AKH ist in der „Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR“ (SAPMO) im Berliner Bundesarchiv überliefert.
Das äußerst umfangreiche Quellenmaterial ist unterschiedlich zu gewichten. Das Privatarchiv des Aktionskreises sowie die kirchlichen Archive beinhalten überwiegend Primärquellen der handelnden Personen. Quellenkritisch sind diese Überlieferungen als besonders authentisch und zuverlässig zu qualifizieren, wenngleich besonders bei eigens für die kirchlichen Akten verfassten Vermerken die Aussageintention und die jeweilige Situation des Verfassers mitbedacht werden müssen, um Tendenzen einer gezielten Geschichtsbildung erkennen zu können. Die staatlichen Quellen sind quellenkritisch mindestens ebenso differenziert zu betrachten. Interne Einschätzungen und Berichte staatlicher und vor allem geheimpolizeilicher Organe verfolgten nicht nur eine Informationsabsicht. Innerhalb des diktatorischen Systems wird man stets mit zusätzlichen Interessen und Aussageabsichten zu rechnen haben, die den Inhalt einer Quelle überlagern und verzerren können. Der Aussagewert und die Verlässlichkeit dieser Sekundärquellen sind deshalb je eigens zu überprüfen. Dies ist im besonderen Maße dort geboten, wo es sich um Informationen und Berichte von inoffiziellen Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit handelt.