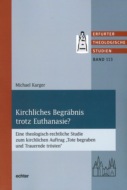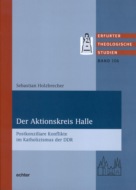Kitabı oku: «Der Aktionskreis Halle», sayfa 5
2.Initialzündung - die Bischofsernennung in Magdeburg
Gründungsauslöser und erster öffentlicher Testfall für die Rezeption von Geist und Buchstabe des Konzils war die Nachfolgeregelung für den Magdeburger Weihbischof Friedrich Maria Rintelen im Sommer 1969. Die Entwicklungen im Kommissariat Magdeburg zwischen Juli 1969 und der Bischofsweihe im April 1970 stellen ein Exepmel dafür dar, wie sich innerkirchliche, diplomatische und machtpolitische Aspekte auf die Verwirklichung konziliarer Aufbrüche in der DDR auswirkten. Diese äußerst disparate Gemengelage ist für die Bedingungen konstitutiv, unter denen sich die Konzilsrezeption auch im totalitären SED-Staat vollzog. Dabei zeigt sich, welche Probleme und Konsekutivwirkungen die oft nur unzureichende Implementierung demokratischer Partizipationsmöglichkeiten in sich barg. Das geheime Prozedere der Ablösungsbestrebungen sowie der Versuch einer breiten Beteiligung der Ortskirche bei der Wahl des neuen Weihbischofs führten zu erheblichen und teils öffentlichen Kontroversen. Diese spalteten nicht nur den Magdeburger Klerus, sondern hatten Auswirkungen bis in höchste kirchliche Kreise. Im Folgenden soll das vielfältige Problemfeld aufgezeigt werden, auf dem sich der Aktionskreis Halle als innerkirchliche Protestbewegung konstituierte. Die Entwicklungen werden aufgrund ihrer Brisanz, der umfangreichen und erst jüngst zugänglichen Quellenlage sowie der Bedeutung für spätere öffentliche Wahrnehmung des AKH ausführlich dargelegt.
2.1Konfliktreiche Rahmenbedingungen
Im Erzbischöflichen Kommissariat Magdeburg lassen sich in den Jahren 1969/70 im Wesentlichen drei Aspekt benennen, die auf innerkirchliche Reformambitionen Auswirkungen hatten: innerkirchliche Bestrebungen zur Bischofswahl, kirchenpolitische Emanzipationsbemühungen der DDR sowie persönliche Differenzen einzelner Bischöfe in der DDR.
Die innerkirchlich-theologische Situation war auf und nach dem Konzil unter anderem durch die Frage nach einem möglichen Anteil der Priester und Laien an der Bischofswahl geprägt.197 Durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte hindurch gab es unterschiedliche Formen zur Besetzung eines vakanten Bischofssitzes.198 Eine Beteiligung des Presbyteriums oder der Laien bei der Auswahl und Benennung eines Bischofs wird in der katholischen Kirche spätestens seit dem 13. Jahrhundert nicht mehr praktiziert.199 Im 20. Jahrhundert wurde das freie päpstliche Ernennungsrecht zur gemeinrechtlichen Regel erhoben und die Möglichkeit zur Bischofswahl war fortan nur noch eine Konzession an zumeist deutschsprachige Konkordatspartner des Heiligen Stuhls.200 Von diesen Regelungen ist das Prozedere für die Ernennung eines Auxiliarbischofs zu unterscheiden, da dieser entsprechend einer einzureichenden Vorschlagsliste vom Vatikan ernannt wird.201 Das II. Vatikanum ließ keinen Zweifel daran, dass es am geltenden Modus zur Bestellung der Bischöfe festhalten und staatliche Einflussmöglichkeiten zurückgedrängt wissen wollte.202 Nach 1965 kam es weltweit zu Forderungen von katholischen Priestern und Laien, ihre Ortsbischöfe selbst wählen bzw. ein Mitspracherecht bei der Kandidatenaufstellung wahrnehmen zu dürfen.203 Die Nachfolge der Erzbischöfe in New York, Paris und Köln204, um nur einige Beispiele zu nennen, sollte dementsprechend geregelt werden.205 Aufgrund der exzellenten Verbindungen der Magdeburger Priester und Laien nach Westdeutschland - hier ist besonders der Freckenhorster Kreis206 zu erwähnen207 - waren diese Entwicklungen in der DDR präsent.208 Nicht zuletzt die theologische Diskussion dieser Frage hatte diese Ansprüche auch auf die Agenda einzelner ostdeutscher Priester und Laien gesetzt. Dabei waren es gerade keine theologischen Außenseiter, die auf die mangelnde Beteiligung der Ortskirche bei der Bestellung eines Bischofs hinwiesen und für geeignete Formen der Partizipation eintraten.209 In Ostdeutschland hatte unter anderem die Meißner Diözesansynode eine entsprechende Beteiligungsmöglichkeit der Ortskirche eingefordert.210
Die kirchenpolitische Situation in der DDR in den späten 1960er Jahren war wie im gesamten Ostblock äußerst angespannt. Der Grund hierfür lag in einer diffizilen Gemengelage unterschiedlicher außen- und innenpolitischer Interessen der Staaten unter sowjetischer Hegemonie. Umrahmt wurden diese Entwicklungen von der „Vatikanischen Ostpolitik“211 und der Deutschlandpolitik der linksliberalen Bonner Regierung unter Bundeskanzler Willy Brandt.212 Der SED-Staat drängte im Hinblick auf das zwanzigjährige Jubiläum der Staatsgründung auf eine Anerkennung seines völkerrechtlichen Status als zweiter deutscher Staat und übte dafür auch Druck auf die Kirchen aus. Während sich die evangelischen Kirchen in der DDR bereits 1965 von der bundesdeutschen EKD getrennt hatten, galt dies für die katholische Kirche als inopportun. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatten die katholischen Bischöfe der mitteldeutschen Bistümer alles darangesetzt, die durch die Interzonen- und spätere Staatsgrenze herbeigeführte politische Teilung pastoral abzumildern und die kirchliche Verbindung nicht abreißen zu lassen. Dies zeigte sich besonders deutlich in der Personalpolitik. Friedrich Maria Rintelen, Priester und Generalvikar der Erzdiözese Paderborn, wurde am 12. Dezember 1951 durch Papst Pius XII. zum Titularbischof von Chusira ernannt und am 24. Januar 1952 zum Paderborner Auxiliarbischof geweiht. Kardinal Jaeger entsandte ihn am 1. Januar 1952 als Erzbischöflichen Kommissar nach Magdeburg, wo er den östlichen Diözesanteil im Auftrag von Kardinal Jaeger weitgehend selbstständig leitete.213 Auch in Erfurt, Meiningen und Schwerin waren bischöfliche Kommissare im Amt, die mit delegierten Vollmachten im Auftrag ihrer Ortsordinarien agierten und so die jurisdiktionelle Verbindung über Staatsgrenzen hinweg aufrechterhielten.214 Diese Regelungen waren nötig geworden, da der SED-Staat sukzessive die Kontakte zwischen den ost- und westdeutschen Diözesanteilen einzuschränken versuchte und die westdeutschen Bischöfe schließlich ab 1966 mit einem totalen Einreiseverbot in die DDR belegte.215 Das staatliche Ziel war die Loslösung der katholischen Kirche in der DDR von den bundesdeutschen Diözesen, analog zur Entwicklung in den evangelischen Kirchen.216 Die Kirche musste deshalb fürchten, dass sich der SED-Staat infolgedessen in ihre inneren Angelegenheiten einmischen könnte. Bereits 1962 hatte das Staatssekretariat für Kirchenfragen in der DDR signalisiert, dass es dem Souveränitätsanspruch des SED-Staates zuwiderlaufe, wenn er bei Fragen die Katholiken in der DDR betreffend, mit westdeutschen Bischöfen in Kontakt treten müsse.217 Diesen Entwicklungen folgend hatte sich der Berliner Erzbischof und Vorsitzende der Berliner Ordinarienkonferenz Alfred Kardinal Bengsch 1966 in Rom für eine ernsthafte Erwägung der „Sicherung der kirchlichen Administration und Jurisdiktion im Gebiet der DDR“218 eingesetzt. Um die Jurisdiktion in diesen Gebieten auch weiterhin gewährleisten zu können, schlug Bengsch in Rom vor, im Zusammenhang mit der Ernennung von Apostolischen Administratoren für Westpolen auch in Ostdeutschland derartige Regelungen zu treffen.219 In Vorbereitung auf den zwanzigsten Jahrestag der Gründung der DDR 1969 forcierte der SED-Staat im Rahmen seiner gesteigerten Souveränitätsbestrebungen eine Loslösung und Verselbstständigung der katholischen Kirche in der DDR.220 Höhepunkt dieser Strategie war die am 14. Mai 1969 von Staatssekretär Hans Seigewasser abgegebene Erklärung, dass im Todesfall eines Weihbischofs der von Westdeutschland ernannte Nachfolger von der DDR-Regierung nicht mehr anerkannt werden würde.221 Der Paderborner Erzbischof hatte bereits 1967 Vorkehrungen getroffen, die im Falle einer Paderborner Sedisvakanz die Stabilität und Kontinuität in Magdeburg sichern sollten. Das Amt des Generalvikars würde zwar wie kirchenrechtlich vorgeschrieben mit Erledigung des Paderborner Bischofsstuhls erlöschen, jedoch nicht Rintelens Amt als Erzbischöflicher Kommissar. Dazu hatte ihm Erzbischof Jaeger alle Vollmachten übertragen, die ein Bischof delegieren kann.222 Schwieriger zu beantworten war hingegen die Frage, wie im Falle eines alters- oder gesundheitsbedingten Rücktritts der Kommissare in der DDR zu verfahren sei. Dem kirchenrechtlich vorgesehenen Ablauf folgend, hätte die Ernennung eines Nachfolgers das Eingreifen des zuständigen westdeutschen Bischofs erfordert. Aufgrund von Sondierungsgesprächen mit staatlichen Repräsentanten war Kardinal Bengsch zu der Auffassung gelangt, dass, sollten die Nachfolger zu westdeutschen Weihbischöfen ernannt und anschließend in die DDR geschickt werden, der SED-Staat sie als westliche Beauftragte ansehen und möglicherweise in ihrer Amtsführung behindern würde.223 Gerade im Vorfeld des zwanzigsten Jahrestages der Staatsgründung mussten die ostdeutschen Bischöfe daher besonders darum bemüht sein, „dass den staatlichen Behörden keine Möglichkeit gegeben wird, sich in die kirchliche Verwaltung unter dem Vorwand ihrer Souveränitätspolitik einzuschalten.“224
Die ohnehin konfliktreichen innerkirchlichen und politischen Rahmenbedingungen spitzten sich schließlich drittens durch persönliche Faktoren zu. Weihbischof Rintelen hatte gegenüber der Berliner Ordinarienkonferenz und gegenüber Kardinal Jaeger mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass er „mit Erreichen des 70. Lebensjahres die Leitung des Kommissariates niederlegen“225 würde. Dies entsprach den durch das Konzil erneuerten Altersgrenzen zur Emeritierung von Bischöfen.226 Da Friedrich Maria Rintelen 1899 geboren wurde, wurde diese Frage spätestens im Dezember 1969 akut. Darüber hinaus hat es auf verschiedenen kirchlichen Ebenen Kritik an Rintelens Führungsstil im Kommissariat Magdeburg gegeben. Dies dürfte etwaige Nachfolgeplanungen zusätzlich motiviert haben. Klagen über den Führungsstil des Magdeburger Weihbischofs breiteten sich nicht nur innerhalb des Erzbischöflichen Kommissariates aus. Sie gelangten auch nach Paderborn und Berlin. Bereits Anfang der 1960er Jahre hatte sich in bestimmten Magdeburger Kreisen ein „Unbehagen gegen den Weihbischof“227 entwickelt. Ob es sich hierbei nur um eine Minorität im Klerus gehandelt hat, lässt sich nicht zuverlässig eruieren. 1965 berichtete der Hallenser Studentenpfarrer und Leiter des Sprachenkurses Adolf Brockhoff dem Paderborner Erzbischof von der Unzufriedenheit verschiedener Gruppen und Kreise mit der Art und Weise, wie Weihbischof Rintelen das Kommissariat leitete: „Der Weihbischof ist seit langem überfordert. Er ist überfordert sich der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Situation in der DDR zu stellen. Er ist überfordert, die großen Aufbrüche des Konzils wirklich zu begreifen und sie zum Impuls eines neuen Anfangs zu machen. Er ist überfordert, an den täglichen Nöten und Sorgen von Priestern und Volk zu partizipieren.“228 Trotz dieser Kritik und den unterschiedlichen theologischen und pastoralen Standpunkten, die Rintelen und bestimmte reformorientierte Teile des Magdeburger Klerus vertraten, herrschte ein menschlich ausgewogenes Verhältnis.229 Allerdings gab es einen Priester - er gehörte dem Reformflügel im Klerus offensichtlich nicht an – der, vermutlich persönlich betroffen, für die Situation im Kommissariat Magdeburg in den 60er Jahren, die seiner Meinung nach von „Resignation“ und innerer „Emigration“ der Priester sowie einer grundlegenden Enttäuschung unter den Laien geprägt gewesen sei, vor allem die Person des Magdeburger Weihbischofs verantwortlich machte und ihn gegenüber dem Berliner Erzbischof Bengsch denunzierte.230
Dass es Schwierigkeiten im Kommissariat gegeben hatte, die mit dem Weihbischof in direkter Verbindung standen, war trotz der staatlich gewirkten Isolation in Paderborn nicht verborgen geblieben. Jedoch ergibt sich aus den Quellen ein ambivalentes Bild, wie Lorenz Kardinal Jaeger mit diesen Problemanzeigen umging und sie bewertete. Quellenkritisch eher skeptisch zu beurteilen sind Notizen von Adolf Brockhoff, anlässlich eines der seltenen Gespräche zwischen dem Kardinal und Teilen seines Magdeburger Klerus in Ost-Berlin 1965. Weihbischof Rintelen sei demnach in Kardinal Jaegers Auffassung: „Kein Gesprächspartner. Er entzieht sich. Er bagatellisiert. Er verharmlost. Sie sind zu stark und zu selbstbewusst für ihn!“231 Pfarrer Brockhoff hielt in einem offiziellen Brief an den Paderborner Kardinal 1970 nochmals fest: „Schon lange ist das Kommissariat ohne eine echte Führung. Das wissen Sie so gut wie ich. In dem Gespräch, das Sie mir im Januar 1966 gewährten und das Sie spätestens (‚in welcher Form auch immer!‘) im Mai desselben Jahres fortsetzen wollten, haben Sie das bestätigt, was viele wussten und was der Berliner Bischof z.B. - gar nicht zimperlich - laut aussprach.“232
Der Berliner Erzbischof Alfred Bengsch scheint für die Nachfolgeregelung in Magdeburg eine als ambivalent zu charakterisierende Schlüsselrolle eingenommen zu haben. Er selbst hatte in einem vertraulichen Brief an den Paderborner Erzbischof und Kardinal seine Rolle eher passiv dargestellt und die Initiative allein bei Lorenz Jaeger gesehen.233 Erzbischof Jaeger war über die Darstellung in diesem Brief in höchstem Maß empört. Er verfasste daraufhinquer über den Brief des Berliner Kardinals - handschriftlich seine Wahrnehmung der Entwicklungen: „Die Vorgeschichte die schon in der 3. Konzilsperiode anfing, als der H.H. Apost. Nuntius mir mündlich interessierte, dass für Exz. Rintelen, der der Aufgabe nicht mehr gewachsen sei, ein Nachfolger oder ein Koadjutor bestellt werden müsste. Ich habe widersprochen, weil das Urteil darüber mir und nicht Erzb. Bengsch zustehe. Nachfolgende Aussprache in Rom + erneut später in Ostberlin hat Erzb. Bengsch versprochen, ein loyales Verhalten gegenüber WB Rintelen + dem Erzb. Kommissariat Magdeburg. De facto hat Erzb. Bengsch in Bad Godesberg weiter gegen Rintelen gearbeitet, wie gelegentliche Äußerungen des Herrn Nuntius mir gegenüber gezeigt haben.“234 Offensichtlich war Kardinal Jaeger weder während des Konzils in Rom noch zu einem späteren Zeitpunkt bereit, sein bischöfliches Alter Ego in Magdeburg abzusetzen. Stattdessen informierte er seinen Weihbischof über die Berliner Pläne235 und versicherte ihn seiner Loyalität.236
Flankiert wird der Befund aus kirchlichen Quellen durch Akten des Ministeriums für Staatssicherheit. Prälat Otto Groß237, einer der engsten Mitarbeiter von Kardinal Bengsch im Ost-Berliner Ordinariat und zugleich der bischöflich beauftragte Verhandlungspartner mit dem MfS in der DDR, entfaltete in einem Gespräch 1968 verschiedene Gedanken und Einschätzungen des Berliner Erzbischofs zur Lage im Kommissariat Magdeburg, die der Führungsoffizier festhielt.238 Kardinal Bengsch sei demnach der Meinung gewesen, dass das Kommissariat in einer „gefährdeten Lage“239 sei, weil hier „einflussreiche Gruppen katholischer Geistlicher und Laien vorhanden [sind S.H.], die in Opposition zur Leitung der katholischen Kirche in der DDR stehen.“240 Bengsch habe wenig Zutrauen in die Fähigkeiten der dortigen kirchlichen Verantwortlichen, denn er befürchte, dass „Weihbischof Rintelen/ Magdeburg und Weihbischof Schräder/ Schwerin ihren Aufgaben nicht mehr gewachsen sind.“241 Für den Berliner Kardinal „stehe ernsthaft die Frage, Bischof Rintelen in den Ruhestand zu schicken.“242 Die Abberufung sei nur deshalb noch nicht erfolgt, weil es nach Ansicht von Bengsch keinen Nachfolger im Kommissariat Magdeburg gäbe, der „wirksame Maßnahmen gegen die in Aufruhr geratenen Geistlichen und Laien einzuleiten und Ruhe und Ordnung im Bereich des Kommissariates wieder herzustellen“243 vermag.
Ob neben der Kritik an Rintelens mangelndem Durchsetzungsvermögen bei Disziplinarangelegenheiten244 auch eine vom MfS wahrgenommene Düpierung des Berliner Kardinals anlässlich der 1000-Jahr-Feier des Bistums Magdeburg 1968 eine Rolle gespielt haben könnte, bleibt offen.245 Wahrscheinlicher dürfte es hingegen sein, dass Bengsch in Rintelen einen Unsicherheitsfaktor für die kirchenpolitische Phalanx der Berliner Ordinarienkonferenz gegenüber dem SED-Staat erblickte. Weihbischof Rintelen hatte 1969 zusammen mit Staatssekretär Seigewasser ein gemeinsames Kommunique veröffentlicht246 und damit die Geschlossenheit der Ordinarienkonferenz, die sich ein einheitliches und abgestimmtes Vorgehen gegenüber staatlichen Stellen zur Maxime gemacht hatte, massiv unterlaufen.247 Dies drängte Prälat Groß in einem anderen Zusammenhang zu der Feststellung: „Dieses Kommunique übertrifft alle unsere Befürchtungen und ist ein Beweis dafür, wie notwendig der Wechsel in Magdeburg ist...Praktisch ist hiermit die Einheit der Bischöfe in politischen Dingen gebrochen und durch das Verhalten von Weihbischof Rintelen hat der Staat sein Ziel erreicht.“248 Die Einheit im Klerus und die Geschlossenheit der Ordinarienkonferenz gegenüber dem Staat aber waren die zentralen Grundsätze des Berliner Erzbischofs und Vorsitzenden der Berliner Ordinarienkonferenz.249
Die Notwendigkeit im Jahr 1969 einen Nachfolgekandidaten für den amtierenden Weihbischof Friedrich Maria Rintelen zu finden, ergab sich demnach aufgrund dreier Umstände: die kirchenpolitisch brisante Situation im geteilten Deutschland machte eine zufriedenstellende Stabilisierung des Amtes in Magdeburg durch eine praktikable Nachfolgeregelung zwingend erforderlich. Die kirchenrechtliche Vorschrift zur Emeritierung von Auxiliarbischöfen drängte spätestens 1969 zu einer effektiven Lösung. Hinzu kam die Kritik am Führungsstil des Kommissars und der daraus resultierende, bereits länger gehegte Wunsch verschiedener kirchlicher Ebenen, einen Nachfolger zu bestellen. In diesem Geflecht unterschiedlicher Motive dürften letztlich die kirchenpolitischen Erwägungen dominiert haben.250 Andernfalls hätte man schon eher reagieren können. Es gilt zu beachten, dass in Magdeburg - und das unterschied die Situation ganz wesentlich von der in Köln, New York oder Paris -, zu den konziliar motivierten Beteiligungserwartungen der Priester und Laien eine kirchenpolitisch höchst angespannte Situation hinzutrat. Die konziliar geprägten Hoffnungen auf ein Mitspracherecht der Ortskirche bei der Nominierung eines Bischofs trafen in der DDR auf die kirchenpolitischen Planspiele bischöflicher Hinterzimmer und stellten daher einen nicht zu unterschätzenden Unsicherheitsfaktor für geheime Absprachen dar.
2.2Gescheiterte Lösungsversuche
Der Paderborner Erzbischof Lorenz Kardinal Jaeger war lange Zeit weder an einer Statusänderung des Magdeburger Kommissariates hin zu einer Apostolischen Administratur noch an einer personellen Veränderung an der Spitze des Kommissariates interessiert.251 Erst im Jahr 1969 änderte er aufgrund verschiedener Umstände seine Einstellung. Ausschlaggebend dürfte eine Mitteilung des Apostolischen Nuntius Erzbischof Konrad Bafile252 im Mai bzw. Juni 1969 gewesen sein, wonach Papst Paul VI. zur Klärung des seit zwei Jahren schwebenden Fragenkomplexes nunmehr gewillt sei, für den Bereich der DDR Koadjutoren mit dem Recht der Nachfolge zu ernennen.253 Als Koadjutor wird im Kirchenrecht ursprünglich derjenige bezeichnet, der dem Diözesanbischof mit dem Recht der Nachfolge zur Seite gestellt wird.254 Diese Regelung des Hl. Stuhls für die DDR stellte einen Koadjutor nun einem Auxiliarbischof, der als Kommissar tätig war, bei und beschrieb damit ein kirchenrechtliches Novum. Für diesen „para-kanonischen Koadjutor“ wurde die Bezeichnung „Adjutor oder Adjutorbischof“ gebraucht.255 Mit der geplanten Einsetzung durch Rom konnte man die Schwierigkeit umgehen, dass die Adjutorbischöfe für Paderborn und Osnabrück ernannt werden müssten und damit als „westliche Beauftragte angesehen und möglicherweise in ihrer Amtsführung behindert“256 würden. Kardinal Bengsch hatte sich unmittelbar vor der Entscheidung des Heiligen Stuhls zugunsten einer solchen Adjutorreglung in Rom erfolgreich eingesetzt. Er drängte in seinem kirchenpolitischen Bericht für Rom am 2. Mai 1969 darauf, dass „die vorgesehenen Nachfolger sobald als möglich den jetzt noch im Amt befindlichen Jurisdiktionsträgern als Titularbischöfe zur Hilfe an die Seite gegeben werden...“257 Denn er fürchtete für den Fall einer plötzlichen Vakanz, dass „von Seiten der Ost-CDU und auch von Seiten ‚progressiver’ katholischer Kreise Kandidaten genannt und hochgespielt werden, die für die Kirche nicht akzeptabel sind.“258 Darüber hinaus wollte er vorbereitet sein, sollte der Staat seine seit Jahren wiederholte Drohung wahr machen und einen von Westdeutschland ernannten Nachfolger boykottieren.
Während einer Sitzung des Hauptausschusses der Deutschen Bischofskonferenz wurden Kardinal Jaeger die massiven kirchenpolitischen Probleme verdeutlicht, die bei einer erneuten Entsendung eines westdeutschen Weihbischofs in die DDR im Falle einer Nachfolgeregelung zu befürchten stünden.259 Mutmaßlich auf einer weiteren Konferenz der beteiligten westdeutschen Bischöfe mit Kardinal Bengsch am 3. Juli 1969 in Westberlin ließ er sich schließlich davon überzeugen260, dass man durch die von Rom vorzunehmende Einsetzung von Adjutorbischöfen einen Schlussstrich unter die bisherige innerkirchliche Entwicklung ziehen könne.261
Die Suche nach geeigneten Nachfolgekandidaten für die amtierenden Kommissare gestaltete sich höchst unterschiedlich. Da man sich auf eine jurisdiktionelle Zusammenlegung der Kommissariate in Meiningen und Erfurt unter der Leitung von Weihbischof Hugo Aufderbeck verständigt hatte, mussten nur Kandidaten für Schwerin und Magdeburg gefunden werden. Als Nachfolger für den Schweriner Kommissar Weihbischof Schräder262 konnte man sich schnell auf einen Namen einigen. Den Wünschen des Osnabrücker Bischofs und des Schweriner Klerus entsprechend, wurde der Berliner Weihbischof Heinrich Theissing263 als Nachfolger nominiert264; Alfred Bengsch ließ ihn ohne Widerstand ziehen. Für Magdeburg wurde der zweite Weihbischof des Erzbistums Paderborn Paul Nordhues265 vorgeschlagen.266 1941 zum Priester geweiht, übernahm Nordhues nach mehreren Vikariatsstellen in der sowjetischen Besatzungszone 1952 die Stelle des Subregens im Paderborner Priesterseminar und leitete von 1957 bis 1961 als Regens das Priesterseminar auf der Huysburg in der DDR.267 Seine Ernennung zum Titularbischof von Cos und Weihbischof von Paderborn machte 1961 die offizielle Aussiedlung aus der DDR notwendig.268 Paul Nordhues war mit der Situation im SED-Staat durchaus vertraut und mit vielen Priestern und Katholiken im Erzbischöflichen Kommissariat und darüber hinaus bekannt.269 Auch nach seiner Ernennung zum Paderborner Weihbischof pflegte er als Bischofsvikar für die Diözesancaritas enge Kontakte zur Caritas in der DDR und besuchte sie, eingeschleust unter der Berufsbezeichnung „Sozialarbeiter“, mehrfach.270 Seine zahlreichen Aufenthalte, die langjährigen Erfahrungen in der DDR, seine Bekanntheit und nicht zuletzt die Tatsache, dass er bereits zum Bischof geweiht war und insofern eine schnelle Lösung ermöglichte, dürften ihn als Nachfolger für das Amt des Erzbischöflichen Kommissars in Magdeburg in besonderer Weise prädestiniert haben.271
Die Quellenaussagen zum Initiator dieser Nominierung sind widersprüchlich.272 In kirchlichen Kreisen nannten Otto Groß und Alfred Bengsch stets den Paderborner Erzbischof Kardinal Jaeger als verantwortlichen Impulsgeber.273 Erstaunlicherweise ist der Name Paul Nordhues gegenüber geheimpolizeilichen Stellen in der DDR schon vorher als möglicher Nachfolger ins Gespräch gebracht worden. Prälat Groß erwähnte gegenüber dem MfS, dass Kardinal Bengsch bereits im Jahr 1968 die Überlegung betrieben habe, den ehemaligen Rektor des Priesterseminars auf der Huysburg in Magdeburg als Kommissar einzusetzen.274 Belegt ist, dass es Alfred Bengsch persönlich war und nicht Lorenz Jaeger, der bei Weihbischof Nordhues angefragt hatte, ob er bereit wäre, nach Magdeburg zu gehen.275 Außerdem hatte Weihbischof Nordhues wiederholt seine Bereitschaft gegenüber Erzbischof Bengsch bekundet, eine endgültige Entscheidung jedoch von der noch einzuholenden Zustimmung Kardinal Jaegers abhängig gemacht, die er nicht vor Juli 1969 erwartete.276 Schließlich verweigerte der Apostolische Nuntius seine Unterstützung für die Berliner Pläne277 mit der Begründung, dass er es für kirchenrechtlich unzulässig halte, wenn nicht der zuständige Paderborner Erzbischof, sondern Kardinal Bengsch eine Nachfolgeregelung forciere.278 Aufgrund der beschriebenen Vorgänge erscheint es folgerichtig, dass die Absicht und die Pläne zur Ernennung von Paul Nordhues ihren Ursprung an der Spree hatten und Kardinal Jaeger hierüber erst nachträglich informiert wurde. Alfred Bengsch hat nicht nur inoffiziell gegen Rintelen, sondern auch für Nordhues bei Nuntius Bafile interveniert. Aufgrund der mündlich erklärten Bereitschaft des von Bengsch favorisierten Nachfolgers wandte sich der Berliner Kardinal über Prälat Groß an die zuständigen staatlichen Stellen in der DDR, um die Frage der Wiedereinbürgerung von Paul Nordhues zu eruieren.279 Er war aufgrund seiner Ernennung zum Paderborner Weihbischof 1961 legal in die Bundesrepublik verzogen und deshalb ausgebürgert worden. Groß erhielt von Seiten der DDR die Zusage, dass man Weihbischof Nordhues „auf dem Wege der Familienzusammenführung über die Liste, die die Rechtsanwälte Vogel und Stange einreichen, hereinlassen“280 würde. Die DDR legte dabei großen Wert darauf, dass diese Angelegenheit aufgrund „ihres delikaten gesamtdeutschen Charakters (Paderborn-Magdeburg) absolut vertraulich und diskret behandelt werden“281 müsse. Die Pläne zur Nachfolge waren so geheim, dass selbst der davon unmittelbar Betroffene und noch amtierende Kommissar Friedrich Maria Rintelen nichts wusste. Diese Geheimpolitik sollte nicht zu unterschätzende Folgen haben.
Über den prinzipiellen Schwebezustand, in dem sich die Kommissare in der DDR befanden, war Weihbischof Rintelen voll im Bilde.282 Zudem war ihm die kirchenrechtliche Norm hinsichtlich der Emeritierung von Auxiliarbischöfen bewusst. Gegenüber der Berliner Ordinarienkonferenz und gegenüber Kardinal Jaeger hatte Rintelen deshalb verschiedentlich angedeutet, dass er „mit Erreichen des 70. Lebensjahres die Leitung des Kommissariates niederlegen“283 würde. Auf die konkrete Anfrage Kardinal Jaegers über seine Zukunftsvorstellungen im Juni 1969 erwiderte Rintelen intern, dass er „nicht böse sein würde, wenn ich bald der Last und Verantwortung meines Amtes ledig würde.“284 Öffentlich hielt Rintelen allerdings daran fest, dass er auch mit 70 Jahren und darüber hinaus sein Amt ausüben wolle, da er körperlich in guter Verfassung sei.285 Aufkommende Gerüchte über eine Nachfolgeregelung dementierte er offensichtlich in Unkenntnis der tatsächlichen Pläne.286 Zugleich informierte Rintelen seinen Paderborner Erzbischof von den verschiedenen Anfragen sowie seiner Reaktion darauf und bemerkte: „Ich nehme an, dass du diesen Brief mit solchem Schmunzeln liest wie ich ihn schreibe.“287 Doch noch bevor dieser Brief in Paderborn eintraf, setzte Kardinal Jaeger seinerseits den noch amtierenden Kommissar mit den Absichten für die Regelung seiner Nachfolge schriftlich ins Benehmen.288 Der Erzbischof schlug deshalb vor, Rintelen möge für ein klärendes Gespräch nach Paderborn kommen oder, sollte er keine Reisegenehmigung bekommen, eine schriftliche Stellungnahme für den Nuntius fixieren.289 Unmittelbar darauf verfasste Rintelen ein Antwortschreiben, in dem er seine Überraschung über diese Vorgänge zum Ausdruck brachte.290 Anfang Juli 1969 fuhr Weihbischof Rintelen nach Paderborn und wurde von Nuntius Bafile und Erzbischof Jaeger über den Ablauf seiner Emeritierung informiert.291 Für die Gründung des späteren Aktionskreises Halle sind die Entwicklungen unmittelbar nach der Rückkehr von Weihbischof Rintelen aus Paderborn am 14. Juli 1969 von entscheidender Bedeutung. Entgegen einer vereinbarten oder zumindest vorausgesetzten Geheimhaltung der Vorgänge und Pläne äußerte sich Rintelen gegenüber dem Hallenser Propst Dr. Langsch zu den geheimen Planungen für seine Nachfolge.292 Gegenüber engen Vertrauten machte er „kein Hehl aus seiner Niedergeschlagenheit.“293 Mit der Enthüllung der hinter seinem Rücken betriebenen Absetzungspläne löste der desavouierte Weihbischof eine Bewegung aus, deren Konsequenzen er weder überblickt noch intendiert haben dürfte.
Die Mitglieder des Magdeburger Presbyteriums erhielten an den darauffolgenden Tagen Kenntnis von den Vorgängen um Weihbischof Rintelen und einzelne Mitglieder des Priesterrates fuhren selbst nach Magdeburg, um sich die Informationen aus erster Hand bestätigen zu lassen.294 Diese Mitteilungen gegenüber engen Vertrauten und Vertretern des Presbyteriums reichten aus, um binnen kürzester Zeit Solidarisierungsbekundungen und spontane Treffen hervorzurufen.295 Der Magdeburger Priesterrat hatte aufgrund dieser Neuigkeiten zu einer außerordentlichen Sitzung für den 22. Juli eingeladen.296 Doch einer Gruppe von Priestern vorwiegend aus dem Hallenser Raum erschien es zudem nötig, den frühestmöglichen Termin für eine Vollversammlung des Presbyteriums zu wählen, um nicht durch ein zwischenzeitliches Bekanntwerden des neuen Koadjutors den Eindruck zu erwecken, dass man sich gegen ihn formiere.297 Trotz Urlaubszeit und einer nur 24stündigen Einladungsfrist, erschienen am darauffolgenden Samstag, den 19. Juli, etwa 80 der insgesamt über 300 Magdeburger Priester, „alle nicht außer Landes weilende Mitarbeiter des Seelsorgeamtes, der Akademikerseelsorge, der Magdeburger Studentenpfarrer, der Diözesancaritasdirektor“298 sowie die beiden Pröpste von Halle und Magdeburg, die Paderborner Domkapitulare waren.299 Auf dem Treffen wurden durch den Sekretär des Priesterrates Wolfgang Simon die im Umlauf befindlichen Informationen zur Causa Rintelen bestätigt und ein Leitungsgremium, bestehend aus Theo Steinhoff, Claus Herold und Willi Verstege, per Akklamation gewählt, das die Sitzung leiten und koordinieren sollte.300 Auf der Versammlung war zudem ein Vertreter der katholischen Akademikerarbeit im Kommissariat erschienen und hatte eine von Laien verfasste Protestnote verlesen.301 Nach einer ausführlichen Debatte verabschiedete man eine Erklärung, die an Papst Paul VI., Kardinal Jaeger, Kardinal Bengsch und Weihbischof Rintelen gerichtet war und die zunächst 72 der 77 anwesenden Priester unterzeichneten, später zählte die Protestnote insgesamt 155 Unterschriften: