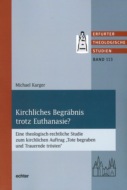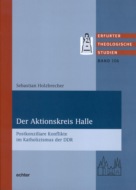Kitabı oku: «Der Aktionskreis Halle», sayfa 8
3.Konstituierung und Konsolidierung
Die Bischofsweihe von Johannes Braun hätte das Ende der Hallenser Protestbewegung bedeuten können. Doch die zunächst noch lose assoziierte Gruppe formierte sich kurz vor der Einführung des neuen Magdeburger Weihbischofs und avancierte bis 1989 zu einer festen, aber nicht unumstrittenen Institution im Katholizismus der DDR. Welche Ziele und Forderungen dabei verfolgt wurden, wie sich die Gruppe zusammensetzte, organisierte und welche Themen in den Rundbriefen und Vollversammlungen debattiert wurden, soll im Folgenden dargestellt und auf eine mögliche Konzilsrezeption hin befragt werden.
3.1Selbstverständnis, Ziele, Forderungen
Historisch greifbar äußert sich das Selbstverständnis des AKH in zentralen Erklärungen, die durch Abstimmungsprozesse legitimiert sind. Als Grundlagendokumente des Aktionskreises lassen sich der Protestbrief an den Papst im Juli 1969460, der Nienburger Tagungsbericht aus dem Herbst 1969461, eine Erklärung vom 14. März 1970 zur Bischofswahl462 sowie die verschiedentlich aktualisierte Grundsatzerklärung463 und Ordnung464 des Aktionskreises bestimmen. Das Proprium der Gemeinschaft, ihre Ziele und Forderungen werden darin ebenso fixiert wie die Grundlagen der Zusammenarbeit.
Die Einforderung von mehr innerkirchlicher Mitverantwortung aus dem Geist des Konzils ist das zentrale Motiv der Gründung des AKH und für seine Identität von essentieller Bedeutung. Die Magdeburger Priester und Laien proklamierten mit ihrer Protestnote an den Papst 1969 nicht nur größere Beteiligungsrechte bei der anstehenden Bischofsernennung.465 Mit der Legitimierung des Anspruchs aus der Volk-Gottes-Ekklesiologie heraus ordneten sie sich in eine innerkirchliche „Suchbewegung“466 ein, die nach der authentischen Interpretation und Rezeption von Geist und Buchstabe des Konzils fragte. Von Beginn an verstand sich der Aktionskreis Halle als selbstständige „Impulsgruppe und Arbeitsgemeinschaft von katholischen Christen (Priestern und Laien) im Kommissariat Magdeburg, [die] an der Erneuerung der Kirche im Sinne der beschlossenen Grundsatzerklärung mitwirken [wollte].“467 Obgleich er sich bewusst nicht in die kanonischen Kategorien des kirchlichen Vereinsrechts einordnete, interpretierte die Gruppe ihre Arbeit ausdrücklich „als legitime Form kirchlichen Lebens“468 und insistierte dabei auf den theologisch gerechtfertigten Zusammenschluss getaufter Christen und auf die Notwendigkeit innerkirchlicher Pluralität.469 Dabei rezipierte sie vor allem die zeitgleichen Erklärungen Karl Rahners zu den Möglichkeiten und Chancen von Priestergruppen.470 Sein Selbstverständnis als „Impulsgruppe und Aktionsgemeinschaft“471 bekräftigte der AKH mehrfach, wobei die territoriale Fokussierung auf das Kommissariat Magdeburg ab 1972 zugunsten einer Orientierung auf das Gebiet der gesamten DDR ausgeweitet wurde.472 Eine Reduzierung des AKH auf eine bloß personell aufgestockte „Korrespondenzgruppe“ oder eine über die Studienzeit hinaus erstarkte Hallenser Studentengemeinde wird dem Selbstverständnis der verschiedenen Gruppen kaum gerecht.473 Vielmehr handelt es sich beim Aktionskreis Halle um eine neue Gruppierung, die zwar auf bestehenden Erfahrungen und personellen Netzwerken aufbauen konnte, die sich aber im Mitgliederprofil, ihrer Struktur, Größe, Arbeit und Zielsetzung von den Vorläufern deutlich unterschied. Obgleich der AKH jedwede Exklusivität ablehnte, „weil sie die Einheit der Kirche sprengt und ihre Offenheit zur Welt gefährdet“474, formte die überwiegend akademische Herkunft seiner Mitglieder die Gruppe maßgeblich. Ob er sich selbst als „Avantgarde“475 verstand, ihm dieses Bewusstsein zugeschrieben oder es nur von einzelen Mitgliedern gepflegt wurde, bleibt offen. Von Anfang an verstand sich der Aktionskreis nicht als „unverbindliche Freizeitbeschäftigung, die man betreibt, wenn man gerade Lust dazu hat, wenn man wieder einmal die Nase voll hat von einsamen kirchenamtlichen Entscheidungen.“476 Auch wollte er kein Auffangbecken für frustrierte Katholiken und kirchliche „Revoluzzer“477 sein.478 Obgleich er dies in bestimmter Hinsicht doch auch war, blieb sein programmatisches Interesse und Selbstverständnis auf „Veränderungen in der Kirche der DDR“479 ausgerichtet. Indem sich der Aktionskreis Halle für jene katholischen Priester in der DDR einsetzte, die infolge von Laisierungsverfahren geistlicher und finanzieller Unterstützung bedurften - der AKH richtete ein eigenes Konto ein, von dem die sogenannten „Priester ohne Amt“ (PoA) finanzielle Hilfen bekamen - drückte sich ein diakonaler Aspekt seiner Tätigkeit aus.
Fünf Jahre nach seiner Gründung modifizierte der Aktionskreis seine Grundsatzerklärung erstmals.480 Nun verstand er sich wesentlich offener als „Gruppe von Christen, die Fragen und Entwicklungen in der Kirche offenhalten wollen“; als „Gruppe, die sich um Information bemüht und Informationen weitergibt, damit Offenheit möglich wird“; als „Ort, wo man sich trifft. Unsere Versammlungen sollen Kommunikation ermöglichen, Vertrauen schaffen und Mut machen.“481 Markant hält der Kreis dazu fest: „Der AKH ist keine Lebensgemeinschaft, aber mehr als eine Arbeitsgemeinschaft, die im Unverbindlichen bleibt.“482 Eine interne Mitgliederbefragung im Jahr 1977 ergab zudem, dass die Mitarbeiter den Aktionskreis „vorwiegend als Ort der Begegnung bzw. sachbezogene Gruppe“483 sahen und sich selbst in der Rolle innerkirchlicher Aktivisten wahrnahmen. Der gezielte „Tabubruch“ war nach Aussage dieser Umfrage im Selbstverständnis der Gruppe tief verwurzelt.484 Wohl unter dem Einfluss der ökumenischen Friedensbewegung weitete sich in den 80er Jahren das Selbstverständnis der Gruppe nochmals. Der AKH wollte nun „keine fest umschriebene Gruppe“ sein, sondern als „Ort der Bruderschaft, der Einübung von Gemeinschaft und Spiritualität; Ort der Ökumene, also als Teil der christlichen Kirche über alle Konfessionsgrenzen hinaus; Ort des Lernens, der Einübung in Friedensdienst, in Solidarität mit den Völkern der Dritten Welt, in ökologisches Bewusstsein, in tranzendierendes Denken.“485 Von diesem vor allem ökumenisch und gesellschaftspolitisch motivierten Selbstverständnis ließ sich die Gruppe bis zum Ende der DDR in ihren Aktionen und Erklärungen leiten.486
Die postkonziliare Reform der Kirche, verstanden als die pastorale Anpassung von kirchlichen Strukturen und Ausdrucksformen des Glaubens an die konkreten „Anforderungen unserer Zeit“487, war das eigentliche Ziel des AKH.488 Eine in staatlichen Quellen verzeichnete Metapher formuliert dies prägnant: Ziel des Hallenser Aktionskreises ist es, das vom „Papst und vom Konzil in die Welt hinein geöffnete Fenster“ offen zu halten.489 Die Arbeit des AKH könne deshalb als „der Versuch einer Übersetzungsarbeit katholischen Denkens und Lebens heute und für heute“490 gesehen werden. Von diesem Ziel leitete man verschiedene Ansprüche ab.
Bereits die Grundsatzerklärung von 1970 proklamierte die „Demokratisierung und Humanisierung der Kirche sowie die Interpretation des Glaubens“491 als zentrale Forderungen des AKH. Es ist bezeichnend, dass alle drei Forderungen wortwörtliche Zitate der Dokumentation über die westdeutschen Priestergruppen sind.492 Verschiedene Aspekte, vor allem aber die zu befürchtenden strafrechtlichen Konsequenzen des DDR-Staates bei einer derart offensichtlichen Verbindung zu bundesdeutschen Gruppen, ließen den AKH von einer ausdrücklichen Kennzeichnung dieser Passagen als Zitate Abstand nehmen.493 Die Übernahme der bundesdeutschen Schlagworttrias unterstrich sehr deutlich die Identifikation mit den dort getroffenen Aussagen und Forderungen. Auch in der DDR müsse die Kirche demnach „eine Gemeinschaft freier Menschen werden, die die gemeinsamen Angelegenheiten sachlich, öffentlich und verantwortlich miteinander entscheiden.“494 Kirche demokratisch umgestalten hieße, sie auf die „Grundlage gemeinsamer Verantwortung“495 zu stellen und jeden Christen einzuladen, sich in die Entscheidungsprozesse in Gemeinde, Diözese und Gesamtkirche einzubringen.496 Sowohl die SOG-Gruppen als auch der AKH sprachen von einer „theologisch legitimen Demokratisierung“ und einer analogen Verwendung des politisch konnotierten Begriffs im kirchlichen Bereich.497 Darunter verstanden sie die öffentliche Bewusstseins- und Meinungsbildung in der Kirche, Freiheit der Meinungsäußerung, ungehinderten Informationsfluss, Durchsichtigkeit der Verwaltungsvorgänge sowie Mitwirkung und Kontrolle bei Entscheidungen der Kirchenleitung.498 Dass diese Forderungen nach einer größeren Mitverantwortung offensichtliche Parallelen zu Formulierungen der umstrittenen Meißner Synode in der DDR aufwiesen, dürfte die bischöfliche Skepsis gegenüber dem sich konstituierenden AKH kaum verringert haben.499 Mit dem Schlagwort „Humanisierung“500 sollte die Forderung nach einem menschlicheren Umgang in der Kirche ausgedrückt werden.501 Die Kirche müsse „eine Gruppe in der Gesellschaft sein, in der man einander achtet und als Menschen ernst nimmt.“502 Der AKH vertrat keinen politisch motivierten oder säkular verstandenen Humanismus.503 Humanisierung wurde als genuin christliche Forderung betrachtet, zu der der Glaube an die Inkarnation Gottes in Jesus Christus aufrufe. Aufgrund seiner Vieldeutigkeit hatte dieser Begriff „schillernde Faszination und ... werbende Kraft“504 und wirkte daher identitätsstiftend.505 Schließlich forderte der Aktionskreis drittens die Interpretation des Glaubens506 als jenen Prozess, bei dem sich die Kirche darum bemühen müsse, „die Sache Jesu zu verstehen und verständlich zu machen.“507 Auch diese Forderung übernahm der AKH von westdeutschen Gruppen.508 Aus der Grundsatzerklärung geht allerdings nicht hervor, was man unter der Interpretation des Glaubens und der Sache Jesu konkret verstand, sodass es nicht leichtfiel, diese Formel adäquat zu dechiffrieren.509 Aus dem weiteren Wirken des Aktionskreises könnte geschlossen werden, dass man unter einer Interpretation des Glaubens eine Kontextualisierung bzw. Inkulturation des Glaubens in die DDR-Wirklichkeit verstand.
Offenbar war die Situation des Katholizismus in Ost- und Westdeutschland zum damaligen Zeitpunkt derart kompatibel, dass es dem AKH legitim erschien, die bundesdeutsche Zeitdiagnostik auch für die ostdeutsche Wirklichkeit zu verwenden: „In dieser Situation kann uns niemand Mitverantwortung und Mitschuld abnehmen. Angesichts der Macht festgefahrener Strukturen und Apparate soll unsere Solidarisierung dem notwendigen Bewusstseins- und Strukturwechsel dienen.“510 Mit dem westdeutschen Text der AGP-Erklärung konstatierte der AKH, dass die Kirche trotz der konziliaren Aufbruchsbewegung das „bleibende, für die Zukunft aufschließende Wort schuldig“511 bleibe und sich nur „zögernd, ängstlich, einfallslos und misstrauisch“512 engagiere.513 Zahlreiche Neuansätze und zeitgemäße Gestaltungsformen einer christlichen Existenz würden als Gefahr für die Einheit der Kirche verdächtigt. „Offene Diskussionen [würden S.H.]... als Pressionsversuch, Eigenmächtigkeit und Ungehorsam diffamiert.“514 Darüber hinaus übernahm der AKH für seine Ausführungen das sendungstheologische Kirchenbild der AGP Grundsatzerklärung und betonte mit ihr: Aufgabe der Kirche ist es, „die Botschaft Jesu Christi von der kommenden Herrschaft Gottes so weiterzusagen, dass die Sache Jesu – Glaube, Hoffnung, Versöhnung, Befreiung und Friede – in unserer Welt wirksam wird.“515 Dies könne die Kirche aber nur, wenn sie sich entsprechend der „Anforderungen unserer Zeit“516 verändert. Die hier angedeutete Nähe zu den „Zeichen der Zeit“517 von Gaudium et spes dürfte nicht zufällig als Legitimationshorizont gewählt worden sein, entstammte jedoch ebenfalls der bundesdeutschen Textvorlage.518 Obgleich die Hallenser Grundsatzerklärung fast ausschließlich aus Fragmenten der westdeutschen Vorlagen besteht, fand zugleich ein auffallender Selektionsprozess statt. Im Gegensatz zum Originaltext der AGP wurde auf die Nennung verschiedener, vor allem politisch konnotierter Konfliktfelder verzichtet: Bevölkerungswachstum, verantworteter Einsatz technologischer Mittel, die internationale Rüstungsmaschinerie und der Einfluss von politischen Systemen auf den Frieden.519 Darüber hinaus machte sich der AKH nicht die Forderung zu eigen, die Kirche möge die Freiheitsrechte aufnehmen, die im staatlichen Bereich in den letzten zweihundert Jahren Einzug gehalten haben; im Bewusstsein des engen politischen Spielraums in der DDR erhoben sie auch nicht den Anspruch, dass die Kirche gegen totalitäre Systeme einschreiten müsse.520
Hinsichtlich des Selbstverständnisses, der Ziele und Forderungen des AKH zeichnet sich ein dreifacher Bezugsrahmen ab. Das II. Vatikanum fungierte als der entscheidende materielle Impulsgeber der Hallenser Basisgruppe. Forderungen nach einem deutlicher akzentuierten Weltdienst der Kirche, einer größeren Mitverantwortung von Priestern und Laien bei kirchlichen Personalentscheidungen und anderen zentralen Lebensvollzügen waren ebenso an die Aussagen und den Geist des Konzils rückgebunden wie die stärkere Wahrnehmung des gemeinschaftlichen Laienapostolates, das sich in der Gründung einer christlichen Vereinigung aus Priestern und Laien ausdrückte. Die bundesdeutsche Arbeitsgemeinschaft der Priester- und Solidaritätsgruppen stellte den formalen Rahmen eines innerkirchlichen Zusammenschlusses bereit, auf den der AKH selektiv zurückgriff. Den Konzilserklärungen und dem bundesdeutschen Vorbild folgend, emanzipierte sich der AKH vom Modell der „Katholischen Aktion“ und formierte sich praeter legem als kirchliche Vereinigung ohne klerikale Leitung. Grundlegend für alle Reformen und Initiativen war allerdings die besondere kirchliche Situation in einer sozialistischen Diktatur. Die Übernahme der drei Schlagwortforderungen durch den AKH stellte daher keine bloße Kopie westdeutscher Erklärungen dar. Es muss vielmehr als eigene Leistung gewürdigt werden, diese Forderungen angesichts der ostdeutschen Situation eines totalitären Staates artikuliert zu haben. Das Eintreten für innerkirchliche Reformen und ein größeres gesellschaftliches Engagement der Kirche verlangte in der DDR aufgrund der latenten staatlichen Vereinnahmungsund Differenzierungstendenzen eine hohe Sensibilität und eine im Vergleich zu den bundesdeutschen Gruppen stärker ausgeprägte Risikobereitschaft. Wie die Geschichte des AKH eindrücklich vor Augen stellt, konnte die programmatische Distanz zum kirchenpolitischen Kurs der ostdeutschen Bischöfe leicht existentielle Konsequenzen nach sich ziehen.
3.2Strukturen, Mitglieder, Verbindungen
Aus der Organisation und dem Mitgliederprofil lässt sich ablesen, dass es sich beim AKH um eine neue Form des Zusammenschlusses von katholischen Christen in der DDR handelte, die nicht dem kirchlich präferierten Modell der „Katholischen Aktion“ folgte.
Bereits seit den ersten Treffen im Sommer und Herbst 1969 sind als Strukturen organisierte Versammlungen und ein moderierendes Gremium nachweisbar.521 Die Ordnung des AKH von 1970 definierte als feste Institution quartalsweise abzuhaltende „Vollversammlungen“522. Diese zentralen Dialogveranstaltungen sollten von einem demokratisch gewählten und paritätisch von Priestern und Laien zu besetzenden „Sprecherkreis“523 vorbereitet und geleitet werden.524 Diesem Sprecherkreis kam neben der thematischen Vorbereitung der regelmäßigen Treffen auch die Erstellung des AKH-Rundbriefes zu.525 Hierzu traf er sich regelmäßig zwischen den Vollversammlungen zu abendlichen Besprechungen und spätestens ab 1976 auch einmal jährlich zu einer Klausurtagung.526 Mit dieser koordinierenden und ideenreichen Vorarbeit präfigurierte der Sprecherkreis im Wesentlichen die thematische Orientierung des Aktionskreises.527 Seine Positionen wurden allerdings erst durch die Vollversammlung verbindlich beschlossen. Die Ordnung des AKH sah zudem die Bildung von regionalen oder thematischen Arbeitsgruppen „zur Erledigung ständiger oder einzelner Aufgaben“528 vor. Unter anderem gab es diakonisch orientierte Arbeitsgruppen zu den Themen Hilfe für Familien mit behinderten Kindern529, Seniorenseelsorge530 und Abtreibungsgesetzgebung531. Daneben organisierten sich Arbeitsgruppen für exegetische, theologische und soziologische Fragestellungen.532 Diese Gruppen waren unterschiedlich groß und bestanden unterschiedlich lange. Nicht selten bedeutete das Erstellen einer thematischen Abschlusserklärung als Empfehlung an die AKH-Vollversammlung auch das faktische Ende der AG. Freiwillige Spenden der Mitglieder und Informationsempfänger finanzierten die Arbeit des AKH.533 Hatte der Aktionskreis bereits bei seiner Grundsatzerklärung deutliche Anleihen bei den bundesdeutschen Formulierungen der AGP gemacht, so lässt sich dieser Adaptionsprozess auch bei der Ausdifferenzierung seiner Struktur und Organisation beobachten. Sowohl die Aufnahmekriterien als auch die Strukturen und Organe bezog der AKH in teils nur marginal abgewandelter Form von der Satzung der Arbeitsgemeinschaft bundesdeutscher Priestergruppen.534 Als bedeutender Unterschied ist jedoch auf die ausgeprägte Gleichberechtigung von Priestern und Laien zu verweisen. Die Priestergruppen in Westdeutschland und ihr Dachverband öffneten sich erst sukzessive für eine Laienbeteiligung.535 Demgegenüber kann es als ein Alleinstellungsmerkmal des Hallenser Aktionskreises gelten, dass er von Anfang an aus Priestern und Laien bestand, die gleichberechtigt im Sprecherkreis als seinem Exekutivgremium vertreten waren.
Für den AKH sind drei grundlegende Personengruppen zu unterscheiden: eingeschriebene Mitarbeiter des AKH; Sympathisanten, die überwiegend als Gäste der Vollversammlungen in Erscheinung traten; Empfänger der Rundbriefe.536 Mitarbeiter konnte werden, wer durch seine Unterschrift verbindlich die Bereitschaft erklärte, die Ziele der Grundsatzerklärung mitzuverfolgen.537 Zunächst beschränkte die Geschäftsordnung die Teilnahme nur auf Katholiken mit ständigem Wohnsitz in der DDR.538 Diese Limitierungen wurden jedoch in den darauffolgenden Jahren zugunsten einer ökumenischen Öffnung weitgehend fallen gelassen. Gäste waren von Beginn an ausdrücklich erwünscht, verstand man sich doch als Kommunikationsplattform für einen möglichst breiten innerkirchlichen Dialog.539 Diese explizite Offenheit gehörte zwar zum Selbstverständnis der Gruppe, hatte aber angesichts des totalitären Überwachungsstaates der DDR durchaus ambivalente Implikationen.540 Der Vorwurf einer Zweiklassengesellschaft im AKH lässt sich aus den Quellen nicht bestätigen. Zwar entwickelte sich nach einiger Zeit der Modus, dass sich am Vorabend von Vollversammlungen die eingeschriebenen Miglieder des Aktionskreises trafen, um Interna zu besprechen. Dass allerdings auf der anschließenden Vollversammlung nur noch abgestimmt wurde, was ohnehin schon intern entschieden worden war, lässt sich nicht nachvollziehen. Zudem unterschieden sich die Rechte von Mitarbeitern und Sympathisanten nur hinsichtlich eines qualifizierten Stimmrechts, der Wahrnehmung eines Mandats im Sprecherkreis und der Teilnahme an internen Sitzungen.541 Die Rundbriefe konnte beziehen, wer dies schriftlich oder mündlich beim AKH anmeldete, wobei die ostdeutschen Bischöfe passive Empfänger der Rundbriefe waren, die ihnen unaufgefordert zur Verfügung gestellt wurden.
Eine quantitative Betrachtung des AKH ergibt, dass die Gruppe keine fest umschriebene oder starre Institution war. Vielmehr lassen sich vor allem 1969/70 erhebliche personelle Fluktuationen beobachten. Während die erste Protestkundgebung vom 19. Juli 1969 zunächst 130542 und später gar 155543 Unterzeichner der Note an den Papst und die Kardinäle aufwies, nahmen am Nienburger Treffen am 27. September 1969 lediglich 29, an der Versammlung am 14. März 1970 immerhin 75 und an der konstituierenden Gründungsvollversammlung des AKH 53544 Personen teil.545 Offensichtlich hatten die Arbeitsweise und das Vorgehen des sich formierenden AKH nicht wenige Sympathisanten der ersten Stunde Distanz suchen lassen.546 In diesem Zusammenhang gewinnen die Zahl und der Kreis der Empfänger der AKH-Rundbriefe an Bedeutung. Waren es im Gründungsjahr 1970 noch 109547 Informationsempfänger, so stieg ihre Zahl bereits 1974 auf 309548, 1975 auf 338549 und sank im Jahr 1977 auf 270550. Ob sich diese Zahlen in den 80er Jahren wesentlich verändert haben, ist nicht überliefert. Da in den Quellen des AKH vereinzelt äußerst detaillierte Adresslisten erhalten geblieben sind, kann eruiert werden, wie sich der Empfängerkreis der Briefsendungen zusammensetzte.551 Vermutlich hatte es ein 1982 vom MfS geplanter Einbruch in das Nienburger Pfarrhaus auf genau diese Listen abgesehen.552 Eine exemplarische Aufschlüsselung der 309 Briefempfänger für das Jahr 1974 zeigt, dass 66 Mitglieder des Aktionskreises, 122 Empfänger im Bischöflichen Amt Magdeburg (BAM), 109 innerhalb der DDR und 12 Personen in der Bundesrepublik die Briefe erhalten haben.553 Eine noch detailliertere Empfängerliste aus dem Jahr 1977 lässt weitere Schlüsse zu. Zunächst kann für den Zeitraum, in dem diese Liste verbindlich war, und dieser dürfte sich wohl über das Jahr 1977 hinaus erstreckt haben, festgehalten werden, dass die AKH-Rundbriefe in alle ostdeutschen Bistümer und Jurisdiktionsgebiete verschickt wurden.554 Im Bischöflichen Amt Magdeburg erhielten nicht nur die 69 Mitglieder des AKH, sondern noch weitere 45 Laien und 43 Priester sowie die beiden Bischöfe den Rundbrief.555 DDR-weit erhielten weitere 37 Priester556, 41 Laien557 sowie Bischof Aufderbeck558 die Rundbriefe. In der Bundesrepublik gingen die AKH-Rundbriefe unter anderem an Hubertus Halbfas559 und Klemens Richter560 sowie an Empfänger in München, Dortmund, Münster, Essen, Bochum, Karlsruhe.561 Zwar wird man aus der Anzahl der Briefempfänger nicht leichthin weitere Sympathisanten extrapolieren können. Eher dürfte die in der DDR dauerhaft unbefriedigende Informationsversorgung für die Bestellung der AKH-Informationen mit ausschlaggebend gewesen sein. Dennoch ist festzuhalten, dass nicht nur verschiedene Professoren des Erfurter Theologisch-Philosophischen Studiums die Rundbriefe von Anfang an erhielten (H. Schürmann, W. Ernst, B. Löwenberg, L. Ullrich, G. Hentschel, K. Feiereis)562, sondern auch ein Kreis von Personen an innerkirchlichen Schlüsselpositionen (u.a. Dieter Grande, Dr. Werner Becker, Dr. Wolfgang Trilling, Gerhard Lange563). Der Grad der Verbreitung dieser für die ostdeutsche Kirche offensichtlich nicht unbedeutenden theologischen Informationsquelle ist daher wesentlich größer einzuschätzen, als es die regionale Verortung anhand des Namens und die innerkirchliche Stigmatisierung als „Nestbeschmutzer“ vermuten lässt.
Ausgehend von den durch den Aktionskreis selbst überlieferten Anwesenheitslisten der Vollversammlungen ergibt sich eine durchschnittliche Teilnehmerzahl von ca. 45 Personen.564 Die 5. Vollversammlung 1971 wies mit 76 Teilnehmern die größte, die 16. Vollversammlung 1974 mit nur 21 Personen die geringste Beteiligung auf.565 Die akademische Herkunft der meisten Mitglieder und Sympathisanten wurde nur vereinzelt aufgebrochen.566 Detaillierte Informationen über die tatsächliche Mitgliederstärke des Aktionskreises sind nicht für den gesamten Zeitraum überliefert. Vermutlich ist hierfür die staatliche Observation durch das Ministerium für Staatssicherheit mitverantwortlich, konnten derartige Informationen doch leicht zu einem veritablen Sicherheitsrisiko avancieren. Anfang 1971 hatte der Aktionskreis insgesamt 72 eingeschriebene Mitarbeiter.567 In den darauffolgenden Jahren schwankte die Mitgliederzahl, sodass sie sich im Dezember 1974 auf 66568, im April 1975 auf 73569, im November 1975 auf 68570 und im Juli 1977 auf 69 Mitarbeiter571 belief. Ein exemplarischer Vergleich der Mitgliederzahlen und ihrer Verteilung auf Priester und Laien für die Jahre 1971, 1975 und 1978 zeigt, dass das Verhältnis zwischen Priestern und Laien zumindest in den 70er Jahren etwa 1 zu 2 betrug.572 Ab 1975 nahm zudem die Zahl der laisierten Priester deutlich zu. Aufgrund der vorhandenen Quellen lässt sich feststellen, dass die Mehrzahl der AKH-Mitarbeiter auf das Territorium zwischen Magdeburg, Halle und Leipzig verteilt war.573 Für Christen aus anderen Gebieten der DDR war der AKH nicht selten ein geistiger und geistlicher Rückzugsort.574 Die Anzahl der verbindlich eingeschriebenen Mitarbeiter des AKH dürfte ausgehend von den vereinzelten Werten durchschnittlich bei über 50 gelegen haben. Allerdings ergibt sich im Vergleich zu den durchschnittlich 45 Teilnehmern der Vollversammlungen, diese setzten sich allerdings sowohl aus Mitarbeitern als auch aus Sympathisanten zusammen575, dass es eher ein kleinerer Kreis von eingeschriebenen Mitarbeitern war, der zusammen mit dem Sprecherkreis zum engeren Zirkel der Gruppe gehörte, regelmäßig an Veranstaltungen des Kreises teilnahm und die Arbeit des Aktionskreises entscheidend mit- und vorantrug.
Dieser Gruppe angehörig waren vor allem die vom AKH selbst als „Gründungsväter“576 bezeichneten fünf Priester Heribert Kamper577, Helmut Langos578, Adolf Brockhoff, Dr. Claus Herold und Willi Verstege.579 Die Bezeichnung als „Väter“ ist für das Verständnis der Gruppendynamik relevant, bedenkt man, dass diese Generation kriegsbedingt häufig ohne leibliche Väter aufwuchs. Diese fünf Männer, freundschaftlich untereinander verbunden, waren ursprünglich Paderborner Priester, die nach ihrer Priesterweihe in den 50er Jahren freiweillig in die SBZ gegangen waren und nicht, wie durchaus üblich, nach einigen Jahren in die infolge des bundesdeutschen Wirtschaftswunders aufstrebende Bonner Republik zurückkehrten. Man wird sicher nicht zu Unrecht behaupten, dass es sich bei diesen jungen Männern um die erste Garde Paderborner Diözesanpriester handelte. Sie stellten von Beginn an das personelle Gravitationszentrum dar, um das herum sich der Kreis Gleichgesinnter sammelte. Allerdings übernahmen sie durchaus unterschiedliche Rollen und Aufgaben. Heribert Kamper war Pfarrer in Leuna und wirkte im AKH eher als väterlicher Organisator im Hintergrund. Besonders zu erwähnen ist allerdings seine - trotz der Umweltbedingungen in Leuna - erfolgreiche Zucht der Sittichenart Platycercus elecica (Prachtrosella). Der Verkauf dieser Vögel ermöglichte es Pfarrer Kamper, besonders laiisierte Priester in nicht unerheblichem Maß finanziell zu unterstützen.
Der Merseburger Pfarrer Helmut Langos geriet 1968 in Konflikt mit Weihbischof Rintelen, da er in einem katholischen Eheseminar in Eisleben „die verschiedensten empfängnisverhütenden Methoden bei entsprechend vorliegenden Gründen für eine Geburtenregelung für sittlich erlaubt erklärt“580 hatte. Der Weihbischof verbot, noch bevor die Enzyklika Humanae vitae am 25. Juli veröffentlicht wurde eine solche Aussage in einem katholischen Eheseminar.581 Eng mit Pfarrer Langos verbunden war Wilhelm Verstege.582 Auch er ging nach der Priesterweihe 1952 freiwillig in den Ost-Teil des Erzbistums Paderborn und wurde 1960 Pfarrvikar in der Nienburger Gemeinde St. Nikolaus.583 Weihbischof Rintelen äußerte sich 1965 gegenüber Erzbischof Jaeger zu seinem Pfarrvikar: „Ganz besonders schön war die Firmungsfeier in der herrlichen Schlosskirche zu Nienburg. Herr Pfarrvikar Verstege hat zudem ein großartiges Pfarrhaus gebaut, und zwar natürlich zur Straße hin. Hinter dem Hof ist ein ganz moderner, großer Gemeindesaal entstanden, und in dem Seiten-Grundstück hat er Räume für Kleinkinder und größere Kinder, in denen es immer von Jugend wimmelt. Die größere Gemeinde Nienburg (ringsum sind große industrielle Werke entstanden) könnte ohne weiteres Pfarrei werden, aber Verstege hat noch kein Pfarrexamen gemacht. Er ist ein Seelsorger, wie man ihn nicht besser wünschen kann, verklüngelt aber leider Etat und Kirchenrechnung und hat ebenso eine rechtzeitige Ablegung des Pfarrexamens verklüngelt.“584 53 Jahre lange wirkte Willi Verstege als Priester in Nienburg und setzte sich für die katholische Gemeinde und besonders die Jugend, seine Familie, die evangelische Gemeinde und Schlosskirche sowie den AKH ein. Hier wurden die Rundbriefe des Aktionskreises kopiert und mit der Post versendet. Unter seiner Ägide wurden zudem jene vom Konzil her formulierten Ansprüche im Hinblick auf Ökumene, Glaubwürdigkeit der Verkündigung und geschwisterliches Miteinander des priesterlichen Volkes Gottes eingeübt und über Jahrzehnte praktiziert. Nach dem Tod der anderen Gründungsväter wurde Willi Verstege zu einem spirituellen und geistlichen Mittelpunkt des AKH. Seine persönliche Integrität und die Glaubwürdigkeit seiner Verkündigung sind weit über die Nienburger Gemeinden und den Aktionskreis Halle hinaus geschätzt worden.
Claus Herold war ein sehr stark von Hugo Aufderbeck und dessen pastoralem Ansatz geprägter Seelsorger, der von Friedrich Maria Rintelen 1929 getauft und 1955 zum Priester geweiht, ein gutes Verhältnis zu den Erfurter und Magdeburger Weihbischöfen sowie zum Paderborner Kardinal Jaeger pflegte.585 Nach den Kaplansjahren wirkte er von 1961 bis 1968 zusammen mit Joachim Garstecki, der ab der zweiten Hälfte der 70er Jahre zu einem entscheidenden Vordenker des AKH werden sollte, als Diözesanjugendseelsorger in Magdeburg sowie als Leiter der AG Jugendseelsorge der BOK.586 Ein Konflikt auf höchster Ebene bahnte sich bereits 1966 an und brach vollends in den beiden darauffolgenden Jahren zwischen Claus Herold und Kardinal Bengsch aus.587 Herold hatte 1967 in seiner Eigenschaft als Leiter der bischöflichen Arbeitsgemeinschaft Jugendseelsorge einen kritischen Jahresbericht über die Situation der Kirche in der DDR für die Hauptversammlung des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) gegeben und darin massiv Kritik am „Berliner Zentralismus“, dem „Dirigismus von oben“ und an einem „Einheitsdenken der Kirche“ geübt, das totalitäre Züge aufweise.588 Es waren letztlich nicht nur persönliche Zerwürfnisse589 zwischen Claus Herold und Alfred Bengsch, die den Vorsitzenden der Berliner Ordinarienkonferenz 1968 dazu veranlassten, Herolds Wirken als Sprecher der AG Diözesanjugendseelsorger zu sistieren.590 Vor allem die Sorge um den Verlust der kirchlichen Einheit als Garant des Schutzes vor staatlichen Infiltrations- und Destruktionsversuchen dürfte hierbei ausschlaggebend gewesen sein.591 Im Dezember 1969 hatte Weihbischof Rintelen, mitten in den Wirren um seine Nachfolge, Pfarrer Herold vorübergehend die „pfarrlichen Amtsbefugnisse“ für die Pfarrei Heilig Kreuz in Halle entzogen, weil er einer ökumenischen Trauung assistiert, mit dem evangelischen Pfarrer Günter Loske konzelebriert und dem evangelischen Bräutigam die Kommunion gereicht hatte.592 Trotz dieser Entwicklungen nahm Claus Herold, der 1978 in evangelischer Theologie mit einer kirchengeschichtlichen Arbeit über die Entstehung der Hallenser katholischen Kirchgemeinde promoviert593 und zum Dechanten des Dekanates Halle-Merseburg ernannt wurde, im Aktionskreis eher die Rolle eines Vermittlers und Strategen ein, der den Kontakt zu höheren kirchlichen Stellen nie abreißen ließ.