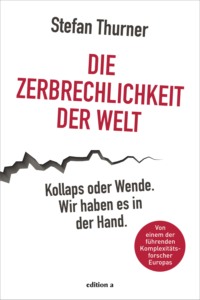Kitabı oku: «Die Zerbrechlichkeit der Welt», sayfa 4
KONTROLLIERBARKEIT
Jeder Mensch, nicht nur KomplexitätsforscherInnen, kennt die Momente, in denen sich komplexe Systeme ganz anders verhalten, als man es erwarten würde. Wer vor einigen Jahren versucht hat, einem Stau in einer Stadt zu entkommen, versteht die Schwierigkeit. Wenn ein Navi (das damals noch keine Alternativrouten angeben konnte) einen Stau auf einer Strecke vorhersagt, denke ich natürlich sofort darüber nach, auf eine andere Route auszuweichen. Ich weiß aber auch, dass alle anderen vermutlich dasselbe denken und eventuell ebenso versuchen werden, auszuweichen. Das kann dazu führen, dass der Großteil der Leute die alternative Route wählt und sich der ursprünglich vorhergesagte Stau auflöst, sodass letztlich die beste Lösung ist, direkt in den angekündigten Stau zu fahren. Das ist mit den heutigen Navis natürlich nicht mehr der Fall.
Manchmal ist man mit der einigermaßen verstörenden Situation konfrontiert, dass man versucht, ein komplexes System zu regulieren, und es benimmt sich wie verhext. Wenn es zum Beispiel darum geht, den Verkehr einer Stadt zu kontrollieren. Man beginnt mit dem Aufstellen einiger Ampeln und stellt fest, dass tatsächlich alles besser wird. Der Verkehr fließt besser. Also fährt man fort mit dem eingeschlagenen Weg der Optimierung. Man kommt dann oft zu dem Punkt, an dem, wenn man die Optimierung konsequent weiterführt, das System schlagartig schlechter wird. Eine Ampel zu viel und der Verkehr beginnt an vielen Stellen der Stadt gleichzeitig zu stocken.
Diese Ampel, die zu viel ist, markiert den Tipping Point. Ab da macht das komplexe System eventuell das genaue Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Jeder einzelne Schritt in der verbesserten Optimierung macht Sinn, doch das Gesamtergebnis ist fatal.
Ein anderes Beispiel: Wenn man eine Tierart nach der anderen ausrottet, zum Beispiel durch Überfischung eines Sees, stört man die Nahrungskette der verbleibenden Arten. Angenommen, diese ändern ihren Menüplan und fressen etwas Anderes. Das kann für eine gewisse Zeit gut gehen, aber – wie das Amen im Gebet – kommt der Punkt, an dem das nicht mehr möglich ist, und das Ökosystem See kippt. Fast alle Arten verhungern. Es kann Jahrzehnte dauern, bis sich das Ökosystem wieder erholt.
ZERBRECHLICHKEIT
Dieses Buch handelt von der Zerbrechlichkeit der Welt. Davon, wie komplexe Systeme, die wir als Gesellschaft notwendig brauchen, kollabieren können. Mit der Wissenschaft komplexer Systeme verstehen wir erstmals besser, warum wir dem Thema Kollaps bisher meist hilflos gegenübergestanden sind, und uns System-Zusammenbrüche aus heiterem Himmel erwischt haben. Wir verstehen, wieso ohne Computer und ohne Daten ein Verständnis dieser Phänomene bisher einfach nicht möglich war. Wir verstehen aber auch, dass weder Computer noch Daten alleine ausreichen werden, um komplexe Systeme zu durchschauen.
Die Menge der weltweit gespeicherten Daten ist gigantisch und sie wächst weiterhin exponentiell. Die verfügbaren Rechenkapazitäten setzen uns ebenso quasi keine Grenzen mehr. Auch sie sind in den vergangenen Jahren exponentiell gewachsen und wachsen weiter. Der Flaschenhals ist und bleibt das Verständnis der komplexen Systeme. Nämlich das Verständnis, unter welchen Bedingungen sich Netzwerke umgestalten und wie Interaktionen Bauteile verändern, die wieder Netzwerke umgestalten und so weiter. Als Konsequenz dieser sogenannten co-evolutionären Dynamik gibt es Punkte, an denen das System rapide andere Makrozustände einnehmen kann. Dieser Übergang offenbart sich oft als Kollaps. Die dahinterliegende Dynamik zu verstehen, bildet einen Kernbereich der Komplexitätsforschung.
Nicht nur am Complexity Science Hub Vienna arbeiten wir daran, dieses Verständnis zu verbessern. Wir sind selbst Teil eines internationalen Netzwerks von Komplexitätsforschungszentren, deren Knotenpunkte unter anderen das Santa Fe Institute in New Mexico, das Institute of New Economic Thinking in Oxford, die Arizona State University und das Forschungsinstitut IFISC in Palma de Mallorca bilden. Vielen Forschern in diesem Netzwerk ist bewusst, dass – so gerne wir auch im wissenschaftlichen Elfenbeinturm sitzen – die Fortschritte der Wissenschaft eventuell mitentscheidend für das Überleben unserer Kultur sein könnten.
• Komplexe Systeme umgeben uns, wo immer wir hinsehen.
• Sie bestehen aus dynamischen Netzwerken.
• Netzwerke beeinflussen die Bauteile und umgekehrt.
• Dadurch entsteht eine Vielzahl von emergenten Phänomenen.
• Ohne Verständnis der Netzwerke bleiben diese unverständlich.
• Komplexe Systeme sind ohne Computer und Big Data nicht beherrschbar.
• Sie sind selbst-organisierend und resilient.
• Die Wissenschaft komplexer Systeme ist auch eine von Kollaps und Zusammenbruch.
• Kein Wissenschaftszweig hat so wie sie die Möglichkeit, System-Risiken zu erkennen und Tipping Points zu identifizieren.
KAPITEL 3: DIE ZERBRECHLICHKEIT VON KOMPLEXEN SYSTEMEN
Systeme kollabieren, manche blitzartig. Oft geschieht das über Kettenreaktionen, bei denen winzige Ursachen riesige Auswirkungen haben.
KLEINE AUSLÖSER, RIESIGE WIRKUNG: KETTENREAKTIONEN
Alles geht kaputt. Manches davon auf spektakuläre Art und Weise. Viele Menschen fasziniert es, Systemen beim Crash zuzusehen. Ein bekanntes Beispiel ist ein Experiment mit Mausefallen und Tischtennisbällen. Dabei legt man hunderte gespannte Mausefallen in eine gläserne Kiste, zum Beispiel in ein leeres Aquarium, und auf jede Mausefalle kommt statt Käse ein Tischtennisball. Die Mausefallen werden schön regelmäßig in die Kiste geschlichtet. Das System ist in Ruhe, nichts passiert. Dann wirft jemand von außen einen einzigen Ball in die Kiste. Die vom Ball getroffene Mausefalle schnappt zu, springt dabei hoch und schleudert ihren Ball in die Luft. Der trifft eine andere Mausefalle, die ebenfalls zuklappt, hochspringt und ihren Ball wegschleudert und so weiter. Es kommt zu einem blitzartigen regelrechten Mausefallen- und Tischtennisbälle-Gewitter, bei dem alle Fallen und Bälle wild durcheinander springen.
Auf Youtube gibt es ein Video, für das man 900 Mausefallen gespannt und 900 Bälle draufgelegt hat9. Nachdem der erste auslösende Ball in dieses System geworfen wurde, dauert es wenige Sekunden, bis mit bemerkenswertem Krach alle Mausefallen und Tischtennisbälle in der Kiste kreuz und quer durcheinander fliegen. Danach herrscht wieder Ruhe, aber alles ist anders. Jede Ordnung ist verschwunden. Ein System ist gecrasht.
Die Mausefallendemonstration ist ein Beispiel für eine Kettenreaktion. Das Schema ist dabei immer dasselbe. Ein kleiner Auslöser hat riesige Wirkung, der »Crash« passiert sehr schnell im Vergleich zum Aufstellen der Mausefallen und nachher ist alles anders. Meist ist das ganze System davon betroffen.
Die zentrale Idee hinter einer Kettenreaktion ist, dass ein »Event«, wie zum Beispiel das Zuschnappen einer Falle und das Wegschleudern des Balls, nicht nur einen weiteren Event auslöst, sondern mehrere. Wenn zum Beispiel jede Falle zwei weitere Fallen zuschnappen lässt, dann hat man erst einen Schnapp-Event, dann zwei, dann vier, dann acht, dann 16 und so weiter. Nach zehnmaliger Wiederholung fliegen bereits mehr als 1000 Bälle herum, und das Chaos breitet sich exponentiell weiter aus.
Es gibt in der Natur dutzende Beispiele für Kettenreaktionen. Etwa Lawinenabgänge, wo ein kleiner Schneeball immer mehr Schnee mit sich reißt, und je mehr Schnee rutscht, umso mehr Schnee kommt ins Rutschen. Oder die Kernspaltung in der Physik, wo ein zerplatzender Atomkern mehrere Neutronen freigibt, die ihrerseits wieder mehrere Kerne zum Platzen bringen. Sobald ein zerfallendes Atom mehr als ein weiteres zum Zerfallen bringt, kommt es zur Kettenreaktion, die ungebremst zur Atombombe wird, mit sprichwörtlich blitzartiger Wirkung. In Kernkraftwerken achtet man daher genau darauf, dass ein zerfallendes Atom im Mittel nur zu genau einem weiteren Zerfall führt und keine Kettenreaktion zustande kommt.
Ein weiteres Beispiel für eine Kettenreaktion ist die Ausbreitung von Viren. Wenn im Mittel eine infizierte Person mehr als eine weitere ansteckt, breitet sich die Epidemie schlagartig und exponentiell aus. Wenn sie sich zu schnell ausbreitet, kann das die Gesundheitssysteme überlasten. Dass das kein theoretisches Szenario ist, mussten viele Länder im Zuge der Corona-Krise hautnah erleben. Wenn jede Person weniger als eine weitere Person ansteckt, verschwindet die Epidemie. Die Reproduktionszahl »R« gibt an, wie viele Personen eine einzelne infizierte Person ansteckt. Ist sie größer als eins, bedeutet das Epidemie. Ist sie kleiner, droht keine Gefahr.
GLEICHE MUSTER
Obwohl das Mausefallenexperiment, Kernspaltung, Lawinen und Virenausbreitung grundverschiedene Phänomene sind, steckt dahinter immer ein ähnliches Muster. Während der Corona-Krise nützte das Ohio Department of Health diese Ähnlichkeit, um in einem Video die Bedeutung des Social Distancing zu demonstrieren10. In dem Video verwenden sie dasselbe Mausefallenexperiment mit dem Unterschied, dass die Mausefallen weiter voneinander entfernt platziert waren – distancing eben. Der von oben kommende Tischtennisball springt zwischen den Fallen umher. Ab und zu schnappt eine Falle zu, aber sonst passiert nichts – es kommt zu keinem Crash. Man sagt, es kommt zu keinem »systemischen Event«. Das System bleibt großteils intakt.
Wenn wir von der Zerbrechlichkeit der Welt sprechen, interessieren uns Fragen wie: Wie schützen wir unser Gesundheits- und unser Finanzsystem? Wie verbessern wir die Zivilgesellschaft, ohne sie dabei zu zerstören? Wie retten wir unsere Öko-Systeme, unsere Landwirtschaft und unsere Lebensräume vor den Folgen der Klimakrise? Wie beherrschen wir die weltweite Urbanisierung, ohne dass sich unsere Städte in Slums von verarmten und aussichtslosen Menschen verwandeln? Oder wie schützen wir uns vor der Zerstörung der Privatsphäre durch unverantwortlichen Umgang mit Big Data und Fake News?
Im Gegensatz zu den bisher erwähnten Phänomenen, wie der Kernspaltung und der Virenausbreitung, sind die Systeme, um die es hier geht, komplex in dem Sinne, wie wir es im vorigen Kapitel kennengelernt haben. Sie basieren auf vielen miteinander verwobenen dynamischen Netzwerken. Es gehört zur Natur der komplexen Systeme, dass auch sie schnell crashen und sich dabei vollkommen verändern können, was wir oft als großes Chaos erleben.
Komplexe Systeme kollabieren überall und ständig. Ein Kollaps ist das durchaus wahrscheinliche Szenario vom Ende eines jeden komplexen Systems. Eine zentrale Frage ist, wie wahrscheinlich ist der Kollaps in der nächsten Zeit? Und können wir unsere Systeme, wenn sie uns wichtig sind, so umgestalten, dass die Kollaps-Wahrscheinlichkeit drastisch verringert wird?
Wenn wir es zum Beispiel schaffen würden, unser Finanzsystem hundertmal sicherer zu machen, also die Kollaps-Wahrscheinlichkeit auf ein Hundertstel zu reduzieren, dann wäre nicht alle zehn Jahre eine Finanzkrise zu erwarten, sondern nur mehr alle tausend Jahre. So ein System wäre dann ziemlich sicher und wir könnten die Sorge vor dem Finanzcrash ein für alle Mal begraben. Wir werden im nächsten Kapitel sehen, dass das gezielte »sicherer machen« von komplexen Systemen heute bereits im Bereich des Möglichen liegt.
In dem wachsenden Wissen darüber, wie komplexe Systeme funktionieren, wie sie sich verändern und was zu ihrem Crash führt, und insbesondere wie sich die Kollaps-Wahrscheinlichkeiten verändern lassen, liegen deshalb viele Antworten auf die aktuellen großen Fragen der Menschheit. Viele komplexe Systeme kollabieren blitzartig, und viele von ihnen nach dem Schema von Kettenreaktionen, die sich allerdings nicht so leicht verstehen lassen wie die in den eingangs erwähnten Beispielen. Im Folgenden werden wir versuchen, die Ursachen eines Kollaps besser zu verstehen.
WIE CRASHT EIN KOMPLEXES SYSTEM?
Denken wir zum Beispiel an ein soziales System. Das ist ein Netzwerk, bei dem die Knoten Menschen darstellen und die Links zum Beispiel beschreiben, wer wen wann trifft. Wenn Herr X an einem bestimmten Tag Frau Y trifft, besteht im »Treff-Netzwerk« an diesem Tag ein »Link« zwischen X und Y. Wenn sie sich am folgenden Tag nicht sehen, ist der Link am nächsten Tag nicht mehr da. Diese Veränderbarkeit der Netzwerke macht Systeme adaptiv, sie können sich dadurch laufend an die gegebenen Umstände anpassen.
Wenn ein Link in einem Netzwerk verschwindet, verändert das meist gar nichts an der Funktionsweise des Netzwerkes. Im »Treff-Netzwerk« eines Landes entstehen und verschwinden täglich Millionen von Links, aber insgesamt sehen die Netzwerke von einem Tag zum nächsten dennoch sehr ähnlich aus. Wenn aber Situationen auftreten, die es plötzlich verhindern, dass Links entstehen, oder sich ein Netzwerk rapide verändert, verändert sich auch die Funktionsweise des Netzwerks. Es funktioniert dann nicht mehr so wie früher. Oft wird das als Crash wahrgenommen.
Stellen wir uns das folgende, etwas unrealistische Szenario vor: Es gibt keine Massenmedien mehr, kein Fernsehen, keine Zeitung, kein Radio. Menschen können aber über ihre Kommunikationsnetzwerke wie Mobiltelefon, Whatsapp, Facebook und so weiter miteinander kommunizieren. Man kann sich auch treffen, um jemandem etwas mitzuteilen.
Stellen Sie sich vor, dass eine Person weiß, dass es ein neues, sehr ansteckendes Virus gibt. Diese Person erzählt die Neuigkeit ihren Freunden. Jeder von ihnen erzählt es ebenso weiter, typischerweise mehr als einer weiteren Person. Wie wir wissen, führt das zu einer Kettenreaktion, also zur explosionsartigen Ausbreitung dieser Neuigkeit. In kürzester Zeit wissen praktisch alle, dass es das neue Virus gibt.
Diese Information hat große Auswirkungen auf das Verhalten der Menschen. Sobald sie von der Neuigkeit erfahren, vermeiden sie soziale Kontakte. Sie hören auf, Links im »Treff-Netzwerk« zu erzeugen. Das führt dazu, dass das »Treff-Netzwerk« aufhört zu existieren, denn ein Netzwerk ohne Links ist kein Netzwerk mehr. Es ist auch kein System mehr. Die Kettenreaktion der Informationsausbreitung im Kommunikationsnetzwerk hat also zur Folge, dass das »Treff-Netzwerk« zusammenbricht. Niemand trifft mehr andere, Menschen gehen nicht mehr zur Arbeit, fahren nicht mehr U-Bahn, das soziale Leben kollabiert.
Auf ähnliche Weise kollabieren auch Finanznetzwerke oder manchmal ganze Gesellschaften. Eine Information breitet sich in einem Netzwerk aus und hat zur Folge, dass sich andere Netzwerke auflösen oder sich drastisch umstrukturieren, so, dass sie nicht mehr funktionsfähig sind.
Ein anderes Beispiel sind Lieferketten. Die Wirtschaft eines Landes besteht aus hunderttausenden Firmen und Unternehmen. Viele davon produzieren Güter und verkaufen diesen »Output« an andere Firmen, die ihn als »Input« für ihre eigene Produktion benötigen. Eine Bäuerin kauft Sojabohnen aus Brasilien und produziert damit Schweine. Sie verkauft diese an einen Schlachthof und dieser verkauft die Schweinehälften an Metzger und Großmärkte. Diese verpacken das Fleisch und liefern es an Lebensmittelhändler und diese schließlich weiter an die Supermärkte. Diese Produktionskette lässt sich als Netzwerk darstellen, bei dem die Knoten die Unternehmen eines Landes sind. Die Inputs für jedes Unternehmen sind Links von einem anderen Produzenten. Die Outputs jeder Firma sind Links zu den Kunden der Firma. Sobald ein Input für eine Firma ausfällt, zum Beispiel, weil die Sojaernte ausgefallen ist, kann sie nicht mehr produzieren, also keinen Output mehr liefern. Die Bäuerin kann keine Schweine mehr mästen und liefern. Die Output-Links verschwinden, und das Netzwerk zerfällt.
Das wiederum kann andere Firmen betreffen, wenn sie ihre Inputs nicht von einem alternativen Zulieferer beziehen können. Der Ausfall eines Knotens im Netzwerk kann daher zum Ausfall von weiteren Knoten führen. Wenn ein Ausfall im Schnitt mehr als einen weiteren Ausfall bedingt, kann das wieder zu Kettenreaktionen führen, und es kommt zum blitzartigen Stillstand der Produktionsketten, mit katastrophalen Auswirkungen für die Wirtschaft, wie sie manche Länder während der Corona-Krise miterleben mussten. Die Funktion der Lieferkettennetzwerke, nämlich die Bevölkerung mit Nahrung, Konsumgütern und Dienstleistungen zu versorgen, verschwindet.
KOLLAPS AUF RATEN
Die Corona-Krise hat nicht nur viele Menschen dafür sensibilisiert, dass das Gesundheitswesen, die Wirtschaft und letztlich die gesamte Gesellschaft komplexe Systeme bilden, die miteinander in enger Verbindung stehen, sondern auch dafür, wie zerbrechlich diese Systeme sind. Dafür, dass sie tatsächlich crashen können und es auch tun. Aufgrund von scheinbar harmlosen Auslösern, die niemand im Blick hatte. Die Krise hat für jeden und jede verständlich demonstriert, dass etwas, dessen Durchmesser etwa 500 Mal geringer als die Dicke eines Haares ist, eine Kettenreaktion zwischen voneinander abhängigen Systemen auslösen kann. Eine Kettenreaktion, die mit dem komplexen System Mensch beginnt und die zu einem Kollaps unseres Finanzsystems und vielleicht sogar zu dem unserer Zivilgesellschaft führen kann. Zur Demonstration, wie Systeme miteinander zusammenhängen, das folgende Beispiel.
VIRUS BEDROHT DAS »SYSTEM MENSCH«
Ein Corona-Virus gelangt zunächst, eingeschlossen in Tröpfchen oder Schwebeteilchen in der Luft in Nase und Rachen. Die Außenhülle des Virus enthält drei Proteine, von denen eines wie Spitzen einer Krone aussieht. Damit dockt es an den Zellen an. Sind die Spikes des Virus mit den Rezeptoren einer Zelle verbunden, aktiviert die Zelle einen Prozess, der das Innere des Virus, seine RNA, in ihr Inneres transportiert. Die Zelle integriert diese RNA und beginnt ihrerseits weitere Viren zu produzieren – sehr viele. Das Immunsystem bemerkt diese Eindringlinge und setzt die körpereigene Abwehr in Gang. Es schickt Fresszellen aus. Diese docken an Viren an und zerlegen sie in ihre Einzelteile. So der Plan.
Das Virus greift bevorzugt das Atmungssystem an, da es in der Lunge besonders gut andocken kann. Durch die große Virenlast und die Abwehrzellen kommt es zu Schäden an den Lungenbläschen. Sie füllen sich mit Flüssigkeit und sobald das geschieht, funktionieren sie nicht mehr so wie sie sollen. Atemnot und Lungenentzündungen sind die Folge.
Das Virus kann auch das Herz-Kreislauf-System angreifen. Viele schwer Erkrankte leiden etwa an einer Entzündung des Herzmuskels. Ein gestörter Geschmacks- und Geruchssinn, beides Symptome einer COVID-19-Erkrankung, weisen auch darauf hin, dass das Corona-Virus auch das Nervensystem angreifen könnte. Sind Lunge oder Herz-Kreislauf-System zu wenig robust und resilient, steuert der Mensch auf einen Crash seines Gesamtsystems zu, der für ihn tödlich endet. Ab einem bestimmten Zeitpunkt braucht er Hilfe von außen. Er braucht die Hilfe des Gesundheitssystems.
GESUNDHEITSSYSTEM IN GEFAHR
Das Ebola-Virus, das von 2014 bis 2016 zu einer Epidemie in mehreren westafrikanischen Ländern führte, ist weitaus gefährlicher für den Menschen als das Corona-Virus, denn es führt nach einer Ansteckung sehr schnell zum Tod. Das Corona-Virus hingegen produziert eine große Menge an Krankenhaus-Patienten und greift damit direkt die nationalen Gesundheitssysteme an, und zwar auf eine Art, auf die bisher niemand vorbereitet war. Es geht dabei vor allem um die Zahl der verfügbaren Intensivbetten. Gesundheitssysteme legen diese Zahl so fest, dass im Normalfall der Großteil der Betten ausgelastet ist und darüber hinaus ein Puffer besteht.
Da der Krankheitsverlauf bei einer schweren Corona-Infektion oft eine künstliche Beatmung erfordert, die nur in Intensivbetten möglich ist, waren in vielen Ländern diese Puffer erstmals nicht mehr ausreichend. Das Horrorszenario, das in einigen Ländern Realität wurde, bestand darin, dass, sobald die letzten Intensivbetten belegt waren, neuankommende Patienten keine Behandlung mehr bekamen und irgendjemand entscheiden musste, wer ein Bett bekam und wer nicht. Opfer dieses systemischen Infarktes waren nicht nur Corona-Infizierte. Hatte jemand zum Beispiel einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt, war die Möglichkeit einer Behandlung im Krankenhaus nicht mehr sicher. Auch Operationen wurden ausgesetzt oder verschoben. Viele Staaten haben sich deshalb dazu entschlossen, alles zu tun, um einen Crash des Gesundheitssystems zu vermeiden. Sie verhängten eine Reihe von zum Teil drastischen Maßnahmen, sie verhängten Lock-Downs und Maskenpflicht, schlossen Geschäfte, Restaurants, Cafés und Fabriken, schränkten die Bewegungsfreiheit ein, untersagten Veranstaltungen und verhängten teilweise sogar Ausgangssperren.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.