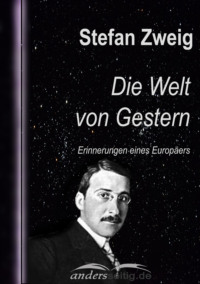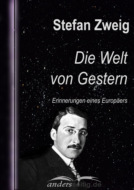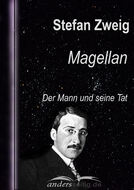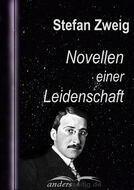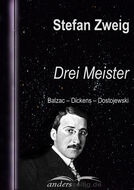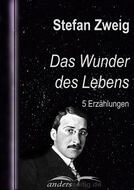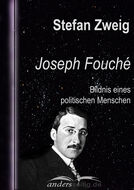Kitabı oku: «Die Welt von Gestern», sayfa 4
Ich weiß natürlich heute genau, wieviel Absurdität in diesem wahllosen Enthusiasmus steckte, wieviel bloß gegenseitige Nachäfferei, wieviel bloß sportliche Lust, sich zu übertrumpfen, wieviel kindische Eitelkeit, sich durch Beschäftigung mit der Kunst über die banausische Umwelt der Verwandten und Lehrer hochmütig erhaben zu fühlen. Aber noch heute bin ich erstaunt, wieviel wir jungen Burschen durch diese Überspannung der literarischen Leidenschaft damals gewusst haben, wie frühzeitig wir uns kritische Unterscheidungsfähigkeit durch dies ununterbrochene Diskutieren und Zerfasern angeeignet haben. Ich kannte mit siebzehn Jahren nicht nur jedes Gedicht Baudelaires oder Walt Whitmans, sondern wusste die wesentlichen auswendig und glaube, in meinem ganzen späteren Leben nicht mehr so intensiv gelesen zu haben wie in diesen Schul- und Universitätsjahren. Namen waren uns selbstverständlich geläufig, die in der Allgemeinheit erst ein Jahrzehnt später gewürdigt wurden, selbst das Ephemerste blieb, weil mit solchem Eifer ergriffen, im Gedächtnis. Einmal erzählte ich meinem verehrten Freunde Paul Valéry, wie alt eigentlich meine literarische Bekanntschaft mit ihm sei; ich hätte vor dreißig Jahren schon Verse von ihm gelesen und geliebt. Valéry lachte mir gutmütig zu: »Schwindeln Sie nicht, lieber Freund! Meine Gedichte sind doch erst 1916 erschienen.« Aber dann staunte er, als ich ihm haargenau in Farbe und Format die kleine literarische Zeitschrift beschrieb, in der wir 1898 in Wien seine ersten Verse gefunden. »Aber die hat doch kaum jemand in Paris gekannt«, sagte er verwundert, »wie konnten Sie sich die denn in Wien beschafft haben?« »Genauso, wie Sie sich als Gymnasiast in Ihrer Provinzstadt die Gedichte Mallarmés, die die offizielle Literatur ebenso wenig kannte«, konnte ich ihm antworten. Und er stimmte mir zu: »Junge Leute entdecken sich ihre Dichter, weil sie sich sie entdecken wollen.« Wir witterten in der Tat den Wind, noch ehe er über die Grenze kam, weil wir unablässig mit gespannten Nüstern lebten. Wir fanden das Neue, weil wir das Neue wollten, weil wir hungerten nach etwas, das uns und nur uns gehörte, – nicht der Welt unserer Väter, unserer Umwelt. Jugend besitzt wie gewisse Tiere einen ausgezeichneten Instinkt für Witterungsumschläge, und so spürte unsere Generation, ehe es unsere Lehrer und die Universitäten wussten, dass mit dem alten Jahrhundert auch in den Kunstanschauungen etwas zu Ende ging, dass eine Revolution oder zumindest eine Umstellung der Werte im Anbeginn war. Die guten, soliden Meister aus der Zeit unserer Väter – Gottfried Keller in der Literatur, Ibsen in der Dramatik, Johannes Brahms in der Musik, Leibl in der Malerei, Eduard von Hartmann in der Philosophie – hatten für unser Gefühl die ganze Bedächtigkeit der Welt der Sicherheit in sich; trotz ihrer technischen, ihrer geistigen Meisterschaft interessierten sie uns nicht mehr. Instinktiv fühlten wir, dass ihr kühler, wohltemperierter Rhythmus fremd war dem unseres unruhigen Bluts und auch schon nicht mehr im Einklang mit dem beschleunigten Tempo der Zeit. Nun lebte gerade in Wien der wachsamste Geist der jüngeren deutschen Generation, Hermann Bahr, der für alles Werdende und Kommende sich als geistiger Raufbold wütend herumschlug, mit seiner Hilfe wurde in Wien die ›Sezession‹ eröffnet, die zum Entsetzen der alten Schule aus Paris die Impressionisten und die Pointillisten, aus Norwegen Munch, aus Belgien Rops und alle denkbaren Extremisten ausstellte; damit war zugleich ihren missachteten Vorgängern Grünewald, Greco und Goya die Bahn gebrochen. Man lernte plötzlich ein neues Sehen und gleichzeitig in der Musik neue Rhythmen und Tonfarben durch Mussorgskij, Debussy, Strauss und Schönberg; in die Literatur brach mit Zola und Strindberg und Hauptmann der Realismus, mit Dostojewski die slawische Dämonie, mit Verlaine, Rimbaud, Mallarmé eine bisher unbekannte Sublimierung und Raffinierung lyrischer Wortkunst. Nietzsche revolutionierte die Philosophie; eine kühnere, freiere Architektur proklamierte, statt der klassizistischen Überladenheit, den ornamentlosen Zweckbau. Plötzlich war die alte, behagliche Ordnung gestört, ihre bisher als unfehlbar geltenden Normen des ›ästhetisch Schönen‹ (Hanslick) in Frage gestellt, und während die offiziellen Kritiker unserer ›soliden‹ bürgerlichen Zeitungen über die oft verwegenen Experimente sich entsetzten und mit den Bannworten ›dekadent‹ oder ›anarchisch‹ die unaufhaltsame Strömung zu dämmen suchten, warfen wir jungen Menschen uns begeistert in die Brandung, wo sie am wildesten schäumte. Wir hatten das Gefühl, dass eine Zeit für uns, unsere Zeit begann, in der endlich Jugend zu ihrem Recht kam. So erhielt mit einmal unsere unruhig suchende und spürende Leidenschaft einen Sinn: wir konnten, wir jungen Menschen auf der Schulbank, mitkämpfen in diesen wilden und oft rabiaten Schlachten um die neue Kunst. Wo ein Experiment versucht wurde, etwa eine Wedekind-Aufführung, eine Vorlesung neuer Lyrik, waren wir unfehlbar zur Stelle mit aller Kraft nicht nur unserer Seele, sondern auch noch unserer Hände; ich war Zeuge, wie bei einer Erstaufführung eines der atonalen Jugendwerke Arnold Schönbergs, als ein Herr heftig zischte und pfiff, mein Freund Buschbeck ihm eine ebenso heftige Ohrfeige versetzte; überall waren wir die Stoßtruppe und der Vortrupp jeder Art neuer Kunst, nur weil sie neu war, nur weil sie die Welt verändern wollte für uns, die jetzt an die Reihe kamen, ihr Leben zu leben. Weil wir fühlten, ›nostra res agitur‹.
Aber es war noch etwas anderes, was uns an dieser neuen Kunst so maßlos interessierte und faszinierte: dass sie fast ausschließlich eine Kunst junger Leute war. In der Generation unserer Väter kam ein Dichter, ein Musiker erst zu Ansehen, wenn er sich ›erprobt‹, wenn er sich der gelassenen, der soliden Geschmacksrichtung der bürgerlichen Gesellschaft angepasst hatte. Alle die Männer, die zu respektieren man uns gelehrt hatte, benahmen und gebärdeten sich respektabel. Sie trugen ihre schönen, grau melierten Bärte – Wilbrandt, Ebers, Felix Dahn, Paul Heyse, Lenbach, diese heute längst verschollenen Lieblinge jener Zeit – über poetischen Samtjacken. Sie ließen sich mit sinnendem Blick photographieren, immer in ›würdiger‹ und ›dichterischer‹ Haltung, sie benahmen sich wie Hofräte und Exzellenzen und wurden wie diese mit Orden geschmückt. Junge Dichter oder Maler oder Musiker aber wurden bestenfalls als ›hoffnungsvolle Talente‹ vermerkt, eine positive Anerkennung dagegen vorläufig in den Eisschrank gelegt; jenes Zeitalter der Vorsicht liebte es nicht, vorzeitig eine Gunst auszuteilen, ehe man nicht durch langjährige ›solide‹ Leistung sich bewährt hatte. Die neuen Dichter, Musiker, Maler aber waren alle jung; Gerhart Hauptmann, plötzlich aus völliger Namenlosigkeit aufgetaucht, beherrschte mit dreißig Jahren die deutsche Bühne, Stefan George, Rainer Maria Rilke hatten mit dreiundzwanzig Jahren – also früher, als man nach dem österreichischen Gesetz für mündig erklärt wurde – literarischen Ruhm und fanatische Gefolgschaft. In unserer eigenen Stadt entstand über Nacht die Gruppe des ›jungen Wien‹ mit Arthur Schnitzler, Hermann Bahr, Richard Beer-Hofmann, Peter Altenberg, in denen die spezifisch österreichische Kultur durch eine Verfeinerung aller Kunstmittel zum ersten Mal europäischen Ausdruck fand. Aber vor allem war es eine Gestalt, die uns faszinierte, verführte, berauschte und begeisterte, das wunderbare und einmalige Phänomen Hugo von Hofmannsthals, in dem unsere Jugend nicht nur ihre höchsten Ambitionen, sondern auch die absolute dichterische Vollendung in der Gestalt eines beinahe Gleichaltrigen sich ereignen sah.
Die Erscheinung des jungen Hofmannsthal ist und bleibt denkwürdig als eines der großen Wunder früher Vollendung; in der Weltliteratur kenne ich bei solcher Jugend außer bei Keats und Rimbaud kein Beispiel ähnlicher Unfehlbarkeit in der Bemeisterung der Sprache, keine solche Weite der ideellen Beschwingtheit, kein solches Durchdrungensein mit poetischer Substanz bis in die zufälligste Zeile, wie in diesem großartigen Genius, der schon in seinem sechzehnten und siebzehnten Jahr sich mit unverlöschbaren Versen und einer noch heute nicht überbotenen Prosa in die ewigen Annalen der deutschen Sprache eingeschrieben hat. Sein plötzliches Beginnen und zugleich schon Vollendetsein war ein Phänomen, wie es sich innerhalb einer Generation kaum ein zweites Mal ereignet. Als beinahe übernatürliches Begebnis haben darum alle jene das Unwahrscheinliche seiner Erscheinung angestaunt, die zuerst davon Kunde erhielten. Hermann Bahr erzählte mir oft von dem Staunen, als er für seine Zeitschrift gerade aus Wien einen Aufsatz von einem ihm unbekannten ›Loris‹ – eine öffentliche Publikation unter eigenen Namen war im Gymnasium unerlaubt – erhielt; nie hatte er unter Beiträgen aus aller Welt eine Arbeit empfangen, die in so beschwingter, adeliger Sprache solchen gedanklichen Reichtum gleichsam mit leichter Hand hinstreute. Wer ist ›Loris‹, wer dieser Unbekannte?, fragte er sich. Ein alter Mann gewiss, der in Jahren und Jahren seine Erkenntnisse schweigsam gekeltert hat und in geheimnisvoller Klausur die sublimsten Essenzen der Sprache zu einer fast wollüstigen Magie kultiviert. Und solch ein Weiser, solch ein begnadeter Dichter lebte in derselben Stadt, und er hatte nie von ihm gehört! Bahr schrieb sofort dem Unbekannten und verabredete eine Besprechung in einem Kaffeehaus – dem berühmten Café Griensteidl, dem Hauptquartier der jungen Literatur. Plötzlich kam mit leichten, raschen Schritten ein schlanker, noch unbärtiger Gymnasiast mit kurzen Knabenhosen an seinen Tisch, verbeugte sich und sagte mit einer hohen, noch nicht ganz mutierten Stimme knapp und entschieden: ›Hofmannsthal! Ich bin Loris.‹ Nach Jahren noch, wenn Bahr von seiner Verblüffung erzählt, überkam ihn die Erregung. Er wollte es zuerst nicht glauben. Ein Gymnasiast, dem solche Kunst, solche Weitsicht, solche Tiefsicht, solche stupende Kenntnis des Lebens vor dem Leben zu eigen war! Und beinah das gleiche berichtete mir Arthur Schnitzler. Er war damals noch Arzt, da seine ersten literarischen Erfolge noch keineswegs Sicherung der Lebensexistenz zu verbürgen schienen; aber er galt schon als Haupt des ›jungen Wien‹, und die noch Jüngeren wandten sich gern an ihn um Rat und Urteil. Bei zufälligen Bekannten hatte er den hoch aufgeschossenen jungen Gymnasiasten kennengelernt, der ihm durch seine behände Klugheit auffiel, und als dieser Gymnasiast die Gunst erbat, ihm ein kleines Theaterstück in Versen vorlesen zu dürfen, lud er ihn gerne in seine Junggesellenwohnung, freilich ohne große Erwartung – nun eben ein Gymnasiastenstück, sentimentalisch oder pseudoklassisch, dachte er. Er bestellte einige Freunde; Hofmannsthal erschien in seinen kurzen Knabenhosen, etwas nervös und befangen, und begann zu lesen. »Nach einigen Minuten«, erzählte mir Schnitzler, »horchten wir plötzlich scharf auf und tauschten verwunderte, beinahe erschrockene Blicke. Verse solcher Vollendung, solcher fehlloser Plastik, solcher musikalischer Durchfühltheit, hatten wir von keinem Lebenden je gehört, ja seit Goethe kaum für möglich gehalten. Aber noch wunderbarer als diese einmalige (und seitdem von niemandem in deutscher Sprache mehr erreichte) Meisterschaft der Form war die Weltkenntnis, die nur aus magischer Intuition kommen konnte, bei einem Knaben, der tagsüber auf der Schulbank saß.« Als Hofmannsthal endete, blieben alle stumm. »Ich hatte«, sagte mir Schnitzler, »das Gefühl, zum ersten Mal im Leben einem geborenen Genie begegnet zu sein, und ich habe es in meinem ganzen Leben nie mehr so überwältigend empfunden.« Wer so mit sechzehn begann – oder vielmehr nicht begann, sondern schon vollendet war im Beginnen –, musste ein Bruder Goethes und Shakespeares werden. Und wirklich, die Vollendung schien sich immer mehr zu vollenden: nach diesem ersten Versstück ›Gestern‹ kam das grandiose Fragment des ›Tod des Tizian‹, in dem die deutsche Sprache sich zu italienischem Wohllaut erhob, kamen die Gedichte, deren jedes einzelne für uns ein Ereignis war, und die ich heute noch nach Jahrzehnten Zeile für Zeile auswendig weiß, kamen die kleinen Dramen und jene Aufsätze, die Reichtum des Wissens, fehllosen Kunstverstand, Weite des Weltblicks magisch in dem wunderbar ausgesparten Raum von ein paar Dutzend Seiten zusammendrängten: alles, was dieser Gymnasiast, dieser Universitätsstudent schrieb, war wie Kristall, von innen her durchleuchtet, dunkel und glühend zugleich. Der Vers, die Prosa schmiegten sich wie duftendes Wachs vom Hymettos in seine Hände, immer hatte durch ein unwiederholbares Wunder jede Dichtung ihr richtiges Maß, nie ein Zuwenig, nie ein Zuviel, immer spürte man, dass ein Unbewusstes, ein Unbegreifliches geheimnisvoll ihn lenken musste auf diesen Wegen ins bisher Unbetretene.
Wie ein solches Phänomen uns, die wir uns erzogen hatten, Werte zu spüren, faszinierte, vermag ich kaum wiederzugeben. Denn was kann einer jungen Generation Berauschenderes geschehen, als neben sich, unter sich den geborenen, den reinen, den sublimen Dichter leibhaft nahe zu wissen, ihn, den man sich immer nur in den legendären Formen Hölderlins und Keats' und Leopardis imaginierte, unerreichbar und halb schon Traum und Vision? Deshalb erinnere ich mich auch so deutlich an den Tag, da ich Hofmannsthal zum ersten Mal in persona sah. Ich war sechzehn Jahre alt, und da wir alles, was dieser unser idealer Mentor tat, geradezu mit Gier verfolgten, erregte mich eine kleine versteckte Notiz in der Zeitung außerordentlich, dass in dem ›Wissenschaftlichen Klub‹ ein Vortrag von ihm über Goethe angekündigt sei (unvorstellbar für uns, dass ein solcher Genius in einem so bescheidenen Rahmen sprach; wir hätten in unserer gymnasiastischen Anbetung erwartet, der größte Saal müsse vollgedrängt sein, wenn ein Hofmannsthal seine Gegenwart öffentlich gewährte). Aber bei diesem Anlass gewahrte ich wiederum, wie sehr wir kleinen Gymnasiasten in unserer Wertung, in unserem – nicht nur hier – als richtig erwiesenen Instinkt für das Überdauernde dem großen Publikum und der offiziellen Kritik schon voraus waren; etwa zehn bis zwölf Dutzend Zuhörer hatten sich im ganzen in dem engen Saal zusammengefunden: es wäre also nicht notwendig gewesen, dass ich in meiner Ungeduld schon eine halbe Stunde zu früh mich aufmachte, um mir einen Platz zu sichern. Wir warteten einige Zeit, dann ging plötzlich ein schlanker, an sich unauffälliger junger Mann durch unsere Reihen auf das Pult zu und begann so unvermittelt, dass ich kaum Zeit hatte, ihn richtig zu betrachten. Hofmannsthal sah mit seinem weichen, nicht ganz ausgeformten Schnurrbärtchen und seiner elastischen Figur noch jünger aus, als ich erwartet hatte. Sein scharfprofiliertes, etwas italienisch-dunkles Gesicht schien nervös gespannt, und zu diesem Eindruck trug die Unruhe seiner sehr dunklen, samtigen, aber stark kurzsichtigen Augen noch bei, er warf sich gleichsam mit einem einzigen Ruck in die Rede hinein wie ein Schwimmer in die vertraute Flut, und je weiter er sprach, desto freier wurden seine Gesten, desto sicherer seine Haltung; kaum war er im geistigen Element, so überkam ihn (dies bemerkte ich später auch oft im privaten Gespräch) aus einer anfänglichen Befangenheit eine wunderbare Leichtigkeit und Beschwingtheit wie immer den inspirierten Menschen. Nur bei den ersten Sätzen bemerkte ich noch, dass seine Stimme unschön war, manchmal sehr nahe dem Falsett und sich leicht überkippend, aber schon trug die Rede uns so hoch und frei empor, dass wir nicht mehr die Stimme und kaum sein Gesicht mehr wahrnahmen. Er sprach ohne Manuskript, ohne Notizen, vielleicht sogar ohne genaue Vorbereitung, aber jeder Satz hatte aus dem zauberhaften Formgefühl seiner Natur vollendete Rundung. Blendend entfalteten sich die verwegensten Antithesen, um sich dann in klaren und doch überraschenden Formulierungen zu lösen. Bezwingend hatte man das Gefühl, dass dies Dargebotene nur zufällig Hingestreutes sei einer viel größeren Fülle, dass er, beschwingt wie er war und aufgehoben in die obere Sphäre, noch Stunden und Stunden so weitersprechen könnte, ohne sich zu verarmen und sein Niveau zu vermindern. Auch im privaten Gespräch habe ich in späteren Jahren die Zaubergewalt dieses ›Erfinders rollenden Gesangs und sprühend gewandter Zwiegespräche‹, wie Stefan George ihn rühmte, empfunden; er war unruhig, farbig, sensibel, jedem Druck der Luft ausgesetzt, oft mürrisch und nervös im privaten Umgang, und ihm nahezukommen, war nicht leicht. Im Augenblick aber, da ein Problem ihn interessierte, war er wie eine Zündung; in einem einzigen raketenhaft blitzenden, glühenden Flug riss er dann jede Diskussion in die ihm eigene und nur ihm ganz erreichbare Sphäre empor. Außer manchmal mit Valéry, der gemessener, kristallinischer dachte, und dem impetuosen Keyserling habe ich nie ein Gespräch ähnlich geistigen Niveaus erlebt wie mit ihm. Alles war in diesen wahrhaft inspirierten Augenblicken seinem dämonisch wachen Gedächtnis gegenständlich nah, jedes Buch, das er gelesen, jedes Bild, das er gesehen, jede Landschaft; eine Metapher band sich der andern so natürlich wie Hand mit Hand, Perspektiven hoben sich wie plötzliche Kulissen hinter dem schon abgeschlossen vermeinten Horizont – in jener Vorlesung zum ersten Mal und später bei persönlichen Begegnungen habe ich wahrhaft den ›flatus‹, den belebenden, begeisternden Anhauch des Inkommensurablen, des mit der Vernunft nicht voll Erfassbaren bei ihm gefühlt.
In einem gewissen Sinn hat Hofmannsthal nie mehr das einmalige Wunder überboten, das er von seinem sechzehnten bis etwa zum vierundzwanzigsten Jahre gewesen. Ich bewundere nicht minder manche seiner späteren Werke, die herrlichen Aufsätze, das Fragment des ›Andreas‹, diesen Torso des vielleicht schönsten Romans deutscher Sprache, und einzelne Partien seiner Dramen; aber mit seiner stärkeren Bindung an das reale Theater und die Interessen seiner Zeit, mit der deutlichen Bewusstheit und Ambitioniertheit seiner Pläne ist etwas von dem Traumwandlerisch-Treffenden, von der reinen Inspiriertheit jener ersten knabenhaften Dichtungen und damit auch von dem Rausch und der Ekstase unserer eigenen Jugend dahingegangen. Mit dem magischen Wissen, das Unmündigen zu eigen ist, haben wir vorausgewusst, dass dies Wunder unserer Jugend einmalig sei und ohne Wiederkehr in unserem Leben.
Balzac hat in unvergleichlicher Weise dargestellt, wie das Beispiel Napoleons eine ganze Generation in Frankreich elektrisiert hat. Der blendende Aufstieg eines kleinen Leutnants Bonaparte zum Kaiser der Welt bedeutete für ihn nicht nur den Triumph einer Person, sondern einen Sieg der Idee der Jugend. Dass man nicht als Prinz oder Fürst geboren sein müsse, um Macht früh zu erringen, dass man aus einer beliebigen kleinen und sogar armen Familie stammen und doch mit vierundzwanzig Jahren General, mit dreißig Jahren Gebieter Frankreichs und bald der ganzen Welt sein konnte, dieser einmalige Erfolg trieb Hunderte aus ihren kleinen Berufen und Provinzstädten – der Leutnant Bonaparte erhitzte einer ganzen Jugend die Köpfe. Er trieb sie in einen gesteigerten Ehrgeiz; er schuf die Generäle der großen Armee und die Helden und Arrivisten der Comédie Humane. Immer ermutigt ein einzelner junger Mensch, der auf welchem Gebiet immer im ersten Schwung das bisher Unerreichbare erreicht, durch die bloße Tatsache seines Erfolgs alle Jugend um sich und hinter sich. In diesem Sinne bedeuteten Hofmannsthal und Rilke für uns Jüngere einen ungemeinen Antrieb für unsere noch unausgegorenen Energien. Ohne zu hoffen, dass je einer von uns das Wunder Hofmannsthals wiederholen könnte, wurden wir doch bestärkt durch seine rein körperliche Existenz. Sie bewies geradezu optisch, dass auch in unserer Zeit, in unserer Stadt, in unserem Milieu der Dichter möglich war. Sein Vater, ein Bankdirektor, stammte schließlich aus der gleichen jüdisch-bürgerlichen Schicht wie wir andern, der Genius war in einem ähnlichen Hause wie wir mit gleichen Möbeln und gleicher Standesmoral aufgewachsen, in ein ebenso steriles Gymnasium gegangen, er hatte aus denselben Lehrbüchern gelernt und war auf denselben hölzernen Bänken acht Jahre gesessen, ähnlich ungeduldig wie wir, ähnlich passioniert für alle geistigen Werte; und siehe, es war ihm gelungen, noch während er seine Hosen auf diesen Bänken wetzen und in dem Turnsaal herumtrappen musste, den Raum und seine Enge, die Stadt und die Familie überwindend durch diesen Aufschwung ins Grenzenlose. Durch Hofmannsthal war uns gewissermaßen ad oculos demonstriert, dass es prinzipiell möglich sei, auch in unseren Jahren und selbst in der Kerkeratmosphäre eines österreichischen Gymnasiums Dichterisches, ja dichterisch Vollendetes zu schaffen. Es war möglich sogar – ungeheure Verlockung für ein knabenhaftes Gemüt! –, schon gedruckt, schon gerühmt, schon berühmt zu sein, während man zu Hause und in der Schule noch als halbwüchsiges, unbeträchtliches Wesen galt.
Rilke wiederum bedeutete uns eine Ermutigung anderer Art, die jene durch Hofmannsthal in einer beruhigenden Weise ergänzte. Denn mit Hofmannsthal zu rivalisieren, wäre selbst dem Verwegensten unter uns blasphemisch erschienen. Wir wussten: er war ein einmaliges Wunder frühreifer Vollendung, das sich nicht wiederholen konnte, und wenn wir Sechzehnjährigen unsere Verse mit jenen hochberühmten verglichen, die er im gleichen Alter geschrieben, erschraken wir vor Scham; ebenso fühlten wir uns in unserem Wissen gedemütigt vor dem Adlerflug, mit dem er noch im Gymnasium den geistigen Weltraum durchmessen. Rilke dagegen hatte zwar gleichfalls früh, mit siebzehn oder achtzehn Jahren, begonnen, Verse zu schreiben und zu veröffentlichen. Aber diese frühen Verse Rilkes waren im Vergleich zu jenen Hofmannsthals und sogar im absoluten Sinne unreife, kindliche und naive Verse, in denen man nur mit Nachsicht ein paar dünne Goldspuren Talent wahrnehmen konnte. Erst nach und nach, im zweiundzwanzigsten, im dreiundzwanzigsten Jahr hatte dieser wundervolle, von uns maßlos geliebte Dichter sich persönlich zu gestalten begonnen; das bedeutete für uns schon einen ungeheuren Trost. Man musste also nicht wie Hofmannsthal schon im Gymnasium vollendet sein, man konnte wie Rilke tasten, versuchen, sich formen, sich steigern. Man musste sich nicht sofort aufgeben, weil man vorläufig Unzulängliches, Unreifes, Unverantwortliches schrieb, und konnte vielleicht statt des Wunders Hofmannsthal den stilleren, normaleren Aufstieg Rilkes in sich wiederholen.
Denn dass wir alle längst zu schreiben oder zu dichten, zu musizieren oder zu rezitieren begonnen hatten, war selbstverständlich; jede passiv-passionierte Einstellung ist ja an sich schon unnatürlich für eine Jugend, denn es liegt in ihrem Wesen, Eindrücke nicht nur aufzunehmen, sondern sie produktiv zu erwidern. Theater zu lieben heißt für junge Menschen zumindest wünschen und träumen: selbst auf dem Theater oder für das Theater zu wirken. Talent in allen Formen ekstatisch zu bewundern, führt sie unwiderstehlich dazu, in sich selbst Nachschau zu halten, ob nicht eine Spur oder Möglichkeit dieser erlesensten Essenz in dem eigenen unerforschten Leib oder der noch halb verdunkelten Seele zu entdecken wäre. So wurde in unserer Schulklasse gemäß der Wiener Atmosphäre und den besonderen Bedingtheiten jener Zeit der Trieb zur künstlerischen Produktion geradezu epidemisch. Jeder suchte in sich ein Talent und versuchte es zu entfalten. Vier oder fünf von uns wollten Schauspieler werden. Sie imitierten die Diktion unserer Burgschauspieler, sie rezitierten und deklamierten ohne Unterlass, nahmen heimlich schon Schauspielstunden und improvisierten in den Schulpausen mit verteilten Rollen ganze Szenen aus den Klassikern, für die wir andern ein neugieriges, aber streng kritisches Publikum bildeten. Zwei oder drei waren ausgezeichnet ausgebildete Musiker, hatten sich aber noch nicht entschlossen, ob sie Komponisten, Virtuosen oder Dirigenten werden wollten; ihnen danke ich die erste Kenntnis der neuen Musik, die in den offiziellen Konzerten der Philharmoniker noch streng verfemt war – während sie sich wiederum von uns die Texte für ihre Lieder und Chöre holten. Ein anderer, der Sohn eines damals berühmten Gesellschaftsmalers, zeichnete während der Stunden uns die Schulhefte voll und porträtierte all die zukünftigen Genies der Klasse. Aber weitaus am stärksten war die literarische Bemühung. Durch die gegenseitige Anstachelung zu immer rascherer Vollendung und die wechselseitig geübte Kritik an jedem einzelnen Gedicht war das Niveau, da wir mit siebzehn Jahren erreichten, weit über das Dilettantische hinaus und näherte sich bei einzelnen wirklich gültiger Leistung, was sich schon dadurch bewies, dass unsere Produktionen nicht etwa nur von obskuren Provinzblättchen, sondern von führenden Revuen der neuen Generation angenommen, gedruckt und – dies der überzeugendste Beweis – sogar honoriert wurden. Einer meiner Kameraden, Ph. A., den ich wie einen Genius vergötterte, glänzte an erster Stelle im ›Pan‹, der großartigen Luxuszeitschrift, neben Dehmel und Rilke, ein anderer, A. M., hatte unter dem Pseudonym ›August Oehler‹ Eingang gefunden in die unzugänglichste, eklektischste aller deutschen Revuen, in die ›Blätter für die Kunst‹, die Stefan George ausschließlich seinem geheiligten siebenmal gesiebten Kreise vorbehielt. Ein dritter schrieb, von Hofmannsthal ermutigt, ein Napoleondrama, ein vierter eine neue ästhetische Theorie und bedeutsame Sonette; ich selbst hatte in der ›Gesellschaft‹, dem führenden Blatt der Moderne, und in Maximilian Hardens ›Zukunft‹, dieser für die politische und kulturelle Geschichte des neuen Deutschlands entscheidenden Wochenschrift, Eingang gefunden. Sehe ich heute zurück, so muss ich ganz objektiv bekennen, dass die Summe unseres Wissens, die Verfeinerung unserer literarischen Technik, das künstlerische Niveau für Siebzehnjährige ein wirklich erstaunliches war und nur erklärlich durch das anfeuernde Beispiel jener fantastischen Frühreife Hofmannsthals, das uns, um nur halbwegs voreinander zu bestehen, eine leidenschaftliche Anspannung zum Äußersten abzwang. Wir beherrschten alle Kunstgriffe und Extravaganzen und Kühnheiten der Sprache, wir hatten die Technik jeder Versform, alle Stile im Pindarischen Pathos bis zur simplen Diktion des Volkslieds in unzähligen Versuchen durchgeprobt, wir zeigten im täglichen Tausch unserer Produktionen uns gegenseitig die flüchtigsten Unstimmigkeiten und diskutierten jede metrische Einzelheit. Während unsere braven Lehrer noch ahnungslos unsere Schulaufsätze mit roter Tinte auf fehlende Beistriche anzeichneten, übten wir einander Kritik mit einer Strenge, einer Kunstkenntnis und Akribie wie keiner der offiziellen Literaturpäpste unserer großen Tageblätter an den klassischen Meisterwerken; auch ihnen, den schon bestellten und berühmten Kritikern, waren wir in den letzten Schuljahren durch unseren Fanatismus weit an fachlichem Urteil und stilistischer Ausdrucksfähigkeit vorausgekommen.
Diese wirklich wahrheitsgetreue Schilderung unserer literarischen Frühreife könnte vielleicht zu der Meinung verleiten, wir seien eine besondere Wunderklasse gewesen. Aber durchaus nicht. In einem Dutzend Nachbarschulen war damals in Wien das gleiche Phänomen gleichen Fanatismus und gleicher frühreifer Begabung zu beobachten. Das konnte kein Zufall sein. Es war eine besonders glückliche Atmosphäre, bedingt durch den künstlerischen Humus der Stadt, die unpolitische Zeit, die drängende Konstellation geistiger und literarischer Neuorientierung um die Jahrhundertwende, die sich in uns chemisch dem immanenten Produktionswillen verband, der eigentlich dieser Lebensstufe beinahe zwanghaft zugehörig ist. Im Alter der Pubertät geht das Dichterische oder der Antrieb zum Dichterischen eigentlich durch jeden jungen Menschen, freilich meist nur wie eine flüchtige Welle, und es ist selten, dass solche Neigung die Jugend überlebt, da sie ja selbst nur Emanation der Jugend ist. Von unseren fünf Schauspielern auf der Schulbank ist später keiner auf der wirklichen Bühne ein Schauspieler geworden, die Dichter des ›Pan‹ und der ›Blätter für die Kunst‹ versandeten nach diesem erstaunlichen ersten Anschwung als biedere Rechtsanwälte oder Beamte, die vielleicht heute melancholisch oder ironisch ihre einstigen Ambitionen belächeln – ich bin der einzige unter ihnen allen, in dem die produktive Leidenschaft angehalten hat und dem sie Sinn sowie Kern eines ganzen Lebens geworden ist. Aber wie dankbar gedenke ich noch jener Kameradschaft! Wieviel hat sie mir geholfen! Wie haben diese feurigen Diskussionen, dies wilde Überbieten, dies gegenseitige Sich-Bewundern und Sich-Kritisieren mir Hand und Nerv frühzeitig geübt, wieviel Ausblick und Überblick auf den geistigen Kosmos gegeben, wie beschwingt uns alle über die Öde und Tristheit unserer Schule emporgehoben! ›Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden …‹, immer, wenn das unsterbliche Schubertlied anklingt, sehe ich in einer Art plastischer Vision uns auf unseren jämmerlichen Schulbänken mit gedrückten Schultern und dann auf dem Heimweg strahlenden, erregten Blickes, Gedichte kritisierend, rezitierend, leidenschaftlich alle Gebundenheit an Raum und Zeit vergessend, wahrhaft ›in eine bessere Welt entrückt‹.
Eine solche Monomanie des Kunstfanatismus, eine derart bis ins Absurde getriebene Überbewertung des Ästhetischen konnte sich natürlich nur auf Kosten der normalen Interessen unseres Alters ausleben. Wenn ich mich heute frage, wann wir die Zeit fanden, alle diese Bücher zu lesen, überfüllt wie unser Tag schon war mit Schul- und Privatstunden, so wird mir klar, dass es gutenteils zum Schaden unseres Schlafs und damit unserer körperlichen Frische geschah. Dass ich, obwohl ich morgens um sieben Uhr aufzustehen hatte, je vor ein oder zwei Uhr nachts meine Lektüre aus der Hand gelegt hätte, kam niemals vor – eine schlechte Gewohnheit, die ich übrigens damals für immer annahm, selbst zur spätesten Nachtzeit noch eine Stunde oder zwei zu lesen. So kann ich mich nicht erinnern, je anders als unausgeschlafen und höchst mangelhaft gewaschen in letzter Minute zur Schule gejagt zu sein, das Butterbrot im Laufen verzehrend; kein Wunder, dass wir bei all unserer Intellektualität alle hager und grün aussahen wie unreifes Obst, überdies in der Kleidung ziemlich verwahrlost. Denn jeder Heller unseres Taschengeldes ging auf für Theater, Konzerte oder Bücher, und anderseits legten wir wenig Gewicht darauf, den jungen Mädchen zu gefallen, wir, die wir doch höheren Instanzen zu imponieren gedachten. Mit jungen Mädchen spazierenzugehen, schien uns verlorene Zeit, da wir in unserer intellektuellen Arroganz das andere Geschlecht von vornherein für geistig minderwertig hielten und unsere kostbaren Stunden nicht mit flachem Geschwätz vertun wollten. Einem jungen Menschen von heute begreiflich zu machen, bis zu welchem Grade wir alles Sportliche ignorierten und sogar verachteten, dürfte nicht leicht sein. Allerdings war im vorigen Jahrhundert die Sportwelle noch nicht von England auf unseren Kontinent herübergekommen. Es gab noch kein Stadion, wo hunderttausend Menschen vor Begeisterung tobten, wenn ein Boxer dem anderen die Faust in die Kinnlade schmetterte; die Zeitungen sandten noch nicht Berichterstatter, damit sie mit homerischem Aufschwung über ein Hockeyspiel spaltenlang berichteten. Ringkämpfe, Athletenvereine, Schwergewichtsrekorde galten zu unserer Zeit noch als eine Angelegenheit der äußeren Vorstadt, und Fleischermeister und Lastträger bildeten ihr eigentliches Publikum; höchstens der edlere, aristokratischere Rennsport lockte, ein paarmal im Jahre, die sogenannte ›gute Gesellschaft‹ auf den Rennplatz, nicht aber uns, denen jede körperliche Betätigung als blanker Zeitverlust erschien. Mit dreizehn Jahren, als jene intellektuell-literarische Infektion bei mir begann, stellte ich das Eislaufen ein, verwandte das von den Eltern mir für eine Tanzstunde zugebilligte Geld für Bücher, mit achtzehn konnte ich noch nicht schwimmen, nicht tanzen, nicht Tennis spielen; noch heute kann ich weder radfahren noch chauffieren, und in sportlichen Dingen vermag jeder Zehnjährige mich zu beschämen. Selbst heute, 1941, ist mir der Unterschied zwischen Baseball und Fußball, zwischen Hockey und Polo höchst unklar, und der Sportteil einer Zeitung erscheint mir mit seinen unerklärlichen Chiffren chinesisch geschrieben. Ich bin gegenüber allen sportlichen Geschwindigkeits- oder Geschicklichkeitsrekorden unentwegt auf dem Standpunkt des Schahs von Persien stehengeblieben, der, als man ihn animieren wollte, einem Derby beizuwohnen, orientalisch weise äußerte: »Wozu? Ich weiß doch, dass ein Pferd schneller laufen kann als das andere. Welches, ist mir gleichgültig.« Ebenso verächtlich, wie unseren Körper zu trainieren, schien es uns, Zeit mit Spiel zu vergeuden; einzig das Schach fand einige Gnade vor unseren Augen, weil es geistige Anstrengung erforderte; und – sogar noch absurder –, obwohl wir uns als werdende oder immerhin potenzielle Dichter fühlten, kümmerten wir uns wenig um die Natur. Während meiner ersten zwanzig Jahre habe ich so gut wie nichts von der wundervollen Umgebung Wiens gesehen; die schönsten und heißesten Sommertage, wenn die Stadt verlassen war, hatten für uns sogar einen besonderen Reiz, weil wir dann in unserem Kaffeehaus die Zeitungen und Revuen rascher und reichhaltiger bekamen. Ich habe noch Jahre und Jahrzehnte gebraucht, um das Gleichgewicht gegen diese kindisch-gierige Überspannung wiederzufinden und die unvermeidliche körperliche Ungeschicklichkeit einigermaßen wettzumachen. Aber im ganzen habe ich diesen Fanatismus, dieses nur durch das Auge, nur durch die Nerven leben meiner Gymnasialzeit nie bereut. Es hat mir eine Leidenschaftlichkeit zum Geistigen ins Blut getrieben, die ich nie mehr verlieren möchte, und alles, was ich seitdem gelesen und gelernt, steht auf dem gehärteten Fundament jener Jahre. Was man an seinen Muskeln versäumt hat, holt sich später noch nach; der Aufschwung zum Geistigen, die innere Griffkraft der Seele dagegen, übt sich einzig in jenen entscheidenden Jahren der Formung, und nur wer früh seine Seele weit auszuspannen gelernt, vermag später die ganze Welt in sich zu fassen.