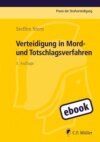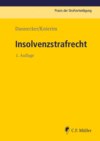Kitabı oku: «Verteidigung in Mord- und Totschlagsverfahren», sayfa 16
Anmerkungen
[1]
Sessar, Rechtliche und soziale Prozesse einer Definition der Tötungskriminalität, 1981.
[2]
Sessar ebenda, S. 177/178.
[3]
Sessar ebenda, S. 179.
[4]
Sessar ebenda, S. 179.
[5]
Nachweise bei Sessar ebenda, S. 175.
[6]
Vogtherr, Rechtswirklichkeit und Effizienz der Strafverteidigung, 1991, S. 204; 240: durchschnittlich 3 1/2 Monate Zeitvorsprung des Wahlverteidigers.
[7]
Gesetz zur Änderung des Untersuchungshaftrechts, BGBl. I, 2009, 2274 f.; dazu Bittmann, NStZ 2010, 13; Deckers, StraFo 2009, 441.
[8]
Backes (Fn. 338), S. 115 und 176, hat einen Anteil zwischen 30 und 40 % ermittelt.
[9]
Zur Höhe der gesetzlichen Gebühren siehe Rn. 2979.
[10]
Burhoff, RVG (2004), S. 281 Rn. 8 mwN.
[11]
Siehe hierzu Burhoff, StraFo 2011, 381; 2008, 192.
[12]
Krit. zu § 99 BRAGO Eisenberg/Classen, NJW 1990, 1023; Hannover, StV 1981, 487.
[13]
So auch Barton, StV 1984, 394 [401].
Teil 2 Der Tod und seine strafrechtliche Zurechnung
Inhaltsverzeichnis
A. Todesbegriff
B. Todesursächlichkeit einer Handlung
Teil 2 Der Tod und seine strafrechtliche Zurechnung › A. Todesbegriff
A. Todesbegriff
Teil 2 Der Tod und seine strafrechtliche Zurechnung › A › I. Menschenleben
I. Menschenleben
152
Gegenstand des Kapitalstrafrechts sind gegen das geborene Menschenleben gerichtete bzw. verabredete Verbrechenstatbestände in vollendeter oder versuchter Form. Bei pränatalen Einwirkungen auf die Leibesfrucht scheiden Mord- und Totschlag (in Bezug auf den Fötus) aus. Maßgebender Zeitpunkt für die Abgrenzung des Anwendungsbereichs zwischen den Abtreibungs- und Tötungsdelikten ist das tatsächliche Einsetzen der Eröffnungswehen[1].
153
So bleibt etwa ein Arzt selbst bei postnataler Todesfolge mangels tatbestandsmäßiger Handlung im Sinne der Tötungsdelikte straflos, der fahrlässigerweise pränatale schwangerschaftsbegleitende Untersuchungen und die womöglich in Bezug auf den Fötus lebensspendende bzw. lebenserhaltende frühzeitige Entbindung per Kaiserschnitt unterlässt[2]. Wer eine Hochschwangere kurz vor der Niederkunft durch Schüsse oder Stiche in den Unterleib tötet, ist nicht etwa wegen zweifachen Totschlags zu bestrafen. Überlebt die Schwangere die Messerattacke, verstirbt jedoch das durch notoperativen Kaiserschnitt gerettete Kind nach 16 Tagen aufgrund seiner Frühgeburtlichkeit und eines infolge der Stichverletzungen seiner Mutter erlittenen Herz-Kreislauf-Stillstandes, ohne den das Kind eine sehr hohe Überlebenschance gehabt hätte, ist der Täter wegen des Tötungsdelikts zum Nachteil der Mutter in Tateinheit mit Schwangerschaftsabbruch zum Nachteil des Kindes zu bestrafen[3].
154
Die schwangere Frau ist ihrerseits vom Einsetzen der Geburtswehen an (als Garantin) verpflichtet, alle Anstrengungen zu unternehmen, um das Leben des Kindes zu erhalten. Ist für die Schwangere im Hinblick auf bekannte Vorerkrankungen oder sonstige Risiken absehbar, dass bei der Geburt Gefahren für Leib oder Leben des Kindes entstehen können, hat sie (ggf. ärztliche) Hilfe in Anspruch zu nehmen. Anderenfalls droht ihr – (bedingten) Tötungsvorsatz vorausgesetzt – schlimmstenfalls sogar die Verurteilung wegen Totschlags durch Unterlassen[4].
Teil 2 Der Tod und seine strafrechtliche Zurechnung › A › II. Todeseintritt
II. Todeseintritt
155
Die Grenzen zwischen Leben und Tod scheinen angesichts intensivmedizinischer Möglichkeiten zunehmend zu verschwimmen. Der Strafjurist kommt deshalb nicht umhin, sich mit dem Todesbegriff zu befassen. Es finden sich die unterschiedlichsten Todesbegriffe: Individualtod, Hirntod, klinischer Tod, endgültiger Tod, Scheintod. Die Existenz des Menschen endet mit dem Individualtod, der mit dem Hirntod, d.h. mit dem irreversiblen Verlust sämtlicher Hirnfunktionen, eintritt.
156
| Sichere Todeszeichen: | Unsichere Todeszeichen: |
|---|---|
| • Totenflecken (Livores) • Totenstarre (Rigor mortis) • Autolyse und Fäulnis • mit dem Leben unvereinbare Verletzungen oder Zerstörungen des Körpers | • Hautblässe • sinkende Körperwärme • Atemstillstand • Herz-Kreislauf-Stillstand • keine Pupillenreaktion • keine Reflexe • Muskelatonie |
| bei isoliertem Hirntod: (Null-Linien-EEG, Angiographie) |
157
In den ersten 20 bis 30 Minuten nach Herzstillstand und mithin vor Ausbildung der ersten sicheren Todeszeichen kann im Einzelfall die Feststellung des Todes schwierig sein.
158
Für die einer Organentnahme zu Transplantationszwecken vorausgehende Todesfeststellung gelten Besonderheiten: Maßgeblich ist zwar auch das Kriterium des Hirntodes (vollständiges und bleibendes, d. h. irreversibles Fehlen jeglicher Hirntätigkeit); dieser muss aber durch zwei vom Transplantationsteam unabhängige ärztliche Spezialisten festgestellt und dokumentiert werden[5].
159
Der sog. Scheintod kennzeichnet einen Zustand tiefer Bewusstlosigkeit mit klinisch nicht oder kaum nachweisbaren Lebenszeichen und gleichzeitigem Fehlen sicherer Todeszeichen. Entsprechende Erscheinungsbilder sind mitunter anzutreffen beim Vorliegen einer Vita minima nach Badeunfällen, Epilepsien, Alkoholintoxikation, Stromschlag, Schädeltrauma, Betäubungsmittel- oder Tablettenmissbrauch, Unterkühlung, CO-Vergiftung.
160
| Kennzeichen des klinischen Todes | Bei Scheintod sind nicht oder kaum wahrnehmbar |
|---|---|
| • Pupillen lichtstarr • Pupillen oft erweitert • Muskelerschlaffung • fehlende Reflexe • keine Spontanatmung • keine Herz-Kreislauf-Tätigkeit | • Atmung • Puls • Körperwärme • Reflexe • Fehlen sicherer Todeszeichen EKG bringt Klarheit |
161
Dem endgültigen Tod mit irreversiblem Stillstand von Atmung und Kreislauf sowie dem Auftreten sicherer Todeszeichen vorgelagert ist mitunter der sog. klinische Tod mit der Chance einer erfolgreichen Reanimation. Reanimationsbedarf kann bei Eintritt eines Kreislaufstillstands oder eines Atemstillstands bestehen; häufig wird beides gleichzeitig vorliegen. Ein Kreislaufstillstand liegt vor, wenn ein zur Aufrechterhaltung des Lebens erforderlicher Minimalkreislauf nicht mehr besteht, gleichgültig, ob dies auf einem Herzstillstand (Asystolie) oder einem Kammerflimmern beruht.
162
Herkömmlicherweise erfolgt die Reanimation (nach Freilegen der Atemwege) durch Beatmung (Mund-zu-Mund, Intubation), kardiale Kompression (sog. externe Herzmassage) und – soweit möglich – durch medikamentöse Therapie. Unter Umständen bedarf es der inneren (direkten) Herzmassage, die eine operative Brustkorberöffnung voraussetzt. Kammerflimmern erfordert den Einsatz des Defibrillators.
163
Die sog. Wiederbelebungszeit beschreibt das Zeitintervall zwischen Herz-Kreislauf-Stillstand und dem Eintritt irreversibler Organschädigung infolge Sauerstoffmangels.
164
| Wiederbelebungszeiten Quelle: Forster | |
|---|---|
| Gehirn | 8 – 10 Min. |
| Herz | 15 – 30 Min. |
| Leber | 30 – 35 Min. |
| Lunge | 60 Min. |
| Niere | 90 – 120 Min. |
| Muskulatur | 2 – 8 Std. |
165
Als Kriterium für eine erfolglose Reanimation gilt das Scheitern der Wiederbelebung des Herzens. Die Herz-Lungen-Wiederbelebung kann im Allgemeinen dann abgebrochen werden, wenn nach 30 Minuten kein Erfolg (keine Spontanatmung, keine spontane Herztätigkeit) erkennbar ist und die Irreversibilität des Kreislaufstillstandes durch ein Null-Linien-EKG über einen längeren Zeitraum belegt ist[6]. In Ausnahmefällen sind, insbesondere bei klinischer Effektivität der Maßnahmen, Verlängerungen der Reanimationszeit angezeigt. Bei Kindern, Säuglingen, bei Intoxikation, Beinahe-Ertrinken sowie bei Unterkühlten (z.B. Lawinenopfern) ist von einer verlängerten Wiederbelebungszeit auszugehen.
166
Natürlicher Tod ist nach allgemeiner Ansicht ein Tod infolge von Krankheiten, Missbildungen oder Lebensschwäche. Von einem nicht natürlichen Tod ist zu sprechen, wenn Fremdverschulden vorliegt, eigenes Verschulden wie Unfall (ohne Fremdeinwirkung) oder Suizid.
167
Hilfsmittel zur Todeszeitbestimmung finden sich in Teil 20 C[7].
Teil 2 Der Tod und seine strafrechtliche Zurechnung › A › III. Selbsttötung im Strafrecht
III. Selbsttötung im Strafrecht
1. Selbstgefährdung, Selbstschädigung und Selbsttötung
168
Das Gesetz bedroht nur die Tötung oder Verletzung „einer anderen Person“ mit Strafe. Eigenverantwortlich gewollte – erstrebte, als sicher vorausgesehene oder in Kauf genommene – und verwirklichte Selbsttötungen oder Selbstverletzungen[8] unterfallen deshalb nicht dem Tatbestand eines Tötungs- oder Körperverletzungsdelikts. Unsere Rechtsordnung wertet eine Selbsttötung – von äußersten Ausnahmefällen abgesehen – zwar als rechtswidrig[9], stellt die versuchte Selbsttötung jedoch straflos[10]. Scheitert der Selbstmordversuch, ist der Suizident strafbar, soweit er im Zuge der Selbstmordhandlung und seiner Vorbereitung Strafgesetze verletzt hat, insbesondere dadurch, dass er Menschen gefährdet oder zu Schaden gebracht hat[11]. Zu denken ist etwa an gescheiterte Mitnahmesuizide, Amokläufe oder Amokfahrten oder gemeingefährliche Suizidversuche mittels Gasexplosion.
169
Auch die strafbare Teilnahme an einem gegen sich selbst gerichteten Tötungsdelikt scheidet nach diesen Grundsätzen aus. Wer einen einvernehmlichen Doppelselbstmord überlebt, kann folglich nicht wegen Anstiftung des Partners oder wegen Beihilfe zum Totschlag oder zur Tötung auf Verlangen bestraft werden.
2. Tatbestandslosigkeit der „Beteiligung“ an Selbsttötungen
a) Der Gedanke der eigenverantwortlichen Risikoübernahme
170
Da eigenverantwortlich gewollte – erstrebte, als sicher vorausgesehene oder in Kauf genommene – und verwirklichte Selbsttötungen oder Selbstverletzungen nicht dem Tatbestand eines Tötungs- oder Körperverletzungsdelikts unterfallen, nimmt derjenige, der sehenden Auges daran mitwirkt, an einer Handlung teil, die – soweit es um die Strafbarkeit wegen eines solchen Delikts geht – keine Tat im Sinne der §§ 25, 26 oder 27 Abs. 1 StGB darstellt. Infolgedessen ist trotz womöglich kausalen Handlungsbeitrags (wegen Fehlens einer Haupttat) der sich vorsätzlich Beteiligende, der lediglich eine eigenverantwortlich gewollte und verwirklichte Selbsttötung oder Selbstverletzung veranlasst, ermöglicht oder fördert, i.d.R. nicht als Anstifter oder Gehilfe an einem Körperverletzungs- oder Tötungsdelikt strafbar[12].
171
Nach denselben Grundsätzen bleibt auch derjenige mangels Haupttat straffrei, der lediglich die eigenverantwortlich gewollte und bewirkte Selbstgefährdung eines anderen veranlasst, ermöglicht oder fördert, wenn der andere die den Verletzungs- oder Todeserfolg verursachende schädigende Handlung selbst vornimmt und sich das von diesem bewusst eingegangene Risiko verwirklicht[13]. Das gilt auch für den Fall der Abgabe von Heroin[14].
b) Abgrenzung zur strafbaren Fremdschädigung
172
Grundsätzlich ist zwischen der – generell straflosen – Beteiligung an einer eigenverantwortlichen Selbstschädigung oder Selbstgefährdung und der – grundsätzlich strafbaren – Fremdschädigung eines anderen zu unterscheiden. Maßgebliches Abgrenzungskriterium ist die Tatherrschaft.
173
Die eigenhändige Vornahme einer zum Tode führenden Handlung, die Tatherrschaft begründet, steht der Annahme bloßer (strafloser) Förderung einer Selbstgefährdung oder einer straflosen Teilnahme am Suizid entgegen[15]. Liegt die Tatherrschaft über die Gefährdungs- bzw. Schädigungshandlung nicht allein beim Gefährdeten bzw. Geschädigten, sondern zumindest partiell auch bei dem sich hieran Beteiligenden, liegt eine eigene Tat des „Teilnehmers“ vor, sodass dieser nicht aus Gründen der Akzessorietät mangels einer Haupttat des Geschädigten straffrei ausgeht[16]. So kann selbst die Beteiligung am „an sich“ straflosen Suizid zur Strafbarkeit des Beteiligten führen, wenn er das tödliche Geschehen beherrscht und/oder den sich selbst Tötenden als sein Werkzeug gegen sich selbst richtet[17]. Das Problem der eigenverantwortlichen Selbsttötung hat in der Diskussion um den sog. „Assistierten Suizid“[18] und die Grenzziehung zwischen strafloser Sterbehilfe[19] und gem. § 216 StGB strafbarer Fremdtötung auf Verlangen[20] große Aktualität erlangt. Es spielt auch im Bereich der Körperverletzung mit Todesfolge gem. § 227 StGB[21] eine nicht unbedeutende Rolle.
Grobe Hinweise, die auf Mord oder Selbstmord hindeuten, sind den nachfolgenden Übersichtstafeln zu entnehmen.
174
| Unnatürlicher Tod I | |
|---|---|
| I. Erhängen | |
| Indizien für Selbstmord | Indizien für vorgetäuschten Selbstmord |
| • Ansteigen der Strangulationsfurche gegen die Schlaufe oder zum Knoten • weder der Fundort selbst noch die Kleidung oder etwaige Verletzungen bieten Anhaltspunkte für eine Gegenwehr • Vorhandensein und Erreichbarkeit von Behelfsmöglichkeiten zur Anbringung des Aufhängewerkzeugs (Leiter, Tisch, Stuhl, Fensterbank, Truhe) • echter Abschiedsbrief • vertikale Speichelabrinnspur | • zweite Strangfurche • Kampfspuren am Fundort (umgeworfene Vasen und Lampen etc.) • Verletzungen (Unterblutungen) • abgebrochene Fingernägel • Injektionsstellen • Kleidungsdefekte • frei hängende Leiche ohne erreichbare Behelfsmöglichkeiten zur Anbringung des Aufhängewerkzeugs |
| II. Erdrosseln | |
| Indizien für Selbstmord | Indizien für Mord |
| • um den Hals liegendes, mit einem Gegenstand zugedrehtes Drosselwerkzeug, das sich auch bei Verlust der Besinnung nicht eigenständig lockern oder lösen konnte • Leichenfundort aufgeräumt und unauffällig • Kleidung geordnet und intakt • keine Verletzungen an Händen oder Armen • plausibles Selbstmordmotiv | • Schürf- oder Würgespuren am Hals • zweite Strangfurche • fest verknotetes Drosselwerkzeug • Kampfspuren am Fundort (umgeworfene Vasen und Lampen etc.) • Abwehrverletzungen • Kleidungsdefekte • fehlender Nachlass |
175
| Unnatürlicher Tod II | |
|---|---|
| III. Scharfe Gewalt (Stich, Schnitt und Hieb) | |
| Indizien für Selbstmord | Indizien für vorgetäuschten Selbstmord |
| • Lage der Schnitte oder Stiche in vom Menschen selbst gut erreichbaren Körperregionen mit lebenswichtigen Blutgefäßen (Herz) • Einstichstelle auf entblößter Haut • Probierschnitte oder -stiche • Parallelschnitte (Pulsaderschnitte) • Fehlen typischer Abwehrverletzungen • geringe Schnitt-Tiefe • blutige Stich- oder Schnitthand des Toten • Blutabrinnspur vertikal • Abschiedsbrief • plausibles Selbsttötungsmotiv | • schwer erreichbare Körperregionen • große Schnitttiefe • Schnittrichtung unterschiedlich • weit auseinander liegende Areale, unterschiedliche Körperseiten • Kampfspuren am Fundort (umgeworfene Vasen und Lampen etc.) • Kleidungsschnitte • Abwehrverletzungen bzw. -schnitte • Blutabrinnspur horizontal • Fehlen von Wertgegenständen (Raubmord) • Tatwerkzeug fehlt • Fehlen eines Suizidmotivs • Tatwerkzeug gereinigt |
| IV. Erschießen | |
| Indizien für Selbstmord | Indizien für Mord |
| • Schläfe (rechts bei Rechtshändern), Herz, Mundhöhle • aufgesetzter Schuss • Nahschuss • Schmauchanhaftungen an Schusshand • Blut- und Gewebespritzer an Schusshand • entblößte Haut • Zugang von innen versperrt | • mehrere Schüsse • Bekleidung durchschossen • Schusswunde an nicht erreichbarer Stelle • Fernschuss • Wertgegenstände fehlen (Raubmord) • Schussgerät nicht auffindbar • Schusswaffe in der Hand des Toten |