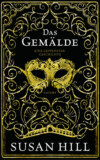Kitabı oku: «Phantomschmerzen», sayfa 4
5
Sie trug ein Kopftuch, und nur sehr wenige Frauen trugen heutzutage Kopftücher, bis auf die Queen – das ging dem diensthabenden Polizisten durch den Kopf, als die Frau aufs Revier kam.
»Guten Morgen. Sie sind Mrs …«
»Still. Marion Still.«
Ja.
»Was kann ich für Sie tun, Mrs Still?«
»Das wissen Sie ganz genau, Sergeant. Nichts hat sich geändert. Ich will den Detective Chief Superintendent sprechen.«
»Tut mir leid, aber da haben Sie kein Glück, Mrs Still – der Super ist längere Zeit im Urlaub.«
»Das haben Sie mir beim letzten Mal auch schon gesagt. Sie oder Ihr Kollege.«
»Na ja, es hat auch gestimmt, und es stimmt nach wie vor.«
»Er ist immer noch im Urlaub?«
»Er ist krankgeschrieben. Und ich habe keine Ahnung, wann er wiederkommt, aber morgen mit Sicherheit nicht. Ich kann nur nachsehen, ob jemand von der Kriminalpolizei gerade Zeit hat und runterkommen kann …«
Die Frau brach in Tränen aus. Angesichts ihres leicht nach vorn gebeugten Körpers, als trüge sie eine schwere Last, und ihres grauen Gesichts mit den tiefen Sorgenfalten verspürte der Sergeant echtes Mitleid. Er wusste, warum sie hier war. Sie hatte schon seit geraumer Zeit versucht, den Super persönlich zu sprechen.
»Mrs Still … Sie können von mir aus eine Woche hier sitzen, das stört mich nicht, aber Sie vergeuden Ihre Zeit, weil wir nicht wissen, wann der Super wieder hier ist. Wenn Sie mit niemand anderem sprechen wollen …«
»Es muss ein Ranghöherer sein, und Mr Serrailler ist der Beste, oder nicht?«
Das Telefon klingelte, und zwei Uniformierte kamen durch die Türen, zwischen sich einen jungen Mann in Handschellen. Mrs Still trat einen Schritt vom Schalter zurück, machte aber keine Anstalten zu gehen.
Dann fuhr der Wagen des Chief Constable draußen vor.
Es gab drei Möglichkeiten, mit Menschen wie Mrs Still umzugehen, dachte Kieron. Er könnte den Rest seiner Tage damit verbringen, ihr aus dem Weg zu gehen. Er könnte sie abwimmeln und zu jemand anderem schicken, mit der Anweisung, nicht allzu viel Zeit mit ihr zu verschwenden.
Oder er könnte sie selbst empfangen.
Am darauffolgenden Mittwochnachmittag führte seine Sekretärin Marion Still in sein Büro im Polizeipräsidium Bevham, zu dem sie in einem bequemen, aber unauffälligen Dienstwagen gebracht worden war. Kieron wollte ihr das Gefühl vermitteln, dass man ihr die größtmögliche Aufmerksamkeit widmete und eine ordentliche Anhörung gewährte. Er hatte die Akten mit nach Hause genommen und sorgfältig gelesen. Außerdem hatte er jede Menge Presseberichte über den Fall aufgerufen, von dem Tag an, als Kimberley verschwunden war, bis zum letzten Mal, als die Presse sich auf sie bezog. Wie üblich waren die Artikel in den Medien schon ein paar Monate nach dem Ereignis immer weniger geworden. Offiziell galt Kimberley Still als vermisst, aber das waren Hunderte andere auch, und die Presse konnte nicht eine von ihnen auf der Titelseite halten. Allerdings wurde über die Fälle vermisster Kinder normalerweise auch weiterhin berichtet.
»Ich bin Ihnen sehr dankbar«, sagte sie. Es gab Tee. Es gab Kaffee. Und Schokoladenkekse.
Kieron saß nicht hinter seinem Schreibtisch, sondern auf einem Stuhl neben ihr.
Arme Frau. Etwas anderes fiel einem zu ihr nicht ein, wie immer bei Menschen, die jahrelanges Elend hinter sich hatten, Verlust, der nicht einmal ein Verlust war, schwankend zwischen Hoffnung und Verzweiflung, die jeden Morgen mit Magenschmerzen aufgewacht waren. Er hatte den Ausdruck in den Augen von Menschen wie Marion Still oft genug gesehen. Jeder Polizist, der länger als zwei Jahre dabei war, kannte diese eigenartige Leblosigkeit und Trauer, die jeden Funken von Leben und Energie überschatteten.
»Mrs Still, ich habe mich in diesem Fall auf den neuesten Stand gebracht. Wie Sie ja wissen, war ich nicht bei der hiesigen Polizei, als Kimberley verschwand, daher habe ich erst mal alles im Detail durchlesen müssen – was auch gut so ist. Ich habe einen unvoreingenommenen Blick darauf werfen und intensiv darüber nachdenken können. Vielleicht kann ich Ihnen jetzt ein paar neue Fragen stellen. Das hoffe ich jedenfalls.«
»Soll das heißen, Sie fangen von vorn an, versuchen herauszufinden, was passiert ist, wohin er sie gebracht hat, wo er … wo sie ist? Ich weiß, wer ›er‹ ist, Mr Bright, das wissen wir alle. Nur scheint das niemanden zu interessieren.«
»Natürlich interessiert uns das. Ich werde nicht so tun, als könnte ich das hier lösen, Mrs Still. Das müssen Sie bitte verstehen. Jede Menge Leute waren mit der Suche nach Kimberley beschäftigt, haben versucht herauszufinden, was ihr zugestoßen ist. Über einen beachtlichen Zeitraum hinweg wurden sehr viele Arbeitsstunden investiert. Niemand hat leichtfertig aufgegeben, das kann ich Ihnen versichern.«
»Das weiß ich. Und ob. Ich muss nicht noch einmal sagen, wie dankbar ich bin, oder?«
»Natürlich nicht. Es war, es ist Ihr Recht. Es war Kimberley und Ihnen geschuldet, dass wir alle getan haben, was in unserer Macht stand, und noch mehr. Damit will ich nur sagen, selbst wenn es eine neue Ermittlung gäbe, kann ich kein Ergebnis versprechen. Wie auch? Neue Beweise gibt es nicht – jedenfalls, soweit ich weiß.«
Sie stellte ihre Tasse ab und schaute ihn direkt an, und einen Moment lang sah er etwas in ihren Augen aufblitzen. Verzweiflung und – Entschlossenheit? Nein. Überzeugung. Eine schreckliche, felsenfeste Überzeugung. Er hatte so etwas gelegentlich schon zuvor gesehen, bei Wahnsinnigen und Besessenen.
»Hören Sie zu, er war es. Lee Russon. Ich kann es kaum ertragen, seinen Namen in den Mund zu nehmen, das ist wie ein fauliger Geschmack, den ich am liebsten ausspucken möchte. Er war es. Ich glaube, er hat sie irgendwie in sein Auto geholt und ist mit ihr weggefahren, und dann … hat er was auch immer getan. Und ich weiß, dass er lebenslang im Gefängnis sitzt, nur nicht für meine Kimberley. Für die anderen. Diese armen Mädchen. Sie sagen, es gibt keine neuen Beweise, aber es gibt Beweise … die gab es schon immer.«
»Ja. Doch als diese Beweise – und die waren wirklich nicht sehr stichhaltig – der Staatsanwaltschaft vorgelegt wurden, die letztendlich entscheidet, fand man sie zu dünn. Sie rieten davon ab, Russon dafür ebenso wie für die anderen Morde vor Gericht zu stellen, weil der Fall so schwach war, dass man ihn abweisen würde. Und an diesem Punkt hätte Russon beantragen können, gegen die anderen Urteile Berufung einzulegen, weil sie nicht gesichert seien, und das hätte – unwahrscheinlich, aber möglich – dazu führen können, dass die Verfahren noch einmal neu aufgerollt und Russon auf freien Fuß gesetzt worden wäre.«
»Er hat es getan.«
»Ich will Ihnen gern zustimmen, nachdem ich alles gelesen habe. Und der leitende Ermittler damals …«
»Inspector Wilkins.«
»Ja … er sagte, die Polizei habe nach keinem anderen Verdächtigen gesucht. Man ging davon aus, dass Kimberley ermordet wurde, womöglich von Lee Russon. Aber ohne Kimberleys Leiche oder auch nur die leiseste Spur von ihr war Russon …«
»Der gelogen und gelogen und gelogen hat.«
»Der geleugnet hat, überhaupt etwas damit zu tun zu haben – dass er jemals in Lafferton selbst oder in der Umgebung war, schon gar nicht an dem besagten Tag – und somit kein Hauptverfahren zu erwarten hatte.«
»Ich glaube nicht, dass sie ihn richtig mürbe gemacht haben. Wenn jemand schuldig ist, kann man ihn auch kleinkriegen – man kann ihn am Ende zu einem Geständnis zwingen.«
Das stimmte nicht immer, dachte der Chief. Aber es hatte keinen Sinn, Mrs Still das zu sagen, für die feststand, dass Russon schuldig war und jemand ihn letztendlich würde brechen können.
6
Im Garten zu sitzen war ihm zu warm gewesen, selbst im Schatten der Bäume, aber als er in die Straße einbog, sah Richard Serrailler auf der Anzeige am Armaturenbrett, dass die Außentemperatur 26 Grad betrug. Um zwei Uhr nachmittags waren es noch 30 Grad gewesen. Mit etwas Glück hatte es sich weiter abgekühlt, bis er zum Café kam. Im Westen zogen sich ein paar Wolken zusammen, die auf ein Gewitter und einen Wetterumschwung hindeuteten.
Er würde sich seine Times abholen, wie üblich ein kaltes Bier trinken, danach ein zweites und dann entscheiden, ob er die plat du jour essen oder nach Hause fahren und auf Delphine warten sollte, bevor er mit ihr ein spätes Abendessen auf der Terrasse einnehmen würde.
Sie schickte ein Lächeln in seine Richtung, als er ankam, doch es war gerammelt voll, und sie trug Tabletts mit Getränken und Gerichten rein und raus, wobei sie den Leuten an den Tischen zu beiden Seiten einen kurzen Gruß und schnell ein paar Sätze zuwarf. Sie würde jetzt nur wenig Zeit für ihn haben. Ganz hinten war ein Platz, direkt außerhalb der Markise. Er nickte ein paar Leuten zu, schüttelte einem Mann die Hand, beugte sich dann aber über seine Zeitung. Er war gerne freundlich. Verbindlich. Er mochte die ortsansässigen Franzosen, die alten Männer, die abends unter den Rosskastanien Boule spielten und donnerstags und freitags am Nachmittag Domino an alten Steintischen. Sein Französisch war ganz gut. Als junger Mann hatte er ein Jahr in dem Land verbracht und seitdem fast jedes Jahr hier Urlaub gemacht. Dann war er hierhergezogen, hatte ein kleines Bauernhaus gemietet. Er pflegte nachbarschaftlichen Kontakt mit den anderen, die in seinem Dörfchen wohnten, ausnahmslos Franzosen. Sie halfen ihm, wenn er es brauchte, er revanchierte sich, für gewöhnlich mit medizinischem Rat – es hatte nicht lange gedauert, bis sie seinen Beruf herausgefunden hatten.
Den Zugezogenen ging er aus dem Weg. Er mochte ihr exklusives Clubverhalten nicht, ihre Entschiedenheit, noch lauter englisch zu sprechen als zu Hause, ihre übertriebene Vertrautheit mit dem Inhaber des Cafés und den Ladenbesitzern, die Art, wie sie lauthals riefen »Delphine! Dasselbe noch einmal, s’il vous plait«.
Sie hatten versucht, ihn einzubeziehen, als er für ein paar Wochen hier gewesen war, hatten zur Kaffeezeit einen Stuhl herausgezogen, damit er sich an ihren langen Tisch zu ihnen gesellen konnte. Er lächelte immer und setzte sich dann allein an einen anderen Tisch. Sie fragten nicht mehr, schauten nur manchmal zu ihm hinüber und redeten über ihn, sobald er gegangen war, das wusste er.
Delphine war fünfundzwanzig. Er war vierundsiebzig. An manchen Tagen schmeichelte er sich damit, dass er zehn Jahre jünger aussah.
Das eiskalte Bier wurde vor ihn hingestellt, nicht von Delphine, sondern von dem neuen jungen Kellner Olivier. Auf Andeutungen, dass sie Richard bevorzuge und ihn außer der Reihe bediene, reagierte sie sensibel und gab seine Bestellung deshalb sehr oft an ihren Assistenten weiter.
Nachdem er sich bei seinen Besuchen im Café mit ihr unterhalten hatte, wenn es ruhiger zuging, hatte er erfahren, dass sie drei Jahre in London verbracht hatte, fließend Englisch sprach, obwohl sie so tat, als könnte sie es nicht, und ebenso intelligent und humorvoll wie gut aussehend war.
Gelegentlich fragte er sich, ob sie eines Morgens beim Aufwachen in ihm den alten Mann sehen würde, der er tatsächlich war, und verschwinden würde, um später an der Seite eines hübschen jungen Franzosen wieder aufzutauchen. Er war nicht in sie verliebt, aber er genoss es, mit ihr zusammen zu sein, ihre Unterhaltung und ihre ungezwungene Zuneigung. Ihre Jugend. Ein angenehmes Arrangement, das schon sechs Monate anhielt. Sie verdiente relativ wenig, bekam aber gutes Trinkgeld und erwartete nichts von ihm. Sie war mit Sicherheit eine bessere Gesellschaft als seine Familie. Cat war mit ihrem neuen Mann beschäftigt, ihren Kindern und ihrer Arbeit, Simon hatte lange keinen Kontakt zu ihm aufgenommen. Simon. Ob er sich erholt hatte? War er aus dem Polizeidienst ausgeschieden? Wo war er und mit wem? Richard hätte abgestritten, sich jemals diese Fragen zu stellen. Aber wenn er allein war und zu viel Zeit zur Verfügung hatte, dachte er an seinen Sohn, so wie an seine Enkelkinder. Und an Judith, seine Ex-Frau. An Judith mehr als an alle anderen.
Delphine brachte ihm sein zweites Bier, nachdem nun viele Gäste bedient waren.
»Es gibt Magret, Salat und Pommes frites. Tut mir leid, chéri.«
Richard mochte keine Ente, das wichtigste Standbein eines jeden Restaurants in diesem Teil Frankreichs.
Er verzog das Gesicht.
»Das Steak mit Pommes frites ist gut, die Langusten sehen sehr gut aus.«
»Danke, aber ich trinke das hier, fahre nach Hause und warte auf dich. Das würde mir gefallen … ein spätes Abendessen an einem warmen Abend.« Er berührte ihre Hand.
»Ich bin nicht vor halb elf, elf hier fertig, okay?«
»Klar. Ich möchte mir eine Sendung über Pathologie ansehen.«
Jetzt war es an Delphine, das Gesicht zu verziehen, bevor sie zu einem Tisch mit Neuankömmlingen eilte. Ihr dunkles Haar war ordentlich zurückgekämmt und mit einer Spange hochgesteckt, sodass ihr langer Hals zu sehen war. Sie trug schwarze Leggins und ein lockeres Oberteil, mit dem sie den Rest ihrer Figur zur Geltung brachte. Sie war schlank. Sie war wundervoll. Er trank noch ein wenig Bier und wandte sich wieder den englischen Nachrichten zu. Alles schien sehr weit weg und hatte immer weniger mit seinem Leben hier zu tun. Mit seinem überraschend sesshaften und zufriedenstellenden Leben.
Er saß im Garten, trank noch ein kaltes Bier, beobachtete die Motten, die gegen die Lampe flatterten, und kurz darauf schlief er im Liegestuhl ein. Als er aufwachte, war es kurz vor Mitternacht, und Delphine war nicht zu Hause. Er ging hinein, warf einen Blick auf das Handy, schaute nach, ob ihr Moped im Unterstand war. Nichts. Er rief im Café an, bekam aber nur den Anrufbeantworter.
Sie saß neben ihrem Moped am Straßenrand, als er sie fand, eine Meile vom Haus entfernt. Seine Scheinwerfer holten sie aus der Finsternis. Sie beugte sich vor, den Kopf auf den Knien.
Das Vorderrad des Mopeds war verbogen, ein Schutzblech fehlte, und es lag auf der Seite. Er konnte es bis an die Hecke ziehen, bevor er Delphine beim Einsteigen in seinen Wagen half. Ihr Gesicht und ihre Hände waren blutüberströmt, aber sie war bei Bewusstsein, und soweit er es im Halbdunkel erkennen konnte, hatte sie weder Knochenbrüche davongetragen noch das Bewusstsein verloren. Das Blut kam aus ihrer Nase, und eine Hand hatte tiefe Schnitte.
»Ein Auto ist mir mit hoher Geschwindigkeit auf der falschen Straßenseite entgegengekommen.«
»Idiot.«
»Ein gelbes Auto.«
»Hast du es erkannt?«
»Nicht so richtig. Es war wie der Blitz vorbei, und ich war am Straßenrand, und weg war er.«
»Idiot und Schweinehund. Aber erst mal werde ich dich gründlich untersuchen. Kann sein, dass du ins Krankenhaus musst.«
»Nein, nein, mir geht’s gut.«
Ihre Nase war geschwollen und sehr weich, jedoch nicht gebrochen. Im Haus wusch Richard ihr das Gesicht und die Arme und verband die Wunde, die so tief war, dass er glaubte, sie müsste wohl am nächsten Tag genäht werden, doch er sagte vorerst nichts, verabreichte ihr nur Schmerztabletten und brachte sie in dem Zimmer zu Bett, das zur Seite des Hauses hinausging und von Bäumen überschattet wurde.
»Oh, was ist mit dem Moped?«
»Darum kümmere ich mich morgen früh. Jetzt leg dich hin und versuch zu schlafen, sag mir Bescheid, wenn die Schmerzen schlimmer werden oder starke Kopfschmerzen auftreten. So ein blöder Fahrer. Wenn man von England aus in ein Land mit Rechtsverkehr fährt, lässt man nicht sein Hirn zu Hause. Man muss es sich die ganze Zeit ins Gedächtnis rufen – rechts fahren, rechts fahren. Er muss die Kurve an den Wertstofftonnen viel zu schnell genommen haben.«
»Ja.« Delphine hatte ihr Gesicht abgewandt. »Danke«, sagte sie.
Da war etwas in ihrer Stimme. Er setzte sich auf das Bett und ergriff ihre Hand.
»Was ist los?«
»Nichts, nichts, keine Sorge. Ich steh nur ein bisschen unter Schock, glaub ich.«
»Natürlich – aber das ist es nicht, oder?«
»Doch, doch. Sonst nichts. Wenn ich geschlafen hab, geht es mir wieder gut.«
»Du wirst Wundschmerz haben, und deine Nase wird sehr wehtun, dein Arm ebenso. Geh nicht davon aus, dass du aufstehen und zur Arbeit gehen kannst, Delphine.«
»Mir wird es …«
»Nein. Dir wird es nicht gut gehen. Spürst du schon, dass der Schmerz nachlässt?«
»Ja, danke, es ist schon viel besser. Danke, mon chéri. Ich glaube, du warst ein sehr guter Arzt.«
Leise machte er die Tür zu und schenkte sich ein Glas Wein ein. Draußen war es noch sehr warm. Warm. Still. Die Dunkelheit voll flatternder, gespenstisch weißer Motten. Eine Schleiereule. Nachtschwalben zwitscherten.
Er war nicht müde, dachte darüber nach, was Delphine ihm über den Unfall gesagt hatte, und versuchte, sich ein Bild davon zu machen. Er fühlte sich unwohl.
Sein Handy summte, und das Display wurde hell.
Hi Dad.
Cat, in England war es eine Stunde früher.
Sind gerade mit dem Abendessen fertig. Hannah hat vor einer Stunde angerufen, um mitzuteilen, dass sie eine Rolle im neuen Musical hat und die Hauptrolle mit zwei anderen Mädchen teilt. Sie ist außer sich vor Aufregung. Sehe, dass bei euch eine Hitzewelle herrscht. Hier nicht. Hoffe, dir geht’s gut. C.
Er las die Nachricht zwei Mal durch. Cat, ihre Familie, das Bauernhaus. Lafferton. Auf einem anderen Planeten. Zurückzukehren kam nicht in Betracht. Ihm gefiel sein Leben hier. Er hatte Delphine. Aber irgendwie fühlte er sich nicht zugehörig, als wären sein wahres Selbst und sein wahres Dasein noch so wie früher, zu Hause in Hallam House, zuerst mit Meriel, dann mit Judith.
Er hatte oft versucht, sich vorzustellen, wieder zu Hause zu leben. Das Haus war noch da, vermietet, wäre aber innerhalb von zwei Monaten wieder sein Eigen, falls er zurückkehren wollte. Die Familie war dort. Nichts hatte sich verändert, bis auf die normale Tatsache, dass das Leben weiterging, Menschen aufwuchsen, älter wurden, heirateten, starben. Neue Häuser wurden errichtet und alte Gebäude abgerissen. Neue Straßen wurden gebaut und veränderten eingefahrene Reisestrecken. Nicht mehr. Oder weniger.
Er konnte nicht zurückkehren. Vielleicht in ein, zwei Jahren, nicht jetzt – obwohl … er verdrängte die Erinnerung, sobald sie aufzutauchen drohte –, nicht, nachdem er beinahe wegen Vergewaltigung unter Anklage gestellt worden wäre. Beinahe. Weil er Shelley natürlich nicht vergewaltigt hatte, sie hatte sich ihm aufgedrängt, als er schwach und dumm gewesen war, in ein paar vernebelten Momenten. Das war’s. Der Rest war eine aufgeblasene Anklage und Rachsucht gewesen. Das wusste er. Auch andere wussten es. Trotzdem wurde er noch immer als »Vergewaltiger« geteert und gefedert von allen, die es wussten, und die Erinnerung hielt lange an. Eine falsche zwar, aber sie blieb.
Er hatte keine Ahnung, ob Shelley und ihr Mann noch immer in Lafferton wohnten, fragte sich jedoch hin und wieder, ob er es herausfinden sollte. Wenn sie weggezogen waren, könnte er ab und zu nach Hause fahren, obwohl er bezweifelte, jemals wieder in Lafferton leben zu wollen.
Bevor er ins Bett ging, schaute er zu Delphine hinein. Sie schlief, ihr Gesicht war geschwollen und rot, sie atmete mühsam durch die verstopfte Nase. Ihr verletzter Arm lag auf der Bettdecke, und ein wenig Blut drang noch immer durch den Verband. Sanft berührte er ihre Hand und hatte das Gefühl, ein verletztes Kind zu beschützen. Sie regte sich, wurde aber nicht wach.
Er legte sich eine Weile hin, bestürzt über die Gefühle, die ihr Unfall und der Anblick gerade in ihm aufgewühlt hatten, große Zärtlichkeit und …
Und er wusste es nicht. Er wusste nur, dass es etwas Ungewohntes war, neu und verstörend.
7
Wookie knurrte, ein tiefes Grummeln, das eher aus seinem Bauch als aus seinem Hals zu kommen schien, aber er rührte sich nicht und machte kein Auge auf.
Dreißig Sekunden danach bog Kierons Wagen in die Auffahrt. Wookie knurrte wieder.
»Dummer Hund.« Cat hatte die Füße auf dem Sofa und war fast mit Flauberts Papagei fertig, dem Buch, das in dieser Woche noch im Literaturkreis besprochen wurde.
»Wärst du fünf Minuten später gekommen, hätte ich dir meine volle Aufmerksamkeit schenken können, nur jetzt musst du warten, weil ich auf der vorletzten Seite bin.«
Er kam zu ihr und küsste sie auf die Stirn. »Ich sage nichts. Was zu trinken?« Sie nickte und schlug die Seite um.
Wookie grummelte weiter, Kieron brachte zwei Gläser Wein, stellte sie auf den niedrigen Tisch und setzt sich neben Cat. Der Terrier erhob sich, rückte auf die andere Seite des Sofas und knurrte weiter vor sich hin.
»Wann wirst du dich endlich an mich gewöhnen und aufhören zu knurren, Wooks?«
Cat las noch eine Minute weiter und klappte das Buch dann zu.
»Beachte ihn einfach nicht.«
»Ich wohne hier seit Monaten, und noch immer behandelt er mich wie einen Einbrecher.«
»Würde so einen nicht sehr beeindrucken.«
»Wenn ich in seiner Nähe mit den Fingern schnipse, bleckt er die Zähne.«
»Dann lass es einfach. Hallo im Übrigen. Wie war dein Tag?«
Kieron seufzte. »Zu viel Verwaltungskram, eine zu lange Besprechung mit dem Commissioner und eine Durchgeknallte. Nein, das nehme ich zurück – eine Besessene. Eigentlich tut sie mir sehr leid – ihre Tochter verschwand vor ein paar Jahren, vermutlich entführt, sie ist sich sicher, dass sie weiß, wer es war, und das sind wir auch, er sitzt ohnehin schon für zwei Morde im Gefängnis – er hat gestanden, behauptet aber steif und fest, dass er nichts mit diesem Fall zu tun hat. Sie will Gerechtigkeit, verständlich – sie will einen Abschluss. Sackgasse.«
»Marion Still.«
»Du weißt davon?«
»Sie ist eine Patientin. Kimberley war es auch. Welchen Eindruck hattest du von ihr?«
»Stabil. Zeigt nach außen keine Emotionen.«
»Was hast du gesagt – dass du nichts tun kannst?«
»Mehr oder weniger. Aber ich habe auf dem Heimweg darüber nachgedacht …«
»Russon ist dafür verantwortlich, oder?«
»Das ist wahrscheinlich, doch ich kenne nicht alle Details, das war vor meiner Zeit hier. Ich lasse mir die Akten zukommen und werfe einen Blick hinein.«
»Heute Morgen bekam ich eine E-Mail von einem früheren Studienkollegen. Luke Renfrew. Ich war ziemlich scharf auf ihn.«
»Das will ich gar nicht wissen. Sag mir nur nicht, dass er nach Lafferton zieht.«
»Eigentlich nach Starly, und keine Sorge, er ist schwul.«
»Leoparden ändern ihre Flecken.«
»Luke nicht. Sein Partner ist ein sehr reicher Italiener, der gerade das Hotel gekauft hat. Er möchte mit mir über ein Projekt sprechen … mich von ihm zum Lunch dort einladen zu lassen ist das Mindeste, was ich tun kann. Auf die alten Zeiten und so.«
Sie schrie in gekünstelter Angst auf, als Kieron sich auf sie stürzte. Für Wookie war nicht ersichtlich, dass der Überfall nur Spaß war.
»Verdammte Scheiße!«
Der Hund hatte ihn fest in den Arm gezwickt, war vom Sofa gesprungen und hatte das Weite gesucht.
»Daran könnte ich sterben«, sagte Kieron.
»Nein, könntest du nicht, vorausgesetzt, dass du gegen Tetanus geimpft bist. Wenn es anfängt zu pochen oder anschwillt, gebe ich dir Penicillin, aber vorerst kleben wir ein Pflaster drauf.« Cat tupfte den Biss mit Desinfektionsmittel ab.
»Es gibt ein Kampfhundegesetz, nur zu deiner Information.«
»Wookie ist kein Kampfhund.«
Kieron streckte den Unterarm vor.
»Er ist nur nicht daran gewöhnt, dass du hier lebst. Ich mache jetzt das Abendessen.«
Kieron folgte ihr.
»Und hör um Himmels willen auf, deinen Arm so zu umklammern.«
»Es pocht.«
»Nein, es tut bloß weh.«
Er setzte sich und schaute traurig auf das Pflaster. »Und was hat jetzt dieser Luke gesagt, auf den du so scharf bist?«
»Nichts Genaues … nur dass er zu etwas meine Meinung hören will.«
»In eure Gemeinschaftspraxis eintreten?«
»Das glaube ich nicht, jedenfalls wäre das nicht meine Angelegenheit, ich bin keine Teilhaberin. Hier, putz die Bohnen für mich.«
»Ich glaube, ich kann meinen rechten Arm nicht bewegen.«
»Doch, kannst du.« Sie baute Schüssel, Bohnen und Messer vor ihm auf. »Wie war das noch, du sagtest, du hättest dir ein paar Gedanken über den Mord an Kimberley Still gemacht?«
»Keine sehr nützlichen. Ich werde die Akten durchsehen, wenn ich Zeit habe.«
»Und das wird wann genau sein?«
Er stöhnte.
»Da gibt es bestimmt jemanden, der mehr Zeit hat als du.«
Kieron hatte eine Handvoll Bohnen in die Hand genommen. Er legte sie wieder ab. »Jetzt, wo du es sagst …«
»Simon?«
»Simon«, bestätigte er.