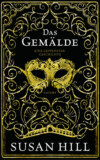Kitabı oku: «Phantomschmerzen», sayfa 5
8
Der Sturm hatte sich den ganzen Nachmittag über zusammengebraut, und als die letzte Fähre in den Hafen einbog, stampfte und schlingerte sie durch hohe Wellen, der stürmische Wind blies über den Bug, sodass sie dreimal wenden musste, um erneut das Dock anzusteuern. Als sie schließlich vertäut wurde, war nur die Mannschaft fest auf den Beinen und fröhlich.
Sam war noch nie seekrank gewesen, aber diese Fahrt hatte ihn auf die Probe gestellt. Er stützte sich ab, als er den Kai betrat, und der Boden schien unter seinen Füßen nachzugeben. Er hievte sich den Rucksack auf die Schultern und schaute den Hang hinauf, wo die Lichter im Pub noch brannten. So spät hatte er nicht ankommen wollen. Geplant war, dass er eine Fähre am frühen Nachmittag nahm, doch eins kam zum anderen, einschließlich verschlafen, keine Mitfahrgelegenheit finden, dann hinter einem anfahrenden Zug herlaufen, der, wie sich herausstellte, in die falsche Richtung fuhr. Daher hatte er es erst kurz vor Betriebsschluss geschafft.
»Du hast Glück. Die fahren morgen eher gar nicht aus, wenn die Wettervorhersage stimmt.«
Es war dunkel, und niemand wartete am Kai. Die einzigen anderen Passagiere waren ein Mann mit Rucksack, der allein zum Parkplatz ging, und eine Gruppe Studenten auf Exkursion, die in einen wartenden Kleinbus stiegen, der sie auf die andere Seite der Insel zum Feldforschungszentrum bringen würde. Die Crew machte die Fähre zum Auslaufen bereit. Sam ging den Hang hinauf zum Pub. Draußen standen zwei Fahrräder und ein verbeulter Transit. Drinnen war es ruhig, bis auf das Heulen des Windes und zwei Männer, die am Tresen etwas tranken. Sie drehten sich um, als die Tür aufging.
»Komm rein und mach die Tür zu, Junge, sonst werden wir ins Meer geweht.«
Sam war keinen Schritt näher gekommen, nachdem die Tür zu war.
»Du brauchst vielleicht einen Whisky, so grün, wie du aussiehst.«
»Mir geht’s gut. Hat jemand ein Auto, um mich mitzunehmen?«
»Haben sie nicht, jedenfalls nicht zu dieser Nachtzeit und bei dem Wetter. Wo willst du denn hin?«
»Komm schon, Junge, ich geb dir einen aus.« Der Mann mit dem roten Gesicht schob dem Wirt ein paar Münzen über den Tresen. »Ich hab dich schon mal gesehen.«
»Ich war schon mal hier.«
»Dann komm … Auf dich und ein langes Leben.« Sam betrachtete den Whisky. Er hatte noch keinen probiert, aber sie beobachteten ihn. Alle drei. Er hob sein Glas und leerte es in zwei Zügen, wie die Medizin, nach der er schmeckte, stellte das Glas ab und fragte noch einmal, ob die Möglichkeit bestand, über die Insel gefahren zu werden.
Der Wirt seufzte. »Meine Schrottkarre ist in der Werkstatt mit Riss in der Ölwanne, die Frau fährt Fahrrad, und das willst du dir heute Abend nicht leihen. Du lässt deins doch sicher auch hier, oder, John?«
Der Mann mit dem roten Gesicht glitt vom Barhocker. »Aye.«
»Danke für den Drink«, sagte Sam.
Der Mann nickte, schob sich aus der Tür und ließ den nächsten Windstoß herein.
»Er wohnt nur hundert Meter von hier den Hügel rauf. Wenn du auf die andere Seite willst, hast du heute Abend kein Glück. Ich hab kein leeres Zimmer, aber du kannst gern auf meiner Couch schlafen. Du bist Simons kleiner Vetter, oder?«
»Neffe.«
»Ich erinnere mich. Er wohnt ungefähr drei Meilen von hier, nur kannst du bei dem Wetter nicht zu Fuß gehen.«
Sam schaute auf seinen Rucksack. Er könnte ein paar Stunden auf der Couch schlafen und gegen Morgen aufstehen, wenn der Sturm vielleicht nachgelassen hätte. Aber als er das Angebot schon annehmen wollte, hörte er draußen durchdrehende Räder, und die Tür wurde dem Eintretenden aus der Hand gerissen. Draußen herrschte ein Chaos aus Sprühnebel, Regen und Wind.
Der Wirt brach in schallendes Gelächter aus. »Und hier haben wir die Einzige, die so bescheuert ist, bei dem Wetter vor die Tür zu gehen, ob mit oder ohne fahrbaren Untersatz.«
Die Frau, die hereinkam, trug eine grüne Regenjacke, Stiefel und einen Südwester, den sie in den Nacken schob, woraufhin sich Wasser auf die Matte ergoss.
Sie zögerte kurz, warf einen Blick durch den Raum und bemerkte Sam und den anderen Trinker am Tresen, der jetzt beschloss, schlafen zu gehen.
»Ich brauche eine neue Gasflasche, wenn du noch eine von der letzten Ladung übrig hast, Iain. Scheiß Teil. Bin mir sicher, dass sie voll war. Ich hab auf keinen Fall schon eine ganze verbraucht.«
Iain lachte. »Das behauptest du immer, Sandy. Ich sage es dir dauernd, und jetzt soll ich bei dem Wetter raus und deine Gasflasche schleppen.«
»Ich nehme ein Half-Pint, um den Schock abzumildern.«
Iain zapfte ihr Bier. »Ich hol dir dein Gas. Kümmer dich inzwischen um den jungen Mann hier.« Sie wechselten rasch einen Blick, den Sam als ›Behalt ihn im Auge und pass auf, dass er sich keinen Drink oder was anderes nimmt‹ auslegte.
Sandy drehte sich um. Sie musterte ihn, taxierte ihn regelrecht, dachte er. Das war ihm unangenehm. »Sandy Murdoch. Bist du mit der letzten Fähre gekommen?«
Sam nickte. »Ich dachte, ich könnte von hier aus mit jemandem mitfahren, hatte aber Pech.«
»In so einer Nacht fährt keiner rum. Wo willst du denn hin?«
Er zögerte. Woanders hätte er es niemals einer Fremden gesagt, aber auf der Insel war es wohl in Ordnung. Jeder kannte jeden und ging offen damit um, jeder Besucher wurde bemerkt und beurteilt.
»Zu meinem Onkel. Er wohnt in Stane.«
»Simon? Gut, jetzt, wo ich dich ansehe. Du hast seinen guten Knochenbau, wenn auch nicht seinen Teint – oder seine Augen.«
»Dann kennen Sie ihn.« Sam schaute die Frau aus den Augenwinkeln an. Sie hatte ein knochiges Gesicht, sprödes, strohblondes Haar.
»Du trinkst nicht«, sagte sie.
»Ich möchte nichts.«
»Na ja, ich würde nicht behaupten, dass ich nie alleine trinke, aber Gesellschaft ist mir lieber. Was nimmst du, wenn Iain wiederkommt?«
»Limonade?«
»Nicht dein Ernst.«
Sam antwortete nicht, und sie saßen schweigend herum, bis der Wirt zurückkam.
»Sie ist im Jeep, und jetzt schau dir an, wie ich aussehe.«
»Danke, Iain. Einen Dram für Sam, und dann nehm ich dir das andere Half-Pint ab.«
Sie ignorierte Sams Protest, brachte seinen Whisky an den Tisch, dazu ein Glas Limonade.
»So spült man den runter.« Sie lachte und hob ihr Glas.
Eine Viertelstunde später hatte sie Sams Lebensgeschichte aus ihm herausgekitzelt. Er trank einen weiteren Whisky, und die Kneipe bekam einen goldenen Schimmer. Er war angenehm müde und hatte plötzlich einen Bärenhunger.
»Gut«, sagte Sandy, knallte ihr Glas auf den Tisch und stand auf. »Ich bring dich zu deinem Onkel, bevor ich dich hier raustragen muss. Und das könnte ich glatt.«
Sam war leicht unsicher auf den Beinen, ging aber zielbewusst zur Tür. Als er sie öffnete, riss der Wind sie ihm aus der Hand und schlug sie nach hinten.
»Moment noch – hab was vergessen.« Sandy ging rasch in die Kneipe zurück. Sam beobachtete sie. Sie machte einen ganz netten Eindruck, ein Mensch, für den ihn plötzliche Zuneigung überkam. Whisky brachte wohl von allem das Beste zur Geltung.
Im Jeep war es warm, sobald der Heizlüfter blies und über das Platschen des Regens auf dem Dach und das Pfeifen des Windes durch die undichten Fenster hinweg ein Geräusch wie eine Turbine von sich gab. Sam dachte, so könnte er ruhig noch tausend Meilen weiterfahren. Sein Kopf sang.
»Worum ging’s da bei dem ganzen Zeug?«
»Was für ein Zeug?«
Sam versuchte, mit schwerer Zunge die Frage zu formulieren, die er ihr stellen wollte, aber als es ihm gelang, hatte er sie vergessen.
Die Scheibenwischer hatten Schwierigkeiten mit der Bewältigung des strömenden Regens und kratzten nur schwach hin und her, Pause, hin und her, Pause.
»Wie können Sie rauskucken?«
»Da gewöhnt man sich dran. Ich kenne die Straße.«
»Sind Sie hier geboren, Sandy?«
»Nein. Aber mir gefällt es hier, Sam. Die Leute kommen im Juni, Juli her, und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, und sie sehen es überhaupt nicht. Simon mag es, meinst du nicht? Mist.«
Der Jeep rutschte seitwärts über die nasse Straße. Sandy fing ihn geschickt ab, und sie waren auf der letzten Geraden. Sam schaute aus dem Fenster, konnte aber nichts erkennen.
»Ist das ein großer Umweg für Sie?«
»Kein großer.«
Sie bogen ab.
»Da sind wir … zu Hause. Und jetzt gib acht auf dich – es gießt in Strömen, und der Boden ist glitschiger Schlamm.«
»Vielen, vielen Dank. Wirklich nett von Ihnen. Ich bin Ihnen echt dankbar. Danke. Vielen Dank.«
»Gern geschehen, Sam.« Er sah, dass Sandy lachte. Über ihn? Das ärgerte ihn, und er war kurz davor, ihr Paroli zu bieten, wie er da in Regen und Wind stand, aber dann setzte sie zurück, die Räder warfen Schlamm und Wasser auf, und noch bevor er Simons Haustür erreichte, hatte er vergessen, was er hatte sagen wollen.
Eine halbe Stunde später, nachdem er ein heißes Bad genommen, frische Kleidung von Simon angezogen hatte und der Inhalt seines Rucksacks in der Waschmaschine war, saß Sam vor einem Becher Tee und sah zu, wie Eier, Speck und Bratkartoffeln auf dem Herd brutzelten. Simon hatte nicht viel gesagt, bis auf »Ach, du Scheiße!« ganz zu Anfang, als er die durchnässte, schwankende Gestalt vor seiner Tür hereingeholt hatte. Jetzt hörte er sich den oberflächlichen, aber etwas nüchterneren Reisebericht seines Neffen an. Er fragte nicht, was er getrunken hatte, denn er ging davon aus, dass es nicht so viel gewesen war.
»Was ist mit deinen Haaren passiert?«, fragte Sam plötzlich und starrte ihn an, als hätte er ihn erst jetzt gesehen.
»Bisschen heftig?« Simon fuhr sich mit der Hand darüber. Die blonden Haarsträhnen, die ihm normalerweise in die Stirn hingen, waren sehr kurz geschnitten worden und ließen seine Gesichtsknochen und den langen Hals erkennen.
»Bisschen wie ein Sträfling.«
»Danke. Nur weil Geordie es nicht richtig schneiden kann, daher hab ich’s ihn lieber mit der Schermaschine machen lassen. Hält auch länger. Möchtest du Toast?«
»Nein danke. Aber hast du Tomaten?«
»Leider nein.«
Simon stellte ihm den Teller hin und wartete, bis Sam drei oder vier Bissen verschlungen hatte und eine Pause einlegte, um etwas zu trinken. Dann sagte er: »Okay, du hast mir erzählt, wie du hergekommen bist. Aber warum?«
»Na ja, weißt du, ich war in der Nähe.«
»Niemand ist in der Nähe von Taransay.«
»Na ja, so ungefähr. Hab dich lange nicht gesehen. Hab gedacht, ich könnte mal wieder vorbeischauen.«
»Wie schmeichelhaft.«
»Wie geht’s …?« Er deutete mit einem Kopfnicken auf Simons Arm.
»Gut.«
»Prima.«
Simon ließ ihn allein, machte noch mehr Tee und legte einen Ingwerkuchen auf einen Teller. Kirsty backte sie zu Hause und verkaufte sie zusammen mit ein paar anderen Kuchen im Laden. Die Nachfrage war groß, womit sie ein wenig zum Familieneinkommen beitrugen, so wie mit den Eiern der Hühner. Das Leben auf der Insel war bescheiden. Nichts wurde verschwendet.
In der kurzen Touristensaison im Sommer hofften alle, die spärlichen Einkünfte des langen Winters auszugleichen. Simon gefiel diese Art zu leben, aber er bezweifelte, zäh genug zu sein, es lange durchzuhalten. Im Übrigen langweilte er sich zu schnell für eine so begrenzte Existenz.
Sie saßen sich gegenüber und lauschten dem immer noch tosenden Sturm. Sam hob seinen Becher. »Danke, Si.«
»Gern geschehen.«
»Da ist was, das ich irgendwie kurz mal ansprechen möchte.«
Simon wartete und ignorierte Sams beiläufigen Tonfall.
Ein plötzlicher Windstoß schlug den Regen gegen die Fenster. »Ich hoffe, sie ist gut nach Hause gekommen.«
»Wer, Sandy? Um die mach dir mal keine Sorgen – sie ist eine Überlebenskünstlerin, wie sie im Buche steht. Und wenn es ums Entladen geht, arbeitet sie für zwei Männer.«
»Wo wohnt sie?«
»Über den Hügel Richtung Küste.«
»Mit Familie?«
»Nein, allein. Wenn es irgendwo eine Familie gibt, hat sie nie darüber geredet.«
»Kennst du sie gut?«
»Wie eine Nachbarin – jeder kümmert sich hier um jeden. Das muss sein. Sie ist mal auf eine Tasse Tee reingekommen, wenn sie etwas vorbeigebracht hat. Warum?«
Sam zuckte mit den Schultern und wandte den Blick ab. Simon lachte. »Nein«, sagte er. »Das soll wohl ein Witz sein. Sie ist … na ja … nein.«
»Okay. Deine Freundinnen sind immer megaschick, stimmt.«
»Und was ist mit deinen?«
»Hör auf!«
»Ella, so hieß sie doch?«
Sam warf ein Kissen nach ihm. »Hör zu … ich wollte Kieron danach fragen, aber dann, ich … ich glaube, dir vertraue ich einfach.«
»Kein Grund, ihm nicht zu trauen, Sam, er ist ein guter Mann … guter Polizist. Du kommst doch klar mit ihm, oder?«
»Ja, ja, und Mum ist glücklich, also … hält sie sich aus meinen Sachen raus.«
»Genau.«
»Die Polizei. Diese Sache mit SO17, die mir immer vorschwebte.«
Sam hatte schon immer zu den bewaffneten Sondereinheiten der Polizei gewollt, solange er und Simon sich erinnern konnten. Der ursprüngliche Plan war gewesen, einen guten Abschluss zu machen und dann zur Polizei zu gehen, um von dort im Schnellverfahren so bald wie möglich zur bewaffneten Sondereinheit zu wechseln. In den letzten beiden Jahren hatte er Gewehrschießen gelernt und schnell Geschicklichkeit entwickelt. Er hatte die County-Tabellen im Tontaubenschießen angeführt, sich aber geweigert, Wild zu töten. Das hatte zu einigen hitzigen Debatten mit Kieron geführt, der nicht verstehen konnte, wie sein Stiefsohn in Erwägung ziehen konnte, einen Menschen erschießen zu müssen, wenn er aus Prinzip nicht einmal einen Fasan töten wollte. Sam hatte einfach darauf bestanden, dass beides nichts miteinander zu tun hatte. Am Ende hatten sie sich auf Cats Drängen hin darauf geeinigt, das Thema gänzlich zu meiden.
»Ich hab nachgedacht … vielleicht neu überlegt.«
»Polizist zu werden?«
Sam rutschte hin und her. Er griff nach seinem Becher. Trank. Rutschte wieder hin und her. Simon wartete.
»Als du auf halber Strecke das Medizinstudium aufgegeben hast –«
»Weniger. Ich hatte nicht einmal das zweite Jahr beendet.«
»Okay, warum hast du das gemacht? Ich meine, der wahre Grund?«
»Der wahre Grund ist derselbe wie jeder andere. Ich wollte kein Arzt sein. Ich wusste es, bevor ich anfing, aber ich war … oh, ich weiß nicht, Sam, überredet, gedrängt worden. In dieser Familie wird man Arzt. Und ich war nicht absolut dagegen – jedenfalls nicht, bevor ich anfing. Und da wusste ich inzwischen, dass ich zur Polizei, nicht in die Medizin wollte.«
»Hast du es jemals bereut? Hast du gedacht, du könntest deine Meinung noch mal ändern?«
»Nicht eine Sekunde. Ich wäre ein miserabler Arzt geworden.«
»Das kannst du nicht wissen.«
»Ich weiß es. Aber ich wollte Polizist werden, und ich habe jede Minute genossen. Na gut – fast jede Minute.« Er berührte seinen Arm. »Das war ein Ausrutscher.«
»Okay.«
»Und? Wohin führt dich dein Nachdenken?«
»Kann ich bitte noch Tee haben?«
»Greif zu.« Er musste lauter sprechen, um gegen den plötzlich aufheulenden Wind anzukommen.
Sam war nicht auf den Mund gefallen, doch er war vorsichtig. Er ließ sich nicht zu ernsten Worten hinreißen, wenn er nicht sicher war, was er genau sagen wollte, aber Simon vermutete, dass Sam längere Zeit darüber nachgedacht hatte und jetzt einfach nur tief Luft holen musste. Er hätte nicht die lange, komplizierte Reise auf sich genommen, ohne es vorher einstudiert zu haben.
»Vielleicht habe ich meine Meinung über die Polizei geändert.« Er schien auf eine Reaktion zu warten, doch Simon zeigte keine. »Ich habe mir immer wieder mich selbst vor Augen geführt – das Leben … Verstehst du, ich habe mich gesehen wie ein Stück, das nicht ins Puzzle passt. Je mehr ich mich damit beschäftigte, über den Alltag las, desto stärker wurde dieses Gefühl. Ist das dumm?«
»Du weißt, dass es das nicht ist.«
»Ich würde dich enttäuschen.«
Simon schnaubte. »Du würdest niemanden enttäuschen, am wenigsten mich. Werde erwachsen.«
»Ich will keinen Fehler machen. Es wäre eine Verschwendung von allem … deshalb könnte ich … vielleicht meine Meinung ändern.«
»Klingt so, als hättest du dich schon anders entschieden.«
»Ach ja? Vielleicht stimmt es ja.«
»Viel besser ist, wenn du es jetzt weißt, Sambo, als nach einem Jahr der Ausbildung. Besser für dich hauptsächlich.«
»Stimmt …« Ein langes Gähnen unterbrach seinen Redefluss.
Simon stand auf. »Morgen reden wir weiter. Du bist total erledigt. Das Reservebett ist bezogen, aber ich werde noch mehr Decken suchen – solche Stürme lassen die Temperaturen rapide sinken.«
Sie gingen die Treppe hinauf, Sam holte sein Waschzeug und das T-Shirt, in dem er immer schlief, aus dem Rucksack, während das Bett gemacht und die Vorhänge vor der wilden Nacht zugezogen wurden.
»Si … ich will nur … ich meine, na ja, wir werden darüber reden, nur …«
»Ich soll deiner Mutter nichts sagen.«
»Genau.«
»Ich doch nicht.« Er legte den Arm kurz um Sams Schulter, nicht sicher, ob der die stürmischen Umarmungen noch annehmen würde, die er als Junge so geliebt hatte.
Sam setzte sich aufs Bett, um die Matratze zu prüfen. Er kippte zur Seite, um das Kissen zu prüfen, war innerhalb von fünfzehn Sekunden tief eingeschlafen und wurde nicht vor zehn Uhr am nächsten Morgen wach.
Unten schenkte sich Simon einen kleinen Whisky ein und setzte sich wieder aufs Sofa. Er war mitten in der Lektüre des Romans Der Spion, der aus der Kälte kam, dachte aber eine Weile an Sam. Wenn ihn dessen Entscheidung überrascht hatte, dann hatte er es sich nicht anmerken lassen. Aber Sam war so lange wie besessen von der Vorstellung gewesen, zur bewaffneten Sondereinheit zu gehen, was Cat immer große Sorgen bereitet hatte, dass es allem Anschein nach eine abgemachte Sache war. Nichts anderes, abgesehen von Kricket und Hockey – und er war in beiden Sportarten ein ausgezeichneter Spieler –, hatte ihn je interessiert. Simon hatte sich Mühe gegeben, ihn davon abzubringen, was die beste Möglichkeit war, die Festigkeit eines Entschlusses zu prüfen, doch Sam hatte nie geschwankt.
Was kam als Nächstes? Die Polizei, aber nicht die bewaffneten Sondereinheiten? Die Kriminalpolizei? Etwas anderes gab es nicht. Sam war helle, und er arbeitete hart, aber er war kein Intellektueller – eine akademische Laufbahn wäre nichts für ihn, ebenso wenig der Beruf eines Lehrers, und ein Leben in irgendeinem Büro würde ihn mit Sicherheit in den Wahnsinn treiben.
Sie würden einen Plan B finden müssen.
9
Von außen sah das Burleigh noch immer wie ein Hotel im Landhausstil aus, doch als Cat ins Foyer trat, merkte sie, dass es auf gepflegte, anspruchsvolle Weise verschönert worden war. Die Wände waren jetzt kittfarben, der Teppichboden braungrau, die Polster variierten zwischen cremefarben und hellgrau. Die Frontseite der Bar war, wie sich herausstellte, mit cremefarbenem Leder bezogen, die Hocker auch, nur in dunklerem Farbton. Die Beleuchtung war neu gestaltet. Es war intim, aber kühl, der italienische Einfluss überall spürbar.
Lukes Partner Enrico musste einige seiner vielen Millionen in dieses Haus gesteckt haben, in der Hoffnung, eine reichere und internationalere Klientel anzuziehen, doch da die Lage ausschlaggebend war, fragte sie sich, ob er wohl Erfolg mit einem Hotel haben würde, das außerhalb von Lafferton lag, wenn auch das Land grün und schön anzusehen war.
»Cat! Du siehst aus wie der junge Frühling!«
Sie wusste sofort, warum sie Luke vor fünfundzwanzig Jahren angehimmelt hatte. Er sah noch genauso aus, war noch schlank und wirkte jünger, als erlaubt war, hatte noch immer dichtes Haar, das allerdings auf attraktive Weise leicht angegraut war. Und er war charmant wie eh und je. Er nahm ihre Hände und küsste Cat auf beide Wangen.
»Und du hast nicht vergessen, wie man Komplimente macht. Es tut so gut, dich zu sehen, Luke.«
»Ich habe einen Tisch am Fenster. Lass uns zur Feier des Tages ein Glas Champagner trinken.«
Er führte sie durch den Raum, in dem es sehr ruhig war. Sie bemerkte nicht, dass er ein Zeichen gab, um eine Bestellung aufzugeben, aber als sie Platz nahmen, kam ein Kellner mit zwei Gläsern Veuve Clicquot.
»Dieser Anzug kann nur aus Italien sein«, sagte sie. Er war hellgrau, aus feinem Wollstoff, perfekt geschnitten, kombiniert mit einem schiefergrauen Hemd und einer fuchsroten Krawatte. Cat versuchte sich Kieron im selben Outfit vorzustellen und lächelte. Er war schick in Uniform, aber ansonsten das Gegenteil von elegant. Seit sie verheiratet waren, hatte sie sich bemüht, seine Garderobe in kleinen, unauffälligen Schritten aufzubessern. Chris war genauso gewesen. Simon hingegen – der könnte so einen Anzug gut tragen.
»Auf uns«, sagte Luke. Oliven wurden gebracht, dazu Toaststücke in Pennygröße mit einem Klecks Topfgarnelen, mit Dill bestreut, einem Teelöffel Kaviar oder einem Kringel Räucherlachs darauf.
Cat seufzte und lehnte sich zurück. »Was auch immer der Anlass sein mag«, sagte sie, »es ist so schön. Danke.«
»Stimmt, und jetzt erzähl mir von deinen letzten zwanzig Jahren und so, Dr. Deerbon. Du hast deinen Namen aus beruflichen Gründen nicht geändert, nehme ich an?«
Während sie den Champagner genossen, erzählte sie ihm von den Kindern, Chris’ Krankheit und seinem Tod, von Simon, Kieron. Richard erwähnte sie nicht – Luke wusste vom Tod ihrer Mutter aus den Todesanzeigen in medizinischen Fachzeitschriften.
»Okay, so weit das Privatleben. Kommen wir zur Medizin.«
»Das wird bis zum Ende des Hauptgangs dauern.«
»Kein Problem. Ich habe jede Menge Zeit. Und du?«
»Ich habe heute meinen freien Tag.«
Das Hotel hatte jetzt sowohl seinen früheren, formellen Speisesaal, als auch eine Brasserie. Luke überließ Cat die Wahl, und sie schaute über die Schulter in den Hauptraum.
»Tut mir leid, aber das wäre wie eine Mahlzeit in der Leichenhalle – da drinnen ist ja niemand.«
Die italienische Brasserie war sehr gemütlich, anheimelnd, die Tische standen nicht zu nah nebeneinander, und die Speisen waren sowohl auf einer Tafel hinter der Bar abzulesen als auch auf einzelnen Kreidetafeln, die an den Tisch gebracht wurden. Sie bestellten Linguine mit Krebs und Hummer, dazu einen Salat. Frisches warmes Brot und Olivenöl wurden vorab gereicht.
»Ich kenne den Zustand von Allgemeinpraxen generell«, sagte Luke, »aber wie steht es mit deiner persönlichen Erfahrung? Bring mich auf den Stand der Dinge.«
Cat tat ihm den Gefallen, legte detailliert ihre Zeit in der Palliativpflege im Imogen House Hospiz dar, die kurze Phase wieder als Partnerin in einer Praxis für Allgemeinmedizin, in der sie ihrer Meinung nach unterschätzt und gemobbt worden war, bis hin zu ihrer neuen Anstellung als Praxisvertretung.
»Das ist einerseits gut – die sind alle nett da, leisten Unterstützung und beziehen mich in Diskussionen und Besprechungen mit ein, als wäre ich eine Partnerin. Tatsache ist aber, dass ich es nicht bin. Ich nehme die Patienten an, die in letzter Minute kommen, die Überhänge, die keine Dauerpatienten sind. Ich erledige eine Menge Telefonberatungen. Da gibt es keine Kontinuität, oder nur sehr wenig, und ich sehe Patienten nur selten zweimal. Das Übliche.«
»Wie viele Wochenstunden hast du?«
»Insgesamt entsprechen sie dreieinhalb Tagen.«
»Ausstattung?«
»Nicht übel. Ich habe kein eigenes Sprechzimmer, aber das haben Vertretungen nie. Es funktioniert, da ich freie Zeit habe, um ein bisschen zu leben und meinen Mann zu sehen.«
»Du bist nicht überlastet.«
»Um Himmels willen, nein.«
»Aber auch nicht gut bezahlt.«
»Nein … Die Zeiten haben sich geändert. Ebenso wie die Ärzte.«
Cat hörte auf zu reden und aß. Die Linguine waren saftig, reichhaltig mit Krebs- und Hummerstücken versehen, der Salat mit dem besten Olivenöl angerichtet. Sie wollte ausgiebig genießen.
Luke schenkte ihnen beiden noch Eiswasser nach. Im Krug schwammen Limonenscheiben und frische Minze.
»Ich möchte dir etwas über Concierge-Medizin erzählen.«
Bitter Lemon Granitas und zwei Portionen Kaffee, so gut, wie ihn nur die Italiener zubereiten, kamen und gingen, und Luke hatte kaum Luft geholt. Doch nun leerte er seinen zweiten Espresso und lehnte sich zurück.
»Ich werde dich jetzt nicht nach deiner Meinung fragen – da gibt es vieles zu überdenken, es klingt kompliziert, obwohl es das eigentlich nicht sein wird. Aber als einzige Reaktion an diesem Punkt müsste ich von dir nur wissen, ob du etwas gegen das Prinzip hast – viele Ärzte sind absolut gegen Privatmedizin jeder Art, und ich respektiere das. Wenn du es auch bist, nun, dann hatten wir ein tolles Mittagessen, und es war schön, dich wiederzusehen.«
»Chris war absolut dagegen. Er hätte sich verabschiedet und wäre gegangen, noch bevor du das erste Viertel vorgebracht hättest. Ich war immer anderer Meinung, obwohl ich einige seiner Argumente nachvollziehen konnte, aber bei ihm kam Stolz mit ins Spiel, und dafür ist kein Platz, gerade in der jetzigen Form der Allgemeinpraxen.«
Luke wartete, ob sie fortfahren wollte, doch sie hatte nichts mehr zu sagen. Heute nicht. Jetzt nicht.
»Ich brauche eine Woche Bedenkzeit, bevor ich dir eine Antwort geben kann. Gibt es schon etwas Schriftliches?«
Luke griff in seine Jackentasche und zog eine Karte heraus. »Hier stehen meine genaue Adresse und die Angaben zur Website – ist natürlich noch nicht online, wurde von einem professionellen Designer gestaltet, und sie sagt dir absolut alles. Der Versuch, mit weniger Papier auszukommen, wenn auch nicht ganz ohne.«
»Danke. Ich verspreche, dass ich sie mir sehr genau ansehen und wieder auf dich zukommen werde – aber erst, wenn ich mir darüber im Klaren bin, wo ich stehe. Klingt allerdings sehr interessant.«
»Du sagst also nicht Nein.«
»Ich sage jetzt noch gar nichts, Luke, nur dass ich gern noch einen Kaffee hätte.«
Den Rest der Zeit verbrachten sie damit, sich über Studienkollegen auf den neuesten Stand zu bringen und Geschichten über den schrecklichen Zustand der Personalbeschaffung und die Laxheit der aktuellen Ausbildung auszutauschen. Cat fand, sie beide klangen wie ihre Eltern, als Cat mit dem Medizinstudium angefangen hatte – »Früher war alles besser«.
Luke begleitete sie zu ihrem Wagen und küsste sie wieder auf beide Wangen. »Ich kann’s kaum erwarten, von dir zu hören«, sagte er.
»Du wirst dich gedulden müssen. Danke fürs Essen.«
Er winkte ihr nach, als sie aus dem Tor fuhr. Sie hatte auf ihn den Eindruck gemacht, als sei sie einigermaßen interessiert an seinem Vorhaben, würde dem detaillierten Studium der Webseite aber keine Priorität einräumen. Tatsächlich war Cat viel neugieriger darauf, als sie sich hatte anmerken lassen. Ihr gefiel, was sie bisher gehört hatte, vor allem weil es einen möglichen Weg aus dem beruflichen Trott eröffnete, in dem sie sich befand. Als sie Luke gefragt hatte, ob sie Kieron etwas darüber erzählen dürfe, war er sogar begeistert gewesen. »Partner sind dabei wichtig, es betrifft ja den gemeinsamen Alltag. Sag es ihm ruhig, mich würden seine Ansichten interessieren. Ich hoffe, ich lerne ihn mal kennen – bin noch nie einem Chief Constable begegnet.«
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.