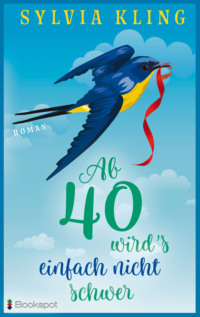Kitabı oku: «Ab 40 wird's einfach nicht schwer», sayfa 15
»Ich habe wahrscheinlich nur fünfundzwanzig Prozent verstanden, aber es hat mir gefallen.«
Der Professor lachte.
»Herr Professor Steiner, das ist meine Mutter«, er sah zu Silke, »Mama, das ist Professor Steiner, mein Mentor.« Sie reichte ihm die Hand. Jetzt konnte sie ihn näher betrachten. Was für ein charismatischer Herr! Von Schönheit im herkömmlichen Sinn konnte keine Rede sein. Seine große gebogene Nase erinnerte sie an den Schnabel eines Adlers. Er trug eine sehr starke Brille, durch die sie strahlend blaue Augen aufmerksam ansahen. Seine Gesamterscheinung war umwerfend.
»Du hast mir nie erzählt, solch eine hübsche Mutter zu haben, Julian.«
Sie duzten sich also bereits.
»Nein, das habe ich nicht. Stell dir vor, ich hätte dir von meiner Mutter vorgeschwärmt … in welche Persönlichkeitsstruktur hättest du mich gesteckt?«
Der Professor lachte auf und klopfte Julian freundschaftlich auf die Schulter.
Am Abend gingen Julian und sie gemeinsam essen. Er machte einen gelösten Eindruck, war deutlich aufgeblüht und gesprächiger als sonst.
»Julia hat sich gemeldet«, erzählte er strahlend.
»Wir wollen uns nächste Woche treffen und tanzen gehen.«
»Das ist ja toll! Ich freue mich!«
»Ich bin jetzt schon aufgeregt. Sie hat mich umgehauen. Wenn ich bisher von Schmetterlingen im Bauch hörte, dachte ich, es sei eine Mär. Ist es aber nicht. Bei mir fliegen Raumschiffe durch den Bauch.«
Silke lachte und legte ihre Hand auf seine.
»Alles wird so, wie du es dir wünschst, glaub deiner alten Mutter.«
»Nun hör aber auf. ›Alte‹ Mutter … Sagst du das, um Komplimente zu fischen?«, neckte er sie.
»Von meinem Sohn? Nein, eher nicht. Aber als ich heute deine Studentinnen sah, da fiel mir auf, dass ich alt werde. Es ist doch nichts Schlimmes, sondern der Lauf der Zeit.«
»Stimmt schon, aber du siehst fantastisch aus. Niemand wird dir in zwei Monaten die fünfzig abnehmen. Julia schwärmt regelrecht von dir!«
»Sie schwärmt von mir? Sie sollte von dir schwärmen«, lachte Silke.
»Mal sehen. Sie ist Lehrerin, ich bin Psychologe. Das könnte sehr spannend werden.«
»Das ist wahr. Aber besser spannend als langweilig, mein Sohn.«
Der Abend ging dem Ende zu. Nur noch ein Tag, übermorgen würde sie abreisen. Und sie hatte begonnen, ihren Sohn neu kennenzulernen.
Als sie am folgenden Morgen erwachte, wusste sie es. Sie wollte zum Grab von Martina gehen. Seit ihrem Tod war sie nie da gewesen. Ihren Kolibri trug sie im Herzen; sie sah Martina im Spiegel. An einem Grab zu stehen, das wollte sie nie. Ihr reichte Harrys Grab, das sie nie verließ, ohne zu weinen.
Martina war auf dem Waldfriedhof Zehlendorf beerdigt. Ungefähr wusste sie noch, wo es sich befand. Es gibt Momente im Leben, in denen man entweder nichts um sich herum wahrnimmt oder jede Einzelheit. An jenem sonnigen Tag hatte sie alles registriert. Sie gelangte über die B 1 nach Zehlendorf und kam nach fünfzehn Minuten am Friedhof an. Heute hätte sie sich gewünscht, etwas länger fahren zu müssen. Sie wollte sich mental vorbereiten. Wie würde das Grab aussehen? Ob Ralf es regelmäßig pflegte – oder seine Eltern? Wie ging es ihm und wo wohnte er jetzt? Hatte er eine neue Partnerin gefunden? So viele Gedanken schossen ihr durch den Kopf, für die sie Zeit gebraucht hätte. Doch sie hatte sich spontan entschieden und musste da jetzt durch. Ihr Herzschlag beruhigte sich, als sie langsamen Schrittes die Wege entlangging, die sie acht Jahre zuvor gegangen war, um Martina die letzte Ehre zu erweisen. Da wusste sie noch nicht, dass sie ihrer Freundin im Badezimmerspiegel begegnen würde. Sie hatte geglaubt, ihren Engel nie wiederzusehen. Vielleicht war sie deshalb gerade ruhiger, als sie es für möglich gehalten hätte. Nach einigen Minuten auf diesem Weg schreitend, setzte sie sich auf eine Bank. Erinnerungen durchströmten sie.
Rückblick
Martina war der Semmelpilz. Wir waren zusammen so oft Pilze sammeln, dass wir uns als Fünfzehnjährige diese Spitznamen füreinander ausdachten. Sie, die Blonde, ich die Brünette. Wir waren nicht immer Freundinnen gewesen. In der Schule hatten wir uns eher gemieden. Martina, die Kecke, konnte mit mir, dem Mauerblümchen, erst nichts anfangen. Ich bewunderte sie, mied sie aber.
Bis zu jenem Tag in der siebten Klasse, als sie mich mithilfe von Sabine vor den bösen Jungs beschützte.
Wir wurden Freundinnen und schworen einander ewige Treue. Für uns gab es keinen Zweifel daran, dass wir später auf einer Parkbank sitzen und uns täglich Geschichten aus unserem Leben erzählen würden. Es würde nie langweilig werden und das Älterwerden sollte uns nichts anhaben, sondern unsere Schönheit noch durch die Ausstrahlung von Erfahrung unterstreichen. Nie wollten wir vergessen, wie toll das Leben war. Die Gegenwart würden wir als Geschenk betrachten, um die Vergangenheit zu würdigen und der Zukunft einen eigenen Namen zu geben, unseren Namen.
»Das Leben wird auf uns warten wie ein ungeduldiger Geliebter«, hatte Martina in ungewohntem Pathos gemeint.
»Okay, mein lieber Semmelpilz, so wird es werden. Ein verschrumpelter Semmelpilz und vertrockneter Braunedel. Was für eine Vorstellung!«
Ich kicherte und gab ihr einen Schmatzer auf die Stirn.
»Schimmelpilz und Weißedel sind wir dann wohl eher!«, antwortete Martina und wir lachten in unsere Zukunft hinein.
Nun saß sie allein auf der Bank, einer Friedhofsbank. Ohne Martina. Sie ließ ihre Tränen laufen und achtete auf nichts um sich herum. Carola hatte gesagt, sie solle weinen. Frau Schröder würde sie in den Arm nehmen und streicheln, bis ihre Tränen versiegt wären. Doch auch allein zu weinen hatte in diesem Augenblick seinen Sinn.
Einige Minuten später erhob sich Silke und ging den Weg langsam weiter, den sie in Erinnerung hatte. Sie besann sich – es war ein heller Marmorstein mit bronzefarbener Schrift und einer Rose, die über den Stein hinausragte. Ralf hatte ihr noch ein Foto geschickt, bevor sie ihn aus den Augen verlor. Es dauerte nicht lange und sie stand vor dem Grab.
»Martina Severin, geb. Köhler
geb. am 8. August 1969,
gestorben am 9. September 2011
Wo du sein wirst, werden Rosen blühen,
es wird Gold regnen,
die Grillen werden das Geschrei der Raben übertönen
und Trauerweiden ihre Zweige heben.«
Ralf hatte jene poetischen Worte als Aufschrift gewählt, die er zu Martina am Krankenbett gesagt hatte, als sie ihm von ihrem Traum erzählte. Sie hatte vom Tod geträumt. Später hatte sie auch mit Silke darüber gesprochen und Ralfs Worte wiederholt.
Das Grab war liebevoll gestaltet. Man sah, dass sich hier jemand mit Hingabe um die Pflege kümmerte. Frische Blumen leuchteten bunt, eine Kerze brannte und um sie herum standen fünf Herzen, die auf Stielen in der Erde befestigt waren. Silke schloss die Augen. So hatte sie es sich vorgestellt.
»Mein Kolibri, heute bin ich hier, nach so langer Zeit. Dabei sehen wir uns so oft«, lächelte Silke mit tränenverschleierten Augen und schickte sich an, sich umzudrehen, um nach einem Behälter und Wasser für ihre Blumen zu suchen.
»Silke?« Eine Männerstimme. Sie drehte sich erschrocken um. Da stand er.
»Ralf!«
Mehr brachte sie nicht heraus. Es war auch nicht nötig. Spontan umarmte er sie.
»Es ist so schön, dich wiederzusehen.«
Seine Stimme war unverändert klar. Doch von dem einst schönen und muskulösen Traummann war nichts mehr übrig. Er hatte deutlich an Gewicht verloren, seine Wangen waren eingefallen, sein Haar nicht mehr schwarz, sondern fast vollständig weiß. Nicht nur der Zahn der Zeit hatte an ihm genagt, auch der unübersehbare Schmerz.
»Erschrocken?«, fragte er. Es gab Momente im Leben, da musste man schweigen.
»Ich freue mich auch so sehr, dich zu sehen. Ich habe dich nie vergessen, wir haben uns einfach verloren«, sagte sie leise.
Er schüttelte den Kopf.
»Ich wollte keinen Kontakt, zu niemandem, der Martina kannte, und erst recht nicht zu dir, die so eng mit ihr befreundet war. Ich konnte nicht den Schmerz anderer auch noch sehen. Mein eigener hat mich fast von innen aufgefressen, wie du siehst.«
Silke verstand. Jetzt verstand sie.
»Wo ist dein Mann – oder bist du allein in Berlin?«, fragte Ralf. Verdutzt sah sie ihm in die trüb gewordenen Augen.
»Ralf, Harry ist vor vielen Jahren verstorben.«
Er schloss die Augen und schüttelte langsam den Kopf.
»Wenn es einen Gott gibt, warum nimmt er sich zuerst die Besten? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?«
Natürlich hatte sie.
»Simba fragt seinen Vater Mufasa: ›Vater, warum sterben die tollsten Leute immer zuerst?‹ Da antwortet der Vater: ›Wenn du auf einer Wiese voller Blumen bist, welche reißt du zuerst ab?‹«
Ralf lächelte. »Ich kenne es. Es ist aus ›König der Löwen‹. Martina liebte es. Aber, Silke, das ist ein Trickfilm. Ich sprach von Gott! Während meiner Therapie hatte ich mich viel damit beschäftigt und mit einem Pastor gesprochen. Und da, ja, da habe ich alles verstanden. Gott entscheidet das nicht. Die Tragödien kommen vom Teufel, der uns in die gottferne Verzweiflung treiben will. Die paar Jahre oder Jahrzehnte hier unten in unserer vergänglichen Hülle sind ein Nichts in Relation zu dem, was auf uns wartet: Der Himmel, die herrlich paradiesische Gemeinschaft mit Gott. Und das für alle Zeit. Die Ewigkeit hat kein Ende.«
Ralf hob theatralisch die Hände und wandte sein Gesicht mit geschlossenen Augen dem Himmel zu. Silke beobachtete ihn fassungslos. Jetzt starrte er sie mit weit aufgerissenen Augen an. Was war mit diesem Mann nur geschehen? Was redete er nur für wirres Zeug? Vor allem: wie? Sie schwieg. Sie hatte nicht das Recht, seine Ansichten zu kritisieren. Seine Jahre und seinen Schmerz hatte sie nicht gelebt. Mit einem lauten Lachen riss Ralf sie aus ihren Gedanken, griff Silke am Arm und schüttelte sie, während er mit erhobener Stimme weitersprach:
»Weil wir dadurch lernen können, ihm, unserem himmlischen Vater, unserem Schöpfer, zu vertrauen. Er möchte, dass wir ihn an erste Stelle setzen. Unsere Lieben sehen wir einige Jahre, Gott sehen wir in Ewigkeit, wenn wir selbst sterben und zu Jesus gehen. Verstehst du, Silke? Es ist alles ganz einfach!«
Er lachte irre. Jetzt konnte sie es sehen. Stand er unter Drogen? Seine Pupillen waren geweitet. Das war nicht mehr Martinas Ralf. Es war ein anderer. Ein Mensch, der versuchte, eine Lösung zu finden, um zu verstehen, um einfach weiterzuleben. Ralf hatte den Faden verloren, den Martina immer in der Hand gehalten hatte.
»Ralf, ich muss jetzt nach einem Behälter und …«
Weiter kam sie nicht.
»Natürlich, aber ja!«
Wieder hob er seine Hände pathetisch und ging dann in seltsam ungelenken Schritten vor ihr her. Silke versuchte, nicht zu weinen. Sie spürte, wie sich ihr Brustkorb zusammenzog.
Nachdem die Blumen auf Martinas Grab einen würdigen Platz gefunden hatten, gab sie Ralf ihre Telefonnummer und Anschrift.
»Es wäre vielleicht schön, wenn wir uns nicht wieder verlieren würden. Was meinst du?«
»Wir werden uns nie verlieren, Martina. Niemals. Der Herr wacht über uns.«
»Martina« sagte er und verdrehte dabei seine Augen. Silke umarmte ihn und rannte panisch vom Friedhof.
Wie sie in die Pension gelangt war, wusste sie nicht. Auch nicht, wie viele Stunden seit ihrer Rückkehr vergangen waren. Erst durch ein Klopfen an der Tür schrak sie vom Bett auf.
»Mama?« Julian! Erschöpft rief sie »herein« und versuchte, sich aufzurichten. Ihr Sohn kam drei Schritte ins Zimmer herein und blieb abrupt stehen.
»Mama? Was ist passiert?«, rief er und eilte zu Silke, die mit zerzaustem Haar und verweinten Augen zu ihm hin sah. Und wieder. Ein Sturzbach von Tränen brach aus ihr heraus. Julian hielt seine Mutter im Arm. Erst als sie sich etwas beruhigt hatte, konnte sie schluchzend von ihrer Begegnung mit Ralf erzählen.
»Er ist abgestürzt«, schlussfolgerte ihr Sohn. Sie nickte.
»Mama, ich möchte das nicht psychologisch analysieren. Vielleicht wäre dazu ein anderes Mal der rechte Augenblick, nicht jetzt. Wichtig ist, dass du das verdaust, dass es dir besser geht.« Sie nickte.
»Wie soll ich das nur Martina erklären?«
Als Julian sie beunruhigt ansah, wurde ihr bewusst, was sie gesagt hatte.
»Wie meinst du das, Mama?«
»Manchmal sehe ich sie eben, im Badezimmerspiegel. Deinen Papa auch«, antwortete sie schluchzend. Es war gesagt. Julian biss sich auf die Unterlippe.
»Okay, Mama, halten wir mal eins fest: Du bist ein Glückspilz. Weißt du das überhaupt?«
Keine psychologische Predigt, keine Kritik oder etwa die Bitte, dass sie sich an einen Psychologen wenden sollte. Julian lächelte versonnen.
»Wenn ich dich besuche, darf ich dann mal … in deinen Spiegel sehen?«, fragte er. Und weinte. Einfach so. Mitten in seinem Leben. Endlich.
Zwei Stunden später, erschöpft vom gemeinsamen Weinen, entschlossen sie sich, aufzubrechen und den Tag mit anderen Eindrücken abzuschließen. Sie sahen sich die Alte Galerie an, schlenderten durch Parkanlagen, unterhielten sich lange und viel und gingen essen. Julian war wie ausgewechselt. Sie hatte das Gefühl, dass sie sich wiedergefunden hatten, Mutter und Sohn. Und Berlin hatte es ihr angetan. Sie wollte bald wiederkommen.
»Das nächste Mal bin ich dran«, meinte Julian zum Abschied.
»Apfelkuchen und Nudelsalat?«
»Logisch!« Er umarmte sie fest und flüsterte:
»Putz den Spiegel, bevor ich komme!«, zwinkerte ihr zu und küsste sie herzhaft auf die Wangen.
»Vielleicht kommst du nicht allein?«
»Vielleicht.«
Das war ein Anfang.
13. Kapitel
Carola und »Anastasias Kolibri«
»Dieser Brief, meine Silke, wird Ihnen eines Tages Kraft geben. Ich weiß es.«
Lydia Schröder
Nach ihrer Rückkehr versuchte Silke drei Tage lang Carola zu erreichen. Aber ihr Handy schien ausgeschaltet zu sein. Was war nur los? Langsam wurde sie unruhig und dachte zurück. In den ersten zwei Tagen ihres Aufenthalts in Berlin hatte sie sich mit Carola noch über WhatsApp ausgetauscht und ihr Bilder vom Alexanderplatz, von Julian und sich geschickt. Sie sah auf ihr Smartphone, um sich zu vergewissern. Caro hatte darauf noch am zweiten, dem Regentag, geantwortet. Am dritten Tag hatte Silke ihr wieder Fotos und liebe Grüße geschickt, am vierten Tag ein paar Bilder vom Ballhaus und das Foto, das Julia von ihr und ihrem Sohn geschossen hatte. Die Nachricht war gelesen worden, aber es kam keine Antwort. Na und? Caro war nicht ihr Eigentum. Jeder hatte die Freiheit, sein Smartphone auszuschalten. Oder ihr Handy war einfach nur kaputt, das konnte ja schließlich vorkommen! Wenn nur dieses flaue Bauchgefühl nicht wäre!
Die Koffer waren längst ausgepackt, die Wäsche gewaschen und noch hatte sie Urlaub. Am Freitagmorgen sah sie wie so oft aus dem Fenster, während die Kaffeemaschine lief. Inzwischen hatte der Herbst die Bühne betreten. Sie freute sich schon darauf, wenn sie mit den Füßen durch das Laub rascheln oder die schönsten farbigen Blätter sammeln und wenn sie endlich ohne Fliegenklatsche durch ihr Haus gehen konnte. Doch immer wieder schweiften ihre Gedanken zu Caro. Spontan entschlossen zog sie sich nach dem Frühstück an und fuhr mit ihrem Auto zu »Fortunas Licht«. Mit einem seltsam alarmierenden Gefühl in der Magengrube stieg sie aus und setzte Schritt für Schritt wie im Zeitlupentempo in Richtung Haus. Still war es, sehr still. Wie … nein. Sie musste die Nerven bewahren. Schließlich hatte man noch Vormittag, der Betrieb begann erst am frühen Abend. Auf ihr Klingeln hin musste sie ziemlich lange warten, bis sich die Tür öffnete. Carolas hübsche Tochter erschien mit einer schwarzen Jeans und einem schwarzen Shirt. Das Haar lag wie ein Kranz um ihr Gesicht. Sie war so blass, dass Silke zurückschrak.
»Ja?«, fragte sie und rieb sich die Augen, die von dunklen Schatten umrandet waren.
»Ich bin Silke, erinnerst du dich an mich? Ich bin mit deiner Mutter über WhatsApp in Kontakt, kann sie aber seit Tagen nicht erreichen.«
Die Tochter winkte sie herein und bat sie, sich in der leeren Gaststube zu setzen.
»Kaffee?«
»Ja, gern.«
Sie könnte doch nun wirklich Carola rufen, immerhin wohnt sie nur einen Treppenaufgang entfernt!, dachte Silke und hämmerte sich diesen Satz ein: Gleich kommt Caro die Treppe runter, verrückt, herzlich und in ihrer bequemen Hose, einem sportlichen Shirt und ungeschminkt, wie sie am besten aussah. Sie starrte zur Tür. Sie wird kreischen vor Freude, ich werde mit ihr kreischen, wir werden uns herzen und verdammt noch Mal echte Freundinnen werden. Ganz genau so! Silke starrte zur Tür. Doch dieses leere Gefühl in ihrem Magen, obwohl sie gefrühstückt hatte, konnte sie nicht ignorieren. Wie damals, in ihrem Schlafzimmer, war hier die Stille anders als sonst. Die Tochter bereitete zwei Kaffees zu und setzte sich zu Silke, sah ihr lange in die Augen und senkte dann traurig den Blick.
»Mutti ist vor zwei Tagen verstorben.«
Es brauchte keiner Worte mehr. Die Tränen konnte Silke nur mit Mühe zurückhalten. Sie sollten später kommen.
»Sie fühlte sich schon seit Wochen nicht wohl, weigerte sich aber, wieder ins Krankenhaus zu gehen. ›Mit diesen Chemos machen die mich noch mehr kaputt, als der Krebs es tut‹, behauptete sie. ›Wenn ich sterben soll, dann will ich das hier, zu Hause tun. Bei meinen Lieben!‹ Sie verbot mir, den Arzt zu rufen. Mein Mann meinte, ein Mensch würde spüren, wann es unwiderruflich dem Ende zugeht. Er bettelte mich an, meiner Mutti das Recht einzuräumen, über ihr Leben selbst zu entscheiden. Vorgestern rief sie uns zu sich und wir hielten ihre Hand. Sie ist friedlich eingeschlafen.«
Die Tochter begann zu weinen. Silke umarmte sie und hielt sie fest, wiegte sie wie ein Blatt im sanften Wind. Als sie sich lösten, war der Kaffee schon kalt und Silkes Augen noch immer trocken. Die Tränen schlummerten in ihrem Herzen. Sie spürte es, wenn sich ihr Brustkorb zusammenzuziehen schien, wenn ihr Herzschlag sich beschleunigte und ihre Augen brannten. Zum Abschied übergab die Tochter ihr einen Brief.
»Für mich?«, stutzte Silke.
»Ja, für dich. Mutti sagte: ›Das ist auch so eine liebe Verrückte, gib ihr den Brief.‹ Du weißt ja, wie sie ist. War.«
Silke nickte. Sie wusste, was Carolas Tochter gerade durchmachte.
»Darf ich zur Beerdigung kommen?«
»Natürlich, warum fragst du das? Gib mir deine Nummer und ich schreibe dir den Termin, sobald wir ihn kennen.«
Sie tauschten ihre Nummern aus und Silke ging zitternd hinaus. Wie sie nach Hause gekommen war, wusste sie später nicht mehr. Nur, dass dieser Schmerz von ihrem Körper Besitz ergriffen hatte. Ein Schmerz, den sie kannte.
»Liebe Silke,
jetzt scheint es bald so weit zu sein, dass ich mich von meinem Leben verabschieden muss. Ich hatte es nicht geschafft, den Krebs für immer zu besiegen. Er kam wieder. Ich habe ihn dann einfach an der Hand genommen und gesagt: ›Wie ich sehe, kannst du nicht von mir lassen. Ich scheine ja sehr interessant zu sein. Gut, dann gehen wir gemeinsam den Weg bis zum Ende.‹ Ich mochte es noch nie, wenn die Leute sagten: ›Kämpfe gegen den Krebs.‹ Warum sollte ich gegen etwas kämpfen, was in meinem, ja, in meinem Körper ist und sich dort zu Hause fühlt? Ich habe mit ihm gesprochen und ihm gesagt, dass ich gern noch weiterleben möchte und er sich überlegen sollte, ob er nicht noch warten könnte. Oder ob er nicht noch ein wenig außerhalb meines Körpers spazieren gehen möchte. Aber offenbar hat er an mir einen Narren gefressen.
Lächelst Du jetzt? Ich würde es mir so sehr wünschen, dass Du ins Leben strahlst. Und ich hätte Dich so gern näher kennengelernt. Du bist etwas Besonderes: wie ich ein bisschen irre, eine liebe Seele und eine ehrliche Haut (na gut, bis auf … Du weißt schon). Ja, ich weiß, dass Du mich anfangs nicht leiden konntest. Bitte mach Dir deshalb keine Vorwürfe!
Gerne hätte ich noch erlebt, wie mein Enkelkind geboren wird, denn meine Tochter ist im dritten Monat schwanger. Aber leider ist mir das nicht vergönnt. Dafür glaube ich ganz fest daran, dass es irgendwas nach dem Tod gibt und ich Euch alle sehen kann. Nicht so wie jetzt. Anders, aber nicht weniger schön.
Meine Liebe, bitte genieße Dein Leben. Vielleicht siehst Du mich auch mal in Deinem Badezimmerspiegel? Es würde mich freuen. Aber nicht so lange, Du weißt, warum.
Mach’s gut!
Deine Caro
PS: Wäre der Brief ein Smartphone, würde ich ein ordentliches Herz schicken. So male ich Dir eins, schief und bucklig, aber dieses Herz kommt von Herzen.«
Unter dem Brief leuchtete ein rotes Herz, das nur mit Mühe als solches erkennbar war. Und gerade das brachte Silke aus der Fassung. Sie ließ den Brief sinken und verkroch sich in ihrem Wohnzimmer, schloss die Fenster, ließ die Jalousien runter und weinte. Manchmal leise, manchmal so laut, dass die eigenen Ohren schmerzten.
Am Samstagmorgen klingelte es an ihrer Haustür. Wer sollte das sein? Im Schlafanzug und nach tränenreicher Nacht, mit verweinten Augen, die Haare noch ungekämmt, öffnete sie vorsichtig die Tür. Frau Schröder.
»Hallo, Silke, was ist passiert?«, kam sie sofort zur Sache. Silke sah zu Boden und begann wieder zu weinen.
»Caro … sie ist …«
»Lassen Sie die Tür auf, ich komme gleich wieder«, flüsterte die alte Dame und kehrte kurz darauf mit ihrem Geschichtenbuch zurück. Sie setzten sich zusammen auf Silkes Couch.
»Sie ist einfach gestorben. Ich habe zu lange gewartet. Sie ist tot. Nicht mehr da. Wie Martina. Wie Harry. Weg. Einfach so …«, stammelte sie. Frau Schröder streichelte ihre Handfläche und nahm sie dann in den Arm. Die Nachbarin wiegte sie nun wie Silke tags zuvor Carolas Tochter. Silke löste sich kurz und übergab Frau Schröder den Brief, den sie gleich las. Und lächelte. Dieses weise Lächeln mit den weichen Lippen einer Mutter.
»Ein wunderschöner Brief, voller Liebe und Sehnsüchte. Carola war eine zauberhafte Person. Dieser Brief, meine Silke, wird Ihnen eines Tages Kraft geben. Ich weiß es.«
Wieder weinte Silke und wieder nahm Frau Schröder sie in den Arm.
»Soll ich Ihnen eine Geschichte vorlesen?«
»Ja«, flüsterte Silke und schnäuzte sich.
»Legen Sie sich hin, machen Sie es sich bequem.«
Sie griff nach einer Wolldecke auf der Couch und legte sie liebevoll über Silke.
»Wissen Sie, ich wollte meine Geschichten immer veröffentlichen, ließ dann aber davon ab. Manches sollte man nur Menschen zeigen, die verstehen. In dieser Geschichte geht es ums Loslassen, wenn auch auf andere Weise. Es geht um Leben und Vertrauen. Sie heißt ›Anastasias Kolibri‹.
Anastasia saß gedankenversunken an ihrem Schreibtisch und feilte an Worten. Es wollte ihr heute nicht so recht gelingen, ihrer Geschichte die nötigen Akzente zu setzen. Immer wieder schweiften ihre Gedanken zu Emilio ab, der ihr Herz im Sturm erobert hatte und mit seinem italienischen Charme unglücklicherweise alle Frauen begeisterte. Es war schrecklich. Egal wo sie zusammen auftauchten, er zog die Menschen regelrecht in seinen Bann. Oft musste er kaum etwas dafür tun. Seine unglaubliche Aura verzauberte Frauen wortlos. Seine Augen strahlten wie meeresblaue Sterne. Mit seinem Schnurrbart wirkte er gediegen und gleichzeitig lustig. Er vereinte in sich all das, was die Menschen offenbar brauchten. Für Anastasia war das ein Dilemma. Emilio war zu allen, denen er im Alltag begegnete, freundlich und zuvorkommend.
Natürlich war er, ihrer Meinung nach, zu den jungen Frauen mit langen Haaren besonders freundlich. Da bekam sein Lächeln eine exquisite Note, eine eigenartige Süße zierte seinen Mund. Sie stand manchmal daneben und sah zu, wie die Frauen sein liebliches Lächeln mit Koketterie quittierten.
Anastasia fühlte sich in diesen Momenten unwohl und nicht selten hatte sie den Impuls, davonzulaufen. Es gab immer wieder Reibungspunkte zwischen ihnen und offenbar fühlte er sich mit ihrer ständigen Eifersucht überfordert. Sie führten eine sehr warmherzige, tiefgründige und enge Beziehung, wenn sie allein waren. So wollte sie das auch, denn die Vergangenheit hatte sie gelehrt, dass Oberflächlichkeiten ihr nichts gaben. Sie hatte gezwungenermaßen schon zu oft versucht, sich zu verbiegen. Nun war die Zeit gekommen, kein Bäumchen mehr zu bleiben, sondern ein Baum zu werden, über sich herauszuwachsen.
Da war die Autonomie, die ihr wichtig war, aber auch die Bedingungslosigkeit und das grenzenlose Vertrauen. Erst kürzlich schrieb sie eine Abhandlung darüber, wie weit in dieser sexuell offenen Gesellschaft eine tiefe Liebe noch Bestand haben konnte. Da kannte sie Emilio noch nicht. Ihr Lektor bemühte sich um Sachlichkeit, doch als sie ihre Arbeit in einem Café besprachen, schmunzelte er ein wenig zu oft, wie sie fand.
Heute schien sie ihre Eifersucht beinahe zu zerreißen und sie hasste diese negativen Gefühle, die sie überschwemmten und ihr keinen Raum ließen. Sie störten ihre Ruhe, ihre Kreativität und die innere Ordnung, die sie so mochte. Emilio hatte ihr in einem Streitgespräch einmal vorgeworfen, sie würde in einem Elfenbeinturm leben und ihre eigene Lebensphilosophie zu einem Dogma auswachsen lassen. So empfand sie das nicht. Einerseits versuchte Emilio stets, ihr zu zeigen, wie wichtig sie ihm war. Gleichzeitig aber schmierte er anderen Frauen Honig ums Maul, was sie ärgerte und beunruhigte.
So schloss sie sich in ihren Gedanken ein. Die Vorhänge waren nur leicht geöffnet. Es schimmerte gerade so viel Licht hindurch, wie sie zum Schreiben brauchte. Anastasia lehnte sich zurück und atmete tief durch. Doch so kam sie nicht weiter. Sie sehnte sich jetzt nach ihrem Lieblingsort, um die Natur zu genießen und Freiheit zu spüren. Wenn sie nur nicht so müde wäre …
Die Luft war warm, beinahe schwül. Mit Jacke, Decke und einer Wasserflasche spazierte sie in Richtung See. Es war ihr großes Glück, von so viel Natur umgeben zu sein, und sie freute sich auf ihr geliebtes Plätzchen. Schon nach zehn Minuten gelangte sie an den See. Im Sommer gingen die Anwohner der umliegenden Dörfer hier sogar baden. Anastasia blieb stehen und lauschte dem Gekreische aufgeregter Vögel. Es dauerte jedoch nicht lange und der Krach verstummte. Sie vernahm nur noch ein leises Summen im Schilf. Der sanfte Wind spielte mit den Blättern der Bäume. Die Stelle, an der sie immer saß, war nicht zu übersehen. Das Gras war plattgedrückt und in einen Radius von drei Metern von hohem Schilf umgeben. Man blickte gerade noch durch den dichten Bewuchs auf den See. Sie mochte ihre Oase, ihr kleines Rückzugsgebiet, ihre heimliche Idylle.
Anastasia hockte sich hin. Der laue Wind spielte mit ihrem Haar. Fast andächtig legte sie die Decke auf den Platz mitten im Schilf und streckte sich genüsslich darauf aus. Die Jacke knüllte sie zusammen und schob sie unter ihren Kopf. Sie schloss die Augen und dämmerte vor sich hin. Neue Ideen für ihre Geschichte keimten in ihr, als sie es ganz nahe zwitschern hörte. Anastasia öffnete erst ein Auge, dann das andere und glaubte kaum, was sie sah. Ein Kolibri sah sie mit großen Augen an und zwitscherte so entzückend, dass sie kaum zu atmen wagte. Dieser kleine wunderschöne Vogel schwirrte tatsächlich unmittelbar vor ihrer Hand auf und ab.
Er bewegte seine Flügel kaum hörbar und doch unglaublich schnell.
»Was machst du denn hier, du kleiner Schöner?«, flüsterte sie und bewegte sich noch immer nicht. Dann geschah das Unglaubliche. Der Kolibri hüpfte mit einem kleinen Satz auf ihre Hand und rieb seinen Schnabel an ihrem Finger.
Irgendwann muss ich mich ja mal bewegen, dachte sie und flüsterte wieder leise: »Du bist ja ein sehr zutrauliches Vögelchen!«
Unbeirrt zwitscherte das Vögelchen weiter. Ab und an sah es zu ihr auf. Anastasia schüttelte tief bewegt den Kopf und glaubte zu träumen.
Der Kolibri hatte wunderschönes Gefieder. Es glänzte beinahe metallisch grün und an seinem Kopf, der Kehle und Brust waren die irisierenden Farben kaum zu unterscheiden. Solch einen wunderschönen Vogel hatte Anastasia noch nie gesehen.
Es dauerte lange, ehe der Kolibri sich mit einem leichten Flügelschlag erhob und davonflog. Anastasia drückte die Tränen weg, die in ihren Augenwinkeln hockten. So etwas Wunderbares hatte sie noch nie erlebt. Ihre Glieder fühlten sich von der langen Bewegungslosigkeit steif an und sie bewegte sich vorsichtig, um ihren Körper wieder zu beleben. Eine Stunde lag sie noch auf ihrem Lieblingsplatz und dachte über das zahme Vögelchen nach. Zwischendurch nickte sie ein wenig ein, während die Sonne auf dem See in einem Lichtspiegel zu versinken schien.
Am nächsten Tag konnte sie nichts mehr halten. Sie achtete darauf, zur selben Zeit wie am Vortag am See zu sein und ließ sich bei ihrem Lieblingsplatz nieder. Es dauerte nicht lange und der Kolibri nahm wieder auf ihrer Hand Platz. Er rieb possierlich sein Schnäbelchen an ihrem Zeigefinger.
Heute sprach sie mit ihm etwas lauter und bewegte sich auch ein wenig. Wenn sie sprach, stand der Schnabel des Kolibris still. Kaum schwieg sie, zwitscherte er wieder munter los. Es schien, als ob der Vogel ihr antwortete. Er bewegte sein niedliches Köpfchen auf und ab. Anastasia lachte darüber und imitierte ihn.
So traf sie ihren kleinen Freund jeden Tag. Immer wieder flog er auf ihren Finger und nach einer gewissen Zeit wieder davon.
Sie fühlte sich glücklich und war regelrecht vernarrt in ihren gefiederten Freund. Als er begann, immer zutraulicher zu werden, betrachtete sie seine Zunge. Sie war extrem lang und wenn das Vögelchen begann, mit ihrem Finger sprechen zu wollen, streckte er sie weit heraus.
An den Abenden dachte sie kaum noch an ihre Beziehungsprobleme. Emilio war in ihren Gedanken gegenwärtig, aber nicht mehr mit dieser negativ besetzten Rolle des Frauenjägers. Bereits nach dem zweiten Tag gab sie ihrem Kolibrifreund den Namen »Kolimein« und sie wünschte sich inständig, malen zu können. Sie würde Kolimein auf Leinwand malen und die Stimmung des Vertrauten zwischen ihr und ihm einfangen.