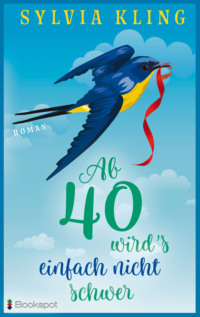Kitabı oku: «Ab 40 wird's einfach nicht schwer», sayfa 16
Die Zeit spielte auf dem Bild keine Rolle, auch nicht der Nieselregen, der sie am Vortag zu vertreiben drohte. Das Bild wäre wunderschön und sie malte es in ihrer Fantasie. Die Zuneigung, die ihr dieser kleine Vogel so völlig unerwartet schenkte, machte sie weich. Es gab keinen Tag, an dem sie befürchtete, er käme nicht wieder.
Das Wetter schlug um, der Wind wirbelte bereits erste Blätter durch die Luft. Immer wieder regnete es, die Luft wurde kühler und dunkle Wolken hingen über dem Dorf. Das machte Anastasia unruhig, denn die erfüllende Zeit mit Kolimein neigte sich ebenso wie der Sommer ihrem Ende zu. Die Trauer verschleierte ihren Blick, das düstere Wetter verstärkte ihre trübe Stimmung.
Anastasia fasste einen Entschluss.
Sie fuhr in die Kleinstadt in ihrer Nähe und kaufte einen wunderschönen Käfig mit bunten Verzierungen am Rande der Einfassung. Dieser Käfig war ein Einzelstück, sie trug ihn stolz und behutsam nach Hause. Das Unikat war genau richtig für ihr besonderes Vögelchen. Als die Zeit ihres Treffpunktes näher rückte, konnte sie es kaum erwarten.
Wie jeden Tag lief sie voller Erwartungen zu ihrem Treffpunkt. Kaum setzte sie sich, eingepackt in eine warme Jacke, auf ihre flachgedrückte Stelle, flog auch schon ihr geliebter Kolimein auf ihren Finger. Sie lachte und wie schon seit einigen Tagen machte sie einen Kussmund. Kolimein drückte sein Schnäbelchen sanft auf ihren Mund. Das war mittlerweile ihr Begrüßungskuss. Sie sprach mit ihm und er erzählte mit lustigem Gezwitscher seine eigenen Geschichten. Manchmal schien es ihr, als ob sich bei bestimmten Lichteinflüssen die Farbe des Kolibris veränderte. Sie war fasziniert von seiner Schönheit.
Die Zeit verging wie im Fluge. Kolimein saß noch immer auf der Innenfläche ihrer Hand. Anastasia bewegte langsam den Daumen, hielt damit seine kleinen Krallen fest, umfasste den bunten kleinen Körper mit der anderen Hand und steckte ihn behutsam in den Käfig. In diesem Moment verstummte Kolimein. Seine Augen schienen größer zu werden und dunkler.
»Jetzt müssen wir uns nicht trennen, mein geliebtes Vögelchen«, sagte Anastasia vergnügt und trat ihren Heimweg an.
Zu Hause angekommen, stellte sie den Käfig neben ihre Couch. Sie setzte sich, um ihren Freund weiter sehen zu können. Kolimein aber sah sie nicht mehr an. Er zwitscherte nicht mehr, verkroch sich auf der Sitzstange in die äußerste Ecke des Käfigs. Sein Köpfchen verbarg er in seinem Gefieder.
Nun gut, dachte Anastasia, er wird sich schon daran gewöhnen. Sie war so glücklich, mit ihrem Vögelchen für immer zusammen sein zu können, und pfiff fröhlich vor sich hin.
Am nächsten Morgen sah sie als Erstes nach Kolimein. Noch immer saß er in einer Ecke des Käfigs und blieb stumm. Er fraß nicht, er trank nicht, er zwitscherte nicht. Sie redete auf ihn ein:
»Mein süßes Vögelchen, was ist mit dir?«
Kolimein hob kurz den Kopf und sah sie an. Anastasia fröstelte. Sie verstand. Ihr fehlte das lustige Zwitschern ihres Freundes, seine Zuneigung und dieses wunderbare Gefühl von Zusammengehörigkeit und Vertrauen, welches sie in den vergangenen Wochen so beglückt hatte. Ihr fehlte das Leben in Kolimein. Selbst sein Gefieder wirkte jetzt matt und glanzlos.
So nahm sie den Käfig, lief mit ihm an ihren Lieblingsort und weinte bitterlich. Als sie ankam, bemerkte sie Bewegung im Käfig. Kolimein sprang auf und ab und sogar ein leises Zwitschern konnte sie vernehmen. Sie öffnete die Tür des Käfigs und setzte sich. Kolimein sprang in einem Satz aus der Tür hinaus und flog mit heftigem Flügelschlag davon. Dem schimmernden Grün seines Gefieders schaute sie hinterher, als er in den Wipfeln eines Baumes verschwand. Sie weinte Tränen der Scham. Wie konnte sie das Vertrauen des Kolibris missbrauchen, ihn fangen, ihm der Freiheit berauben, nur um ihn nicht zu verlieren?
In der Nacht schlief sie kaum und dachte nach. Ihr war schwer ums Herz, sie fühlte sich schlecht. Am folgenden Tag ging sie trotzdem wieder zur selben Zeit an ihren stillen Ort. Sie konnte es kaum glauben: Ihr Vögelchen kam freudig zwitschernd zu ihr und setzte sich wieder auf ihren Zeigefinger.
Anastasia weinte vor Glück.
»Entschuldige bitte, mein kleiner Freund. Ich war egoistisch und dumm. Ich habe dich so lieb, dass ich dich einsperren wollte. Doch nun weiß ich, dass du die Freiheit brauchst, um zu mir zurückzukehren.«
Sie hielt Kolimein ihren Mund hin und das Vögelchen verabschiedete sich mit einem Kuss.
»Bis zum nächsten Jahr, mein Schatz!«, rief sie ihm zu, als er sich in die Lüfte erhob. Zu Hause stellte Anastasia den leeren Käfig wieder neben ihre Couch.
Sie lag mit dem Kopf auf ihrem Schreibtisch. Anastasia stöhnte. Ihr Hals fühlte sich steif an. Langsam schlug sie die Augen auf. Dann hob sie vorsichtig den Kopf und bewegte ihn zum Auflockern hin und her. Sie war müde. Suchend blickte sie sich im Raum um. Es war inzwischen dunkel geworden. Die Straßenbeleuchtung warf einen schwachen Lichtstrahl durch ihre Vorhänge. Anastasia versuchte, ihre Umgebung in sich aufzunehmen. Sie ging bedächtig in ihr Wohnzimmer und suchte den Käfig mit den wunderschönen asiatischen Verzierungen an der Einfassung. Er war nicht auffindbar. Anastasia tastete nach dem Lichtschalter.
Die plötzliche Helligkeit blendete sie. Mit den Händen vor den Augen suchte sie erneut den Raum ab.
Ihre Wangen wurden feucht. Mit der Zunge schmeckte sie die salzigen, befreienden Tränen.
Anastasia nahm das Telefon und rief Emilio an.
Frau Schröder streichelte Silke sanft übers Haar.
»Woher wissen Sie …«, flüsterte Silke heiser. Frau Schröder sah sie fragend an. »Ich habe Martina ›Kolibri‹ genannt. Ich wollte meinen Kolibri nicht fliegen lassen.« Die alte Dame lächelte.
»Vielleicht sind wir enger miteinander verbunden, als es uns bewusst ist. Meine tapfere Silke. Sie werden Harry, Martina und Carola loslassen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Jetzt aber dürfen Sie leben. Und denken Sie daran: Sie wollen einmal fliegen.«
»Mit Höhenangst?«, fragte sie schluchzend. Die alte Dame nickte.
»Wenn Sie sich vorstellen, was sein könnte, versäumen Sie, was ist.«
Auf ein Wort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
bekanntlich steckt der Teufel im Detail. Frauen bestehen aus Details.
Sie können alles sein: liebenswert, zickig, boshaft, intrigant, tiefsinnig, leidenschaftlich – und sind für Männer nicht leicht zu durchschauen.
Manche von Ihnen haben vielleicht meinen ersten Roman »Ab 40 wird’s eng« gelesen, der 2019 bei BC Publications GmbH erschienen ist. Dort begann Silkes Geschichte und ich ahnte, für mich ist sie noch lange nicht vorüber. Als eine Rezensentin schrieb: »Wozu sind Fortsetzungen da?« wusste ich es sicher.
Alle Figuren sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig. Und doch: Es könnte sie alle geben, mitten unter uns. Im Leben.
Während meiner Recherchen für dieses Buch kam ich mit einigen Frauen zusammen, die mir von ihren Erfahrungen mit Singlebörsen und Dates berichteten oder mir von Partys erzählten. So manches Mal blieb mir der Mund offen stehen. Also denken Sie nur nicht, alles sei Fantasie. Machen Sie sich gern Gedanken.
An manchen Stellen tendierte ich absichtlich zur Übertreibung und zum Sarkasmus, indem ich in die Haut einer Figur schlüpfte und unsere Norm- und Werteorientierung hinterfragte.
Wichtig waren mir Menschen mit Ecken und Kanten sowie die Herausarbeitung psychologischer Details. Wer will schon von perfekt anmutenden Menschen lesen?
Ich hoffe, Ihnen hat dieser erste Teil meiner Trilogie gefallen und Sie sind schon neugierig auf die Fortsetzung. Hinterlassen Sie mir gern eine Rezension auf einschlägigen Seiten. Auch auf meiner Homepage freue ich mich über Ihren Besuch: sylvia-kling.net und sylvia-kling.de.
Bleiben Sie gesund und neugierig.
Ihre Sylvia Kling
Danksagung
Mein Dank gilt meinem Sohn Ferenc, der mich immer wieder ermunterte, auch in nicht so blumigen Zeiten zu schreiben und der sich über jeden Fortschritt zu freuen vermochte. Auch bedanke ich mich von ganzem Herzen bei meinen Testleserinnen Marion Bock/Berlin und Angelika Wittenbecher-Hennig/Dresden für ihre Anregungen und Hinweise, damit dieses Buch zu dem wurde, was es ist.
Wie wunderbar war es, den drei starken und humorvollen Frauen M. Weber, F. Kehrer und K. Lachmann zuzuhören – bei einem sächsischen Kaffee und einem Stück vorzüglich traditioneller Eierschecke in Dresden-Blasewitz, am bekannten Blauen Wunder. Danke, ihr Heldinnen, für eure Hilfe in Form der Zuarbeiten zu Chat-Inhalten und anderen Pfiffigkeiten. Heute mag ich es euch gestehen: Erst nach dem Ende des Romans konnte ich endlich darüber lachen und ich hoffe, ihr verübelt es mir nicht.
Einen Dank möchte ich ebenfalls meinem Verleger Burkhard Bierschenck aussprechen, der mich zu dieser Trilogie ermunterte und an meine Fähigkeiten glaubt.
Die Autorin

© Sylvia Kling
Sylvia Kling, geboren 1967 bei Dresden, drei Kinder, lebte 40 Jahre in Dresden und zog 2019 nach Meißen. Sie schreibt seit 1979 Gedichte, seit 2008 auch Erzählungen, Kurzgeschichten, Aphorismen sowie Liedtexte. In ihren poetisch-musikalischen Lesungen kann man Sylvia Kling nicht nur als Autorin und Lyrikerin, sondern auch als Sängerin und Entertainerin erleben.
Mit »Ab 40 wird’s eng« hat Sylvia Kling im Jahr 2019 ihren ersten Roman vorgelegt, in dem sie ihre Protagonistin auf einer frech-einfühlsamen Suche nach sich selbst begleitet.
Weitere Titel im Bookspot-Verlag

Leseprobe: Sylvia Kling »Ab 40 wird’s eng«
Der Beginn vom schaurigen Ende meiner Spätpubertät
Es war ein Tag wie jeder andere, so glaubte ich jedenfalls. Ich stand am Morgen auf und bereitete meinem achtjährigen Sohn Julian das Frühstück zu. Mein Mann Harry rief, wie jeden Morgen, den Kleinen: »Hey! Mach hin, es geht gleich los!« und lief im Korridor hin und her, um alle seine Utensilien einzusammeln. Ich gab meinem Mann ein Küsschen und auch Julian, der mich mit seinen wachen, lustigen Augen ansah und versuchte, seinen monströsen Schulranzen auf den kleinen Rücken zu wuchten. Ich schloss die Tür und sah am Küchenfenster, wie das Auto davonfuhr. Es war alles wie immer. Heute ging es mir gut und ich beschloss, den Tag nicht mit lästigen Hausarbeiten zu vergeuden, sondern ihn einzig und allein mir zu widmen. »Ich mache meine Haare schön, creme mich ein, zupfe meine Augenbrauen, ziehe mich mal etwas besser an als sonst und fahre ins Einkaufszentrum, um endlich nach meinen Traumschuhen für das nächste Frühjahr zu schauen. Diesen Monat muss ich mir unbedingt wieder etwas gönnen«, sprach ich selbst mir zu, als ob ich mich vergewissern müsste, dass ich das Recht dazu hatte.
Ich sprang unter die Dusche, wusch meine Haare, cremte mich ein und spann einen Faden beschwingter Gedanken. Ein neues Tuch könnte ich auch mal wieder gebrauchen. Ich wusste, dass ich mindestens 20 Tücher besaß und doch nur ungefähr acht davon trug, war aber der absoluten Überzeugung, dass ich das nächste Tuch ganz besonders lieben würde. Es war also alles wie immer.
Im Schlafzimmer war ich bereit für diesen wundervollen Tag, an dem ich mich nach monatelanger Krankheit wie neu geboren fühlte. Die Sonne blinzelte etwas schüchtern durch die Vorhänge hindurch. Es war ein milder Winter, der mich trotzdem – wie immer – etwas schläfrig und düster stimmte. Ich warf meinen Bademantel von mir und begann, meinen Kleiderschrank nach geeigneter Garderobe zu durchstöbern: schwarz, braun, grün, schwarz, schwarz, weiß, weiß, dunkelrot, schwarz, schwarz, schwarz. Wieder wurde mir bewusst, wie eintönig meine Kleidung war. Ich entschloss mich, mich jetzt nicht weiter zu quälen und wählte ein weißes Oberteil im Babydoll-Schnitt. Die Monate während meiner Erkrankung trug ich meistens »bessere« Jogginghosen. Mehr brauchte ich in dieser Zeit nicht. Ich führte beinahe das Leben einer Einsiedlerin. Nicht, dass ich es so wollte, nein, ich wurde dazu gezwungen. Es gab Wochen, da glaubte ich, die anderen Menschen da draußen würden mein Leben mit leben. Wie sie lachten, wie sie sich bewegten, wie sie die Frechheit hatten, einfach gesund zu sein! Damit war jetzt Schluss. Der Krankheit hatte ich gezeigt, wo es langging und dass ich keine Frau war, die man einfach so mit Fieberattacken, Lungenentzündungen, Nierenbeckenentzündungen und sonstigen Immunschwächen malträtieren konnte. Das war mein Leben und ich beschloss, es mir zurückzuholen.
Die Hose, die ich für diesen Tag tragen wollte, war keine Jeans, sondern die einzige und wundervollste schwarze Baumwollhose, die ich jemals besessen hatte. Euphorisch wählte ich in Gedanken mein Schuhwerk aus: schwarze Stiefeletten mit kleinen Absätzen. Ich war sowieso meistens größer als die anderen Frauen, trug also selten oder nie hohe Absätze. Zufrieden wollte ich nun die Anprobe starten. Ich streifte vorsichtig das weiße Oberteil über meinen Kopf, was sich als schwierig erwies, denn ich hatte vergessen, den Handtuchturban vom Kopf zu nehmen. Unbeirrt und geduldig fädelte ich meinen Kopf durch die Öffnung des Oberteiles. Irgendetwas stimmte plötzlich nicht. Das Teil umspielte nicht meinen Körper, wie es das getan hatte, als ich es kaufte, sondern klebte regelrecht an meinem Busen, dem Bauch und den Hüften. Ich hatte das Gefühl, es würde mich zerquetschen. Instinktiv wollte ich dieser Tatsache aus dem Weg gehen. »Es ist eingelaufen«, redete ich mir ein. Es war wirklich schwer, sich selbst so großartig zu belügen. Vor allem hinkte diese Lüge, da ich das Teil nie gewaschen hatte.
Die Hose lag vor mir. Ich bewegte mich nun betont grazil, schließlich war ich schlank und geschmeidig. Also konnte ich mich auch so bewegen. Ich summte vor mich hin und zog die Hose über meine Schenkel. »Es ist alles so eigenartig heute«, dachte ich. »Na ja, ich bin frisch eingecremt, da will der Stoff auf der Haut nicht so gleiten«, beruhigte ich mich sogleich. Die Hose erfuhr nun ihre größte Herausforderung, seit sie in meinem Besitz war. So kämpfte sie sich über meine Schenkel, hielt inne und wies meinem Hintern an, sich schlängelnd zu bewegen, damit sie sich über die Hüften arbeiten konnte. Mein Hintern gehorchte ohne Widerstand und die Hose erreichte mit Mühe und Not mit ihrem Bund meine Taille, bahnte sich tapfer den Weg über den Bauch. »Los, es geht! Gib dir Mühe! So schlimm wird es nicht!« Es war nicht die Hose, die mit mir sprach. Das war auch gar nicht nötig, denn meine Finger versuchten, den Knopf in den dafür vorgesehenen Schlitz zu schieben, was ihnen nicht gelang. Meine Hände befahlen meinem Bauch, sich zurückzuziehen. Dieser gehorchte mit Murren und Knurren. Dazu machte ich auch gleich einige Atemübungen. Ich hielt die Luft an. ›Von wegen, ich habe Asthma! Das ist Unsinn. Wie gut das geht und wie flach sich jetzt mein Bauch anfühlt, wunderbar. Oh, das ist toll!‹ Der Knopf fand in den Schlitz. Es vergingen wenige Sekunden, die mir endlos erschienen.
Mir wurde schwindlig, alles drehte sich um mich herum, meine Bronchien signalisierten, dass sie dringend nach dieser gehaltvollen Luft aus der hübschen blauen Spraydose verlangen. Diesem Verlangen gab ich widerstandslos nach, denn die Dose lag auf meinem Nachtschrank. Schnell atmete ich wieder ruhig und fühlte mich alarmiert. Das Alarmsignal kam jedoch nicht aus meinem Brustkorb, sondern tief aus meiner Frauen- (Mädchen-?) Seele.
Langsam bewegte sich mein Kopf in Richtung Spiegel. Da war es, das Gefühl, der Boden unter meinen Füßen würde sich bewegen. In meinem Kopf drehte es sich, alles um mich verschwand im Nirgendwo oder wirkte zerbrochen. Fühlte sich so vielleicht ein Erdbeben an? Im Spiegel begegnete mir etwas, was so ähnlich aussah wie eine Presswurst. Mein Busen quoll aus dem hübsch und zierlich aus feiner Spitze genähten Brustteil regelrecht hervor. Die Naht unter dem Brustteil verschwand im Rückenbereich in einer Fettwulst. Meine schon immer gebärfreudigen, doch bisher wunderbar weiblichen Hüften gebärdeten sich, inklusive des fleischig anmutenden Bauches, als Kampffeld und … und … Hiiiiiiiiiilfe! Ich drehte mich hin und her, doch der Spiegel blieb gnadenlos. Die Erkenntnis ereilte mich mit einer Wucht, die mich umhaute: Ich bin fett!
Erschöpft sank ich auf das Bett nieder, beugte meinen Oberkörper nach vorn und legte mein Gesicht in die Hände. Jetzt nur nichts mehr sehen! Dunkelheit, ich brauchte Dunkelheit, ganz eindeutig. »Warum habe ich dieses Elend nicht schon früher bemerkt? Warum sehe ich es erst heute? Ich bin doch nicht über Nacht, so ganz urplötzlich, fett geworden?« Sofort überlegte ich krampfhaft, was ich gestern gegessen hatte: Ein doppeltes Weizenbrötchen mit Honig (warum nicht Vollkorn, du dumme Pute?), eine Hühnersuppe (hm, ganz okay), ein Stück Kuchen (ist doch nicht wahr, oder? Buchstabiere das Wort K u c h e n!). Sei vernünftig, sei realistisch, es gab Tage, da hast du mehr gegessen, viel mehr, ganz viel mehr. Ich konstatierte: Das ist also der Grund! Du verfressene Kuh! Selbstzerfleischend beschimpfte ich mich mit allen Ausdrücken, die mir einfielen und rannte dabei mindestens zehn Mal ums Bett. Meine nassen Haare peitschten, wie zur Bestätigung meiner Hässlichkeit, an meine Wangen. Ich berührte sie kurz. Blöde Haare! Ach, wie liebte ich sie sonst, wie wurde ich beneidet um diese dicken, kastanienbraunen Haare. Ich setzte mich auf die Bettkante, jetzt noch mehr erschöpft. Haare, Haare, ja! Und mein Gesicht, klar! Die Rettung! Ja, ich war ein der Sonne zugewandtes Geschöpf (so glaubte ich jedenfalls immer), und so kam ich zu dem Entschluss aufzustehen und meiner Rettung entgegenzulaufen, mich selbst aus dem Schlamm zu ziehen und mich wieder zu mögen. Fahrig glättete ich das Babydoll-Oberteil, welches sich eigentlich durch den prallen Sitz auf meinem Körper als faltenlos entpuppte. Erleichtert bei dem Gedanken, dass ich ja im Bad nur mein Gesicht zu sehen bekam, lief ich mit energischen Schritten zum Waschtisch.
Ach, das Licht war noch aus. Mein Mann hatte am Spiegel eine Lampe angebracht, damit »Frau sich besser sah beim Schminken«, wie er sagte. Ich knipste das Licht an. Guter Dinge und mit dem noch ungebrochenem Willen, die Vernichtung meiner Schönheit vor einigen Minuten zu vergessen und Lügen zu strafen, öffnete ich die Augen. Es begann langsam, dieses Drama, aber es war nicht aufzuhalten. Erst sah ich meine einst großen, haselnussfarbenen Augen in einem Schattengebilde versinken. Das wiederum war umgeben von Krähenfüßen und einer durchdringenden, unübersehbaren Kraftlosigkeit. Dann sah ich hinab zu meiner Nase mit den zwei unterschiedlich großen Nasenlöchern, die mich bisher noch nie gestört hatten – bis heute. Heute war irgendwie alles anders, heute war ein Tag des Schreckens. Wurde meine Nase nicht immer größer und unförmiger? Ich sah eine Frau der Frauen vor meinem geistigen Auge, wie sie mir scheinbar zu tausenden täglich begegneten: nichtssagend, vom Leben geprägt, mit ausgeweinten Augen und lebensverschnupfter Nase. Doch das war noch immer nicht genug. Mein Blick wanderte weiter hinab, in der Erwartung, einen schönen, vollen und sinnlichen Mund zu erspähen. Jetzt kam der Schock. ›Oh, gleich falle ich um!‹, dachte ich noch. Ich fiel natürlich nicht, sondern blickte mit weit aufgerissenen Augen in dieses unverschämte Glas hinein. In Sekundenschnelle dachte ich an den Spiegel, damals bei Douglas, den die dick geschminkte Verkäuferin mir vorhielt, um mir ungerührt zu demonstrieren, dass meine Haut mitnichten so toll aussah, wie ich glaubte, und in der mir jede kleinste Unreinheit wie eine wuchtige Anhäufung einer schlammigen Masse erschien. Jener Spiegel, der mir klar machte, dass das teuerste Make-up noch nicht ausreichte, um wieder ansehnlich zu werden und meine eigene Abscheu zu überwinden.
Nun tat mir dieses Elend mein eigener Spiegel an, was für Desaster! Meine Mundwinkel fielen herab. Neben ihnen sah ich tiefe Kerben, die von Bitterkeit und Schmerz zeugten. »Ich habe schon einen Mund wie die Angela!«, rief ich aus und dieser Satz schallte durchs Bad. Warum musste mein Mann auch solch ein riesiges Bad bauen, mit einer solchen Akustik? Kein Mensch hatte so ein großes Bad. Mist, es ist doch alles Mist! Was soll ich denn mit der fremden Frau dort im Spiegel anfangen?
Wieder überrollte mich die nächste Erkenntnis wie ein Feuerball: Ich bin alt!
Der Tag war gelaufen. Nichts war wie sonst. Mein Lieblingstuch war immer noch das bordeauxrote, das ich mir zum meinem 44. Geburtstag gekauft hatte. Ich werde nie wieder einkaufen. Nie wieder! In meiner Größe gibt es doch nur Säcke. Ich kann doch nicht als Sack mein weiteres Leben fristen! Was machte man mit einem Sack? Man schmiss ihn in den Müll, erst recht, wenn er so alt und schwer war! Wer weiß, ob ich überhaupt jemals in diesem Leben noch einmal auf die Straße gehen werde?
Niemand wird mich ansehen können. Sie werden davonlaufen, werden sich ekeln oder über mich lachen, sie werden mich zu Ernährungsberatern schicken, zu jenen Leuten, die ich bisher in meinem jugendlichen Leichtsinn für völlig überflüssig hielt. Oder noch schlimmer: Sie werden mich fragen, ob ich mir schon Gedanken gemacht hätte, für meine Beerdigung zu sparen, so wie das eben alte Leute tun, um ihren Kindern nach dem Tod nicht zur Last zu fallen … Ich bin ja so was von am Ende! Mein Leben ist vorüber, alt, hässlich und zerknautscht wie ich bin.