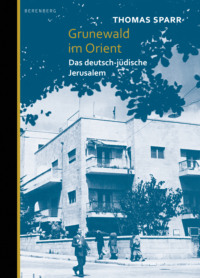Kitabı oku: «Grunewald im Orient», sayfa 2
Else Lasker-Schüler hat den Ort literarisch mitbegründet, erfunden; ihr imaginäres Jerusalem war das reale Rechavia, der Kraal. Mit Adon, also Herrn Scholem war sie so bekannt wie mit Adon Buber. »Eine große Dichterin. Wissen Sie, dass sie um die Ecke herumgeisterte?«, weiß Mascha Kaléko zu berichten. »Die Abendlandschaften sind wirklich – wenn sie sie schon vorher erahnte, ohne sie zu kennen – wie von der L[asker]-S[chüler] erfunden. In den ›Abendfarben Jerusalems‹, ich glaube, sie schrieb das, lange ehe sie sie (es sei denn aus Bibel und Malerei) kannte. Außerdem was ist schon ein Dichter wenn nicht ein Ahner, nicht Ahmer, sondern Ahner, mit n bitte.«
All diese Personen hätten einander an diesem Schabbatabend im Café begegnen können. Sie sind es nicht. Gershom Scholem etwa reist im Frühjahr 1961 für mehrere Monate nach London und versäumt Hannah Arendt in Jerusalem, er erfährt aus der Ferne vom Auftakt und dem Fortgang des Eichmann-Prozesses. Anna Maria Jokl war einige Jahre zuvor und wieder später da, ehe sie 1965 ganz nach Jerusalem zieht.
Sie waren zufällig abwesend und gehören doch notwendig zu einem Bild von Rechavia Anfang der sechziger Jahre.
Es ist spät geworden, die Kellnerinnen beginnen, die Stühle hochzustellen, das Café leert sich, die Gesellschaft verlässt das Atara. Man begleitet Buber zu seinem Taxi, der Fußweg zu seinem Haus wäre zu weit für ihn. Die übrigen fünf aber legen den Weg ins still schlafende Rechavia zu Fuß zurück. Zuerst gemeinsam, dann getrennt. Scholem biegt nach rechts in die Abarbanelstraße ein, Hannah Arendt verabschiedet sich auf der King-George-Straße und geht in ihr Hotel. In der Nummer 33 lebt Mascha Kaléko, »Um die Ecke wohnt Buber und sone Leute«, Werner Kraft, der Scholem noch ein Stück Weges begleitet hat, biegt in die Alfasistraße ein, wo er wohnt. Anna Maria Jokl hat ein Quartier nahe der Balfourstraße gefunden, wo sie später, gegenüber der Schockenbibliothek, direkt neben der Residenz des israelischen Ministerpräsidenten, viele Jahre leben wird.

Die Schockenbibliothek als Modell.
Der Architekt Erich Mendelsohn schreibt 1936: »Gestern bei Schocken […] Die Bibliothek ist im Rohbau fertig. Sehr gut. Räume innen herrlich. Außen schlicht u. feierlich. Haus bis zum ersten Stock im Rohbau. Herrlich. Steht schon 1000 Jahre so. Frau Schocken sagt zu ihm – als wir heute Sabbath Vormittag gemeinsam die Bauten besuchten – da gibt es wirklich nichts zu meckern.«
Rechavia als geistige Lebensform
Wer heute durch die schattigen Straßen Rechavias geht, entdeckt einen wohlhabenden Stadtteil im Westen Jerusalems, gepflegte Grünanlagen, stille Seitenstraßen, zwei viel befahrene Hauptstraßen, kleinere Cafés an den beiden Alleen, Ramban und Ben Maimon, einen Mini-Supermarkt und einen Blumenladen, eine Pension namens »Little House in Rehavia«, Kioske und ein Lottobüdchen, einen gut sortierten Buchladen an der Ecke, auf dem Spielplatz sieht man fromme Eltern mit ihren Kindern und hört sie Französisch sprechen. Das einstmals weltliche Rechavia zieht heute viele religiöse Familien an. Die Residenz des israelischen Premierministers ist die ehemalige Villa Aghion, 1938 erbaut von Richard Kauffmann.
Nur vereinzelt weist eine Tafel auf die Geschichte eines Hauses hin, wie an der Ecke Rambanstraße/Arlosoroffstraße, wo die Familie Bonem 1935/36 ein Wohnhaus von Leopold Krakauer errichten ließ. Der Architekt verband die funktionale Moderne des Bauhauses mit der einheimischen Architektur, die er im Land vorfand, eine Verbindung von schmucklosem Stein und orientalischen Mosaiken, von arabischem Landhaus und klaren Kuben mit einfachen, kleinen Fenstern, Türen und Balkonen, die das Rustikale offener und dynamisch werden lassen. Ein Patio mutet wie ein geschlossener Raum an und öffnet sich doch zum Himmel. Seit vierzig Jahren beherbergt das architektonische Kleinod eine Bank; die Terrassen, Balkone und der Garten sind nicht mehr erhalten, der Grundriss aber blieb, im Vestibül stehen heute Geldautomaten, in den Kassenraum hat man einige originale Möbel gestellt.
Auf den ersten Blick wähnt sich der Besucher in einem Bauhaus der frühen 1930er Jahre in Weimar oder Berlin. Das Fußbodenmosaik ist renoviert, Tafeln erzählen von der Geschichte des Hauses. Die Bank Leumi hat historische Umsicht und konservatorische Sorgfalt walten lassen. Eine Ausnahme in Rechavia, wo nur noch wenige Spuren an die Geschichte und Bedeutung des Stadtviertels erinnern.
Nicht weit von der Bankfiliale, der Villa Dr. Bonem, verfällt das Haus in der Abarbanelstraße 28, in dem Gershom Scholem über fünfundvierzig Jahre bis zu seinem Tod im Februar 1982 mit seiner Frau Fania lebte und ein Werk schuf, das die gelehrte Welt bis heute in Erstaunen versetzt und vor Rätsel stellt. Dem Nachbarhaus ergeht es nicht anders. Die Straßen – Binjamin Metudela, Saadia, Abarbanel, Alfasi, Alcharisi, Bartenura, Ramban – sind nach Gelehrten und Dichtern aus dem Spanien vor 1492 benannt und erinnern an die ersten Hausbesitzer Rechavias: wohlhabende und gebildete orientalische Juden.
Rechavia sollte als Gartenstadt nach europäischem Muster entstehen, großzügig angelegt, Gärten hinter den Häusern, davor schmalere Vorgärten, ein Quartier voller Bäume, Hecken, Blumen, mit Grünanlagen am Saum der Alleen, einladend weit, mit Parks ringsum. Es sollte Teil des – und der biblische Ton ist dabei nicht zu überhören – neuen Jerusalem sein.
»Das Wohnviertel Rechavia liegt an der Hauptstraße des neuen Jerusalem. Es ist Teil der Stadt selbst, liegt in der Nähe des Bahnhofs und des Einkaufszentrums«, heißt es über die Vorzüge des neuen Stadtviertels in einem Prospekt, den die Ansiedlungsgesellschaft 1930 verteilen ließ: »An seiner östlichen Grenze erstreckt sich die breiteste Straße Jerusalems, die King George Straße, die Rechavia mit dem Bahnhof und der Jaffa Straße verbindet, der Hauptverkehrsader der Stadt. Im Herzen Rechavias liegt die Ramban Straße, die direkte Fortsetzung der Mamilla Straße, die das Einkaufszentrum mit den zwei großen Hotels der Stadt, dem King David Hotel und dem Palace Hotel, der Hauptpost und dem Jaffa-Tor verbindet. An seiner nördlichen Seite ist Rechavia mit einer Reihe von hebräischen Wohnvierteln im Westen Jerusalems verbunden […] Rechavia ist eine Gartenstadt. Von jedem Grundstück werden zwei Drittel für Gemüse- und Blumengärten, für Anpflanzungen und freien Luftzug abgenommen. [Die Gartenstadt] zieht weite Kreise an, die durch ihre Geschäfte mit der Stadt verbunden sind und in einem Viertel mit Gärten und viel frischer Luft wohnen wollen.«
Als Thomas Mann seine berühmte Rede über Lübeck als geistige Lebensform aus Anlass der Siebenhundertjahrfeier vor den Honoratioren im Rathaus seiner spitzgiebeligen Heimatstadt hielt, entstand Tausende Kilometer entfernt ein Stadtviertel, auf das man das Attribut der geistigen Lebensform, der intellektuellen Verbindung, des Lesens, Schreibens, Forschens, der Musik und bildenden Kunst am ehesten anwenden kann: keine über Jahrhunderte gewachsene Stadtkultur, auf die der berühmte Sohn der Hansestadt mit Stolz und leiser Ironie zurückblickt, sondern eine Lebensform, die tradierte Muster der Weimarer Republik und der Kaiserzeit mitnahm und ihnen eine neue Form und neue Inhalte gab.
Ankunft der Architekten
Am 28. März 1921 schreibt eine junge Architektin aus Berlin an »Herrn Richard Kauffmann, Zionist Commission, Jerusalem«: »Sehr verehrter Herr Kauffmann! Durch meine Schwester Rosa Cohn erfahre ich, daß Sie Interesse daran haben, mit zionistischen Architekten, die für die Arbeit in Palästina in Betracht kommen, in Beziehung zu treten. Daß ich meinerseits ein ganz großes Interesse daran habe, mit Ihnen bekannt zu werden, ist begreiflich; dies ist der Anlaß meines Briefes.«
Es ist der Bewerbungsbrief von Lotte Cohn, mit dem sie Kontakt zu ihrem späteren Vorgesetzten in Jerusalem aufnimmt, der seit wenigen Monaten erst der leitende Stadt- und Siedlungsplaner der Palestine Land Development Company ist. Als junger Architekturabsolvent hatte Kauffmann, nach einem Studium bei dem berühmten Theodor Fischer in München, am Bau der Gartenstadt Margarethenhöhe bei Essen mitgearbeitet und dort Lottes Bruder Emil Cohn kennengelernt, der als Rabbiner in Essen amtierte. Nach dem Ersten Weltkrieg arbeitete Richard Kauffmann anderthalb Jahre im norwegischen Kristiania, dem heutigen Oslo, wo ihn im August 1920 der Ruf ereilte, nach Palästina zu kommen.
Der Bewerbungsbrief der achtundzwanzigjährigen Arzttochter aus jüdisch bürgerlicher, auch zionistischer Familie ist von entwaffnend ehrlicher Offenheit: »Ich weiß, daß für den Augenblick wenig Aussicht für mich ist, dort Arbeit zu finden. Sollte sich irgendwann einmal eine Möglichkeit dazu bieten, so würde ich ganz zufrieden sein, mich von der Stellung etwa eines Technikers aus in die Verhältnisse dort von Grund auf einzuarbeiten. Dieser Brief ist wohl ausführlich genug; ich bitte Sie, mir zu glauben, daß er völlig aufrichtig ist, sehr viel ehrlicher + objektiver als ähnliche Angaben gewöhnlich gemacht werden. Ich betone das, weil ich aus Erfahrung weiß, daß Bewerbungsschreiben in der Regel mit skeptischen Augen gelesen werden. Ich hatte den ehrlichen Willen, eine wirkliche Verständigung mit Ihnen herbeizuführen. Denn sollte dieser Brief wirklich einmal zur Grundlage einer geschäftlichen Beziehung zwischen Ihnen + mir werden, so wäre eine Täuschung für beide Teile gleich gefährlich. Ich bin mir dieser Verantwortung ganz bewußt.«
Einige Monate später, Ende Juli 1921, erhält Lotte Cohn ein Telegramm aus Jerusalem: »anbieten assistenten stellung vorläufig zwanzig pfund monatlich, reisezuschuss 25 pfund sofort visum einreichen, erbitten drahtantwort pldc kauffmann zionscom.«
Und am gleichen Tag schreibt Richard Kauffmann seiner zukünftigen Assistentin noch einen Brief: »Sehr geehrtes Fräulein Cohn! Wenn ich an die Sehnsucht denke, mit der ich nach dem Land kam, besser der Arbeit in ihm, für es stets bangte und an die Freude, als mich im August vorigen Jahres meine Berufung hierher in Norwegen erreichte, so kann ich mir ungefähr vorstellen, wie Ihnen jetzt wohl zu Mute sein mag.«
Kauffmann drückt seine Freude und die Hoffnung aus, mit Lotte Cohn die richtige Wahl getroffen zu haben. Es stünden städtebauliche Arbeiten an, »deren Größe, Schönheit, deren gewaltige Bedeutung für den Aufbau einen zu unbedingter, restloser Hingabe an dieser Arbeit freudig zwingt«. Und in einem P. S. fügt der Absender das wohl Wichtigste hinzu: »Bringen Sie bitte, wenn Sie irgend können, einige Beispiele vorbildlicher, moderner deutscher Bauordnungen mit. Für Städte und Gartenstädte. Sehr gut die von Essen (Schmidt), Hamburg (Schumacher), evtl. Köln (Rehorst und Schumacher). Dann Hellerau, die Gartenstadt Tauts (Falkendorf?). Bitte auch etwas gute, moderne Literatur, auf unsere Kosten. Gehen Sie zu Taut. Bruno Taut ist großer Zionistenfreund!«
Am Donnerstag, dem 18. August 1921, brachen die beiden Schwestern Helene und Lotte Cohn vom Anhalter Bahnhof in Berlin nach Palästina auf. Am 4. September legten sie im »Orient Express«, einem kleinen, klapprigen Bus, die letzte Strecke ihrer langen Reise auf der staubigen, nicht asphaltierten Straße von Tel Aviv nach Jerusalem zurück. Der heiße Wüstenwind hatte beiden Schwestern zugesetzt, vor allem Lotte. »Aber als wir ankamen, hatte das Wetter umgeschlagen, Jerusalems frische Bergluft ließ mich aufatmen.«
»Die Zwanziger Jahre in Erez Israel« heißt »ein Bilderbuch ohne Bilder« von Lotte Cohn, »geschrieben für die Freunde, die sie mit mir durchlebt haben«, eine Retrospektive, die Bilder und einzelne Szenen wie in einem Kaleidoskop plastisch und farbenfroh hervortreten lässt. Lotte Cohn war eine entschlossene, kräftige Chronistin ihrer Zeit, ihrer Umgebung, ihrer Freunde, dabei von großer Bescheidenheit und Nüchternheit, was sie selbst betraf, ein Leben für die Berufung, »Baumeisterin des Landes Israel« zu werden, wie ihre Biografin Ines Sonder sie nennt. »Wenn man mich fragen würde, was denn eigentlich das Besondere, das Charakteristische an dieser kleinen Welt von Juden auf dem Boden von Erez Israel war, so würde ich antworten: ›Es war eine Welt nur von jungen Menschen, es gab keine Alten unter uns. In die Wirklichkeit hineingetragenes Jugendleben. Wer das nicht miterlebt hat, kann sich kaum vorstellen, was für ein Charme auf dieser engen Welt lag.‹« Fast immer wird in den Erinnerungen der frühen Einwanderer ihre Jugend laut, oft hatten sie die Auswanderung gegen den Widerstand der Eltern in Deutschland durchgesetzt, blieben allein, auf sich gestellt: »wir hörten kein: ›zu meiner Zeit‹ … aber umso stärker spürten wir die eigene Verantwortung.«
Lotte Cohns Erinnerungen gelten den ersten Jahren in Jerusalem, vor dem Umzug ihres Architekturbüros nach Tel Aviv. Sie schildert den ersten Spaziergang in Jerusalem, den Skopusberg hinauf, auf dem vier Jahre später die Hebräische Universität eröffnen wird:
»Da liegt sie, meine Stadt Jerusalem, in all ihrem Zauber, mit ihren Kuppeln und Kirchen, ihren Moscheen und Minaretts, Stein gewordene Geschichte, und welche Geschichte. Kulissen schieben sich hinter dies einzigartige Bild, der Berghang des Ölbergs mit dem uralten Judenfriedhof … ob wohl die alten Steine heute noch dort liegen? Und wir steigen weiter hinauf zum Skopus, ein baumbestandenes Gelände mit ein paar alten Bauten. Sie sind nicht atemberaubend schön, diese Häuser, keineswegs, eher beinahe ärmlich; aber wie wunderbar wachsen sie aus dem herben Boden heraus, selbst herb und streng, in kubischer Silhouette. Wir haben die Höhe erreicht, und nun öffnet sich der Blick weiter nach Osten: Vergiß dies nie, halt es fest, dies Bild. Ein unerhörtes Panorama breitet sich vor Dir aus, Wellen und Wellen von Bergzügen liegen vor Dir, in klaren und strengen Linien gezeichnet, hie und da die knorrige Struktur eines Ölbaums, ein bizarres Distelgestrüpp, ein großblättriger Feigenbaum. Dort ist ein verfallener Brunnenschacht, hier ein romantisches Gemäuer, das wohl eine Besitzgrenze markiert … Einzelheiten verlieren sich mehr und mehr, je weiter das Auge vordringt, hinunter, hinunter, dort, wo in der Ferne ein mattschimmernder See in der Wüste sichtbar ist, das Tote Meer. Der Widerschein der untergehenden Sonne läßt die jenseitigen Berge rotgolden aufglühen. Und nun steigt der Mond herauf, der Himmel wird eine rotleuchtende Glocke.«
Als Lotte Cohn ihre erste Wanderung im Spätsommer 1921 den Skopusberg hinauf unternimmt, war Rechavia noch Landschaft, Bauland; es war eine Idee. Das Straßennetz wurde gerade ausgebaut, ein Wasserleitungssystem und die Straßenbeleuchtung eingerichtet, und es entwickelte sich das, wofür Lotte Cohn Pläne in ihrem großen Reisegepäck mitgenommen hatte: eine Stadtplanung und Baugesetze.
Die neuen Viertel der rasch wachsenden Stadt erstreckten sich vor allem westlich und nordwestlich der Stadtmauern, entlang der Jaffastraße, der alten Handelsstraße ans Meer, nach Jaffa und Tel Aviv. Das Hauptpostamt war noch nicht errichtet, ebenso wenig das legendäre King David Hotel. Lotte Cohn kam in ein kaum erschlossenes Land, das aus dem Schlummer einer langen ottomanischen Herrschaft erwacht war und nun dringend Architekten, Techniker, Ingenieure und Bauarbeiter für seine Infrastruktur brauchte. Die Pläne und Projekte, die sie, zusammen mit Richard Kauffmann, beschäftigten, waren zunächst Siedlungen und Häuser außerhalb Jerusalems. Und doch gehört sie als Chronistin, Architektin und Bewohnerin mitten hinein nach Rechavia. Drei Schwestern Cohn waren ins Land gekommen: Helene, Rosa und Lotte. Die älteste von ihnen, Helene, wurde 1882 in Steglitz geboren, dem heutigen Stadtteil von Berlin, Rosa 1890, drei Jahre später Lotte. Hinzu kamen die Brüder Max, Emil und Elias, die nicht nach Palästina gingen, sondern andere Wege einschlugen. Und die Schwestern blieben zeitlebens ledig und kinderlos.
Die Eltern der sechs Geschwister, Cäcilie und Bernhard Cohn, gehörten zu den wenigen Vertretern des deutsch-jüdischen Bürgertums, die die zionistischen Ideale ihrer Kinder teilten; ihren Vater nannten sie einen »Self-made-Zionisten«.
Rosa Cohn war schon Ende 1920 nach Jerusalem gegangen, um dort als Sekretärin für den Jüdischen Nationalfonds zu arbeiten. Helene Cohn ging im Sommer 1921 als Laborantin ans Rothschild-Hadassa-Hospital, bis sie Anfang der 1930er Jahre in der Abarbanelstraße 28 die legendäre Pension Helene Cohn eröffnete. »Modern Conveniences. Excellent Cuisine. Dietic Food to order«; Kuchen, Sandwichs, kalte und warme Gerichte wurden gereicht, und es gab einen Cateringservice für die Empfänge in der Stadt. Und am Ende heißt es in der Sprache Rechavias: »Feiner Mittagstisch«.
Ein eigener deutscher Prospekt preist einige Jahre später die »ruhige kühle Lage, Garten und Dachterrasse, schöne, moderne Zimmer mit fliessendem Wasser« an und »mässige Preise«.
Tausende von Besuchern aus Europa und Übersee finden über viele Jahre in der Pension Helene Cohn Unterkunft in Rechavia.
Käsebier erobert die Jaffa Road
»Eine Welt für sich ist Rechavia«, schreibt Gabriele Tergit in einer ihrer Reportagen aus den 1930er Jahren: »Am Eingang die Burg der zionistischen Behörden, großartiger Steinbau, leicht assyrisch. Davor Zypressen, jede einem Gründer des Zionismus gewidmet. Rechavia, Villenstadt der Wohlhabenden, europäisch nach englischer Bauordnung angelegt. Vorgärten, moderne Häuser, glatt, gerade, zwei bis drei Stock hoch, aus dem Stein der Landschaft, weißgrauen Quadern, mit flachen Terrassendächern, breiten, gelagerten Fenstern, schlitzförmigen Loggien, Garagen beiseite, alles mit fließendem Wasser, gekacheltem Bad, mit Zentralheizung für die regengußerfüllten Winter, mit Fliegennetzen, mit steinernen Fußböden für den glühenden Sommer, alles noch baum- und rasenlos.«
Im November 1933 war Gabriele Tergit ihrem Mann, dem Architekten Heinz Reifenberg, nach Jerusalem gefolgt, und ihre Eindrücke der fremden Stadt verfasste sie geradeso, als hätte sie ihre Reportagen aus Berlin oder anderen Städten weitergeschrieben.
Ihre Augen tasteten die Außenfassaden ab, um das Innere der Häuser freizulegen, jedes Detail geht in einer größeren Betrachtung auf: »Innen Bürgertum, Bücherschrank, Couch, Standlampe und Büffet, Damen, die sich zurechtmachen, und Damen, die Bridge spielen, bürgerliche Verlobung, Ehe und Mitgift. Rechavia ist Beamten- und Universitätsstadt. Und so ist es auch. Die Normalisierung des jüdischen Volkes hat den jüdischen Beamten geschaffen. Enge, Wichtigkeit der Karriere, Wichtigkeit des Gehalts, Patriotismus, Chauvinismus und Überheblichkeit.«
Gabriele Tergit entgeht nichts, weder die Hierarchie der zionistischen Organisationen, für die einer arbeitet, noch das Gehalt, das er dafür bekommt, nicht, wie lange er schon im Lande ist, und auch nicht der Unterschied zwischen weltlichem und religiösem Judentum: »Zwischen Rechavia und der Klagemauer ist keine Brücke. Aufgegeben ist die Klage um das verlorene Heiligtum. Rechavia wird als endgültig betrachtet, als Sicherheit, Heimat und Rückkehr, und antiquiert und seltsam erscheint der munteren Stadt der Jude, der seine Tränen im Anblick der Jahrtausende vergießt. Ein tollkühnes Geschlecht nennt ein Kino: ›Cinema Zion‹.«
Das erste und lange Zeit einzige Kino Jerusalems, zentral an der Jaffastraße gelegen, zeigte europäische und amerikanische Filme. Gershom Scholem wusste seiner Mutter im August 1930 zu berichten, das Dach des Kinos ließe sich »jetzt an schönen Sommertagen, und wann wären die hier nicht?, in die Höhe klappen«.
Ganz in der Nähe des Cinema Zion befindet sich – bis heute, das Kino ist längst abgerissen – ein zentraler Ort der Stadt: die Hauptpost, über Jahrzehnte der wichtigste Umschlagplatz für eintreffende Nachrichten wie Telegramme, Briefe, Telefonate aus Jerusalem heraus. Anhand der Warteschlange macht die Reporterin – oder Reportagekünstlerin – das internationale Gewimmel aus: »die Kawasse, die Diener der Konsulate, in langen Türkenhosen, einer in Rohseide, durchgeknöpfter Jacke, breite rote Schärpe um den Leib. Der italienische Kawaß in blauem Tuch, silbergestickt, rot-silbernen Brokat um den roten Fez gewickelt, ein englischer Reverend, alte Juden in langen Samtmänteln und Pelzhüten, alte Juden im gestreiften Kittel, mit langem schwarzen Rock, Schotten in kurzen karierten Röckchen, rotweißen Strümpfen, weißen Gamaschen, kleinen Mützen, Polizisten mit schwarzer Pelzmütze zu kurzen Khakihosen, eine junge Jüdin im geblümten Sommerkleid und großem Hut, ein brauner Franziskaner, nackte Füße, Kutte und Strick um den Leib und Tropenhelm, Araber im Straßenanzug und Fez, Araber im langen Kittel mit weißem Kopftuch, ein katholischer mit Tropenhelm, ein Franzose mit breiter schwarzer Schärpe um den langen Priesterrock. Eine deutsche evangelische Diakonissin, ein arabischer Scheich im weißen Kittel, weißem Mantel, weißem Kopftuch und goldenem Reif darum, eine Araberin vom Lande im rotgestickten langen Leinenkleid.«
So bunt und vielfältig, so offiziell festlich etliche der Kostüme sich dem Auge darbieten, sind auch die Anliegen und Adressen, »Briefe gehen an hohe und feierliche Institutionen«, an die Bibliothek des Vatikans, ans hohe Rabbinat in New York, ans Franziskanerkloster in Assisi, an die Downingstreet 10, an die Regierungen aller europäischen Länder. Und im Hauptpostamt von Jerusalem gibt Else Lasker-Schüler im Winter 1943 ein Telegramm auf, von dem wir nicht wissen, ob es den Adressaten je erreicht hat: »Marchall Stalin Stalingrad Kreml. Marchall, Ihr seid der mutigste und liebste Mensch der Welt. Die Dichterin Else Lasker-Schüler.«