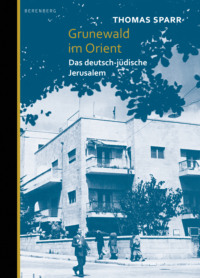Kitabı oku: «Grunewald im Orient», sayfa 3
Von Liebe und Finsternis
Der Pioniergeist der zumeist jungen Einwanderer der 1920er Jahre wich ein Jahrzehnt später den Nöten und Entbehrungen, dem Heimweh und den Trennungsschmerzen von Juden, die nach der nationalsozialistischen Machtübertragung nach Palästina emigrierten, oft nur versorgt mit dem Nötigsten und oft noch in Sorge um Familienangehörige, die sie in Deutschland zurücklassen mussten, weil nur einer das begehrte Zertifikat erhalten hatte.
Manchen Kindern gelang es, die betagten Eltern nach Palästina zu holen. Damals kam die Frage auf, ob jemand aus Deutschland oder aus Zionismus komme, aus Not oder aus Überzeugung, geflohen oder eingewandert. In die Traumstadt zogen Albträume ein, schmerzhafte Erinnerungen an traumatische Erlebnisse im Heimatland, Sorgen, Nöte. Der Autor Asher Beilin schreibt im September 1941 über »Unsere Jeckes«:
»In den ruhigen Straßen Jerusalems treffe ich täglich verschiedene Typen dieses Stammes. Wissenschaftler und Künstler, die unter uns auf einer verlassenen Insel leben, abgeschnitten, niemand fragt nach ihnen oder beachtet sie. Einsame alte Frauen und Männer, gebeugt, die Angst um ihre Kinder haben, die in den Krallen des teuflischen Feindes gefangen sind, und es gibt keinen Trost. Menschen jeden Alters, die um ihr Überleben kämpfen. Ich sah, wie sie ihren Haushalt Stück für Stück verkauften – den Schabbatleuchter, Silberbesteck oder eine Uhr, die sie aus dem Feindesland gerettet hatten. Ich sah, wie sie ihre einzigen Seelen verkauften, die sie treu und innig liebten, ihre Freunde, die genauso stumm wie sie sind – ihre Hunde, weil sie nicht in der Lage waren, die Hundesteuer zu bezahlen. Ich war Zeuge von Selbstmorden, aus Einsamkeit, Angst vor Hunger, aus unerträglichem Kummer, feinfühlige zarte Seelen, die den Tod einem kummervollen Leben vorzogen.«
Der Chronist dieser Generation in Jerusalem, einer oft verlorenen Generation, verloren zwischen den Zeiten, der alten und neuen Heimat, den Erinnerungen wie den Forderungen der Gegenwart, ist Amos Oz. »Geboren und aufgewachsen bin ich in einer kleinen, niedrigen Erdgeschoßwohnung von etwa dreißig Quadratmetern« beginnt seine »Geschichte von Liebe und Finsternis«, ein Jahrhundertroman, der Roman seines Lebens, der ins Jahr 1939 führt, als Amos Oz in Kerem Avraham geboren wurde, dem Nachbarviertel von Rechavia, wo der Rest der Welt für den kleinen Amos begann:
»Jahre später erfuhr ich, dass das Jerusalem der zwanziger, dreißiger und vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts, das Jerusalem der britischen Mandatszeit, eine faszinierende Kulturstadt gewesen war. Großkaufleute, Musiker, Gelehrte und Schriftsteller lebten dort: Martin Buber, Gershom Scholem, S. J. Agnon und viele andere berühmte Forscher und Künstler. Manchmal, wenn wir die Ben-Jehuda-Straße oder die Ben-Maimon-Allee entlanggingen, flüsterte Vater mir zu: ›Schau, dort geht ein Gelehrter von Weltruf.‹ Ich wusste nicht, was er meinte. Ich dachte, Weltruf habe etwas mit kranken Beinen zu tun, denn häufig war es ein alter Mann, der sich unsicheren Schrittes an einem Stock vorantastete und auch im Sommer einen dicken wollenen Anzug trug. Das Jerusalem, nach dem sich meine Eltern sehnten, lag fernab unseres Viertels: in Rechavia, durchflutet von Grün und Klavierklängen, in drei oder vier Cafés mit goldfunkelnden Kronleuchtern in der Jaffa- und der Ben-Jehuda-Straße, in den Hallen des YMCA und im King David Hotel, wo sich kulturliebende Juden und Araber mit kultivierten Briten trafen, wo verträumte, langhalsige Damen in Abendkleidern am Arm von Herren in dunklen Anzügen dahinschwebten, wo vorurteilslose Briten mit gebildeten Juden oder Arabern dinierten, wo Konzerte, Bälle, literarische Abende, Tanztees und feinsinnige Kunsterörterungen stattfanden. Möglicherweise existierte dieses Jerusalem mit Kronleuchtern und Tanztees ja auch nur in den Träumen der Bibliothekare, Lehrer, kleinen Angestellten und Buchbinder, die in Kerem Avraham lebten. Bei uns jedenfalls fand es sich nicht. Unser Viertel, Kerem Avraham, gehörte Tschechow.«

Werbung für das Café Hermon 1937
Tschechow kannte die Sehnsucht nach dem anderen Ort, die in Kerem Avraham eine Richtung kannte: nach Rechavia.
Amos’ Vater Jehuda Arie Klausner war zusammen mit seinen Eltern Alexander und Shlomit 1939 von Wilna ins asiatische Palästina aufgebrochen und schrieb sich gleich nach seiner Ankunft für das Magisterstudium der Literatur an der Hebräischen Universität ein. Drei Jahre später lernte der Neffe des berühmten Gelehrten Joseph Klausner seine spätere Frau Fania eben dort kennen. Sie studierte, aus Prag kommend, Geschichte und Philosophie in Jerusalem. Ein Leben lang sehnte sich der Vater nach einer akademischen Position, während er als Bibliothekar arbeitete. In seinem letzten Lebensjahr, 1970, führte er noch Verhandlungen über eine Stelle als Dozent für Literatur in Beer-Scheva, wo später die Ben-Gurion-Universität gegründet wurde, die den Sohn Amos sechzehn Jahre später als Professor berief und ihm einige Jahre darauf einen Lehrstuhl anvertraute, der nach Agnon benannt ist.
Die Mutter litt über Jahre an schweren Depressionen und nahm sich am 6. Januar 1952 das Leben. Zwei Jahre später trat der fünfzehnjährige Amos dem Kibbuz Hulda bei und nahm den Namen Oz an, hebräisch für Kraft.
Er entstammt väterlicher- wie mütterlicherseits einer ostjüdischen Familie, vielsprachig, gebildet, gen Westen strebend. Die deutschjüdische Welt von Rechavia hat der heranwachsende Sabre, das heißt: ein im Lande Geborener, aus der Distanz wahrgenommen, eine Traumwelt, eine Viertelstunde Fußweg von Kerem Avraham entfernt, und es scheint, als habe gerade diese Distanz seinen großen Jerusalem-Roman möglich gemacht.
Der ältere Gad Granach, der 1936 mit einundzwanzig Jahren nach Jerusalem kam, erinnert sich an die neue Stadt:
»Jerusalem während der Mandatszeit war der reine Wahnsinn, es war sozusagen die Hauptstadt der Epoche. Jerusalem war eine wirklich kosmopolitische Stadt. Seit Jahrtausenden zogen hier schon die antiken Völker durch: die Römer, die Griechen, die Perser, die Babylonier, die Araber, die Türken, die Kreuzritter. Es war ein wildes Leben, es gab Parties, es gab Tanzabende, es gab Kammerkonzerte und Vorträge, nicht zu vergleichen mit heute. Vieles hatten die Jeckes mitgebracht, die in Palästina da anzuknüpfen versuchten, wo sie in Deutschland aufgehört hatten. Tucholsky oder Polgar hat einmal von der Tragik eines Medizinfläschchens an einem Totenbett gesprochen. Das passt hier genau.«
Anfänge
Rechavia war von Beginn an ein gesellschaftlich bunt gemischtes Viertel. Vornehme sefardische, das heißt jüdisch-orientalische Familien, seit Langem in Jerusalem ansässig, wohnten neben gerade eingewanderten Angestellten zionistischer Institutionen, die für den Jishuv, die jüdische Ansiedlung arbeiteten. Das markanteste Merkmal des neuen Viertels waren Herren, die im Anzug, mit Schlips und Kragen durch die Stadt gingen, Damen in Kostümen, aus Deutschland stammende Einwanderer, sehr mitteleuropäisch geprägte Menschen vor orientalischer Kulisse.
Im November 1936 veröffentlicht Nathan Alterman, der Nationaldichter des entstehenden jüdischen Staates, auf Hebräisch ein Gedicht in der Zeitung »Haaretz«, ich zitiere zögernd, denn Alterman hatte jede Übersetzung seines Werkes ins Deutsche untersagt: »Von Balkon zu Balkon unterhalten sich Architekten, / und Doktor gegenüber Doktor wohnt … / Sieh und versteh mein lieber Gast: / Rechavia entwickelt sich rapid schnell. / Die Nachahmung blüht, der Snobismus sprießt – Wunder vollbringt die Langeweile.«
Zu Recht nennt der Stadthistoriker Amnon Ramon sein Buch über Rechavia »Doktor mul doktor gar«, genau genommen in leicht verdrehtem, unzulänglich erlerntem Hebräisch: »Doktor gegenüber Doktor wohnt«.
Richard Kauffmann plante mit Lotte Cohn an seiner Seite auch andere Gartensiedlungen in Jerusalem: Talpiot, Beit Hakerem, Beit Vagan und Kirijat Moshe. Keines dieser anderen Viertel bewahrte indes das ursprüngliche Gepräge wie Rechavia.
Die Eroberung Jerusalems durch britische Truppen im Dezember 1917 bedeutete den Eintritt der Stadt in die Moderne. Die erste britische Mandatsregierung unter militärischer Führung (1917–20) entwickelte Pläne, Jerusalem wie das ganze Land zu erschließen und zu bebauen. Die zivile Regierung ermöglichte 1920 den Baubeginn. Die ottomanischen Grundbücher wurden aktualisiert und der Bodenbesitz rechtmäßig eingetragen. Im Februar 1921 erschien die »Verordnung für den Städtebau in Erez Israel«.
Die Idee eines »neuen Jerusalem« war beflügelt von der Balfour-Deklaration. Der britische Außenminister Lord Arthur Balfour hatte Lord Rothschild, dem Repräsentanten der englischen Juden, im November 1917 bestätigt, dass die Regierung Seiner Majestät »mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina« betrachte und ihr Bestes tun werde, dieses Ziel zu erreichen. Einen Monat später nahmen die britischen Truppen unter General Allenby Jerusalem ein.
Die Idee, einen eigenen jüdischen Staat zu errichten, ist viel älter; die britische Außen- und Kolonialpolitik gab ihr aber den entscheidenden Schub für die Realisierung. Hinzu kam etwas Zweites: Nach der Oktoberrevolution versiegte Ende 1917 der Spendenstrom der russischen Pilger und trug zum Konkurs der griechisch-orthodoxen Kirche bei, die außerhalb der Stadtmauern den größten Grundbesitz in Jerusalem hatte, über verschiedene Stadtteile verteilt waren es fünfhundertachtunddreißigtausend Quadratmeter, etwa sechsundzwanzig Dunam. Dieser Grundbesitz ging in einer Versteigerung an den meistbietenden Jüdischen Nationalfonds und die Gesellschaft zur Besiedlung Palästinas. Der sogenannte »große Erwerb« umfasste Teile von Talpiot, dem »arabischen Dreieck« – heute die beiden Straßen Ben Jehuda und King George sowie das »Janziria a-Fauqa« (das Obere), auf dem später Rechavia errichtet wurde. Trotz aller Proteste arabischer Autoritäten und der katholischen Kirche übertrug die griechisch-orthodoxe Kirche das Gebiet am 12. Juni 1922 in einer feierlichen Zeremonie dem Jüdischen Nationalfonds und der Siedlungsgesellschaft. Der griechische Patriarch Damianus segnete die neuen Grundbesitzer. Der aus Rawitsch gebürtige, in Magdeburg aufgewachsene Arthur Ruppin dankte in deren Namen. Er schreibt im gleichen Jahr: »Ich hatte gehofft, wir würden das Gelände von Rechawia und der (späteren) Ben Jehuda-Straße schnell verkaufen und mit dem Kaufpreise die Schuld an den Patriarchen decken können. Ich kaufte mir selbst einen Bauplatz in Rechawia, um dadurch andere zur Nachahmung anzueifern. Aber die Jerusalemer Juden hatten zu dem steinigen, gebirgigen Gelände, das durch keine Straße mit Jerusalem verbunden war, kein rechtes Vertrauen. In der Tat dauerte der Weg dorthin, obwohl in der Luftlinie nur 1 km entfernt, infolge der schlechten Verbindung fast 1 Stunde.«
Die Idee einer Gartenstadt geht wesentlich auf das Buch von Ebenezer Howard »Garden Cities of Tomorrow« (1898) zurück. Howard propagierte darin, wie Theodor Fritsch zuvor in Deutschland, die Idee einer Gartenstadt. Licht, Luft und Grün sollten den Bewohnern der dicht besiedelten, verschmutzten Industriestädte des späten 19. Jahrhunderts Erholung, Ablenkung und den Komfort kurzer Wege zur Arbeit bieten. Mustergültig erschien Howard die Gartenstadt Hellerau bei Dresden.
Das Jerusalem der 1920er Jahre hatte mit den großen, verrußten Industriestädten Englands nichts gemein. Dennoch meinte Kauffmann nach der Rückkehr von einer ausgedehnten Reise zu den Gartenstädten Englands, Hollands und Deutschlands Ende 1922, dass es »für unser Land, sowohl unter praktischen als auch unter sozialen, gesundheitlichen, moralischen und künstlerischen Gesichtspunkten keine bessere Siedlungsform« geben könne. Er war beeindruckt von den »grünen Lungen« und »den Spaziergärten«, die die Gartenstädte wie ein »schlagendes Herz« belebten. Im Gegensatz zu den desolaten Großstädten verkörpere die Gartenstadt das Ideal eines ruhigen Arbeits- und Wohnorts, kurz gesagt: »das Ideal des Lebens überhaupt«.
Hier kam das Selbstverständnis des Zionismus als junger, avantgardistischer Bewegung zum Tragen, die an eine avancierte Form des Bauens Anschluss sucht. So plädiert Kauffmann für eine höhere, edlere Entwicklungsstufe beim Bauen. In seinem ersten Entwurf für das Viertel, auch Rechavia 1 oder A genannt, zeichnet er die Fläche von der Keren-ha-Kajemet-Straße im Norden zur Rambanstraße im Süden, zwischen der King-George-Straße im Osten bis zur Diskinstraße im Westen. Das Rückgrat des Plans ist eine grüne Flanierachse – der heutige ha-Kuzari-Garten –, die das Viertel von Nord nach Süd teilt. Diese Achse beginnt mit dem Gymnasium Rechavia und schließt mit dem Spielplatz an der Rambanstraße, dem heutigen Eliezer-Jelin-Garten. Von der Achse verzweigen sich lange schmale Straßen (Alcharisi und Arlosoroff). Die Häuser sollten in großen Gärten stehen, die eine dörflich ruhige Atmosphäre ausstrahlen. Die Mängel des Plans, der von einem weithin eigenen, abgeschlossenen Viertel ausging, traten erst im Laufe der Jahre zutage. Die schmalen, eher fürs Flanieren angelegten Straßen wurden zu dicht befahrenen Verkehrsadern im wachsenden Jerusalem.
Die Einwanderung der Juden, die vor dem Nationalsozialismus aus Deutschland flohen, ließ das Stadtviertel dramatisch anwachsen: Gab es 1933 erst siebenundachtzig Häuser und siebenhundertfünf Bewohner, waren es 1936, etwa ums Dreifache angewachsen, zweihundertsechsundvierzig Häuser und 25.520 Bewohner. Das Adressbuch für Rechavia, ein Heft von siebzehn Seiten, verzeichnet in jenem Jahr rund fünfhundertfünfzig Einträge von Familien oder alleinstehenden Bewohnern. Die Liste der Familiennamen – Oppenheimer, Scholem, Herlitz, Koebner – wie der Vornamen – Siegfried, Arthur, Theodor, Berthold, Fritz, Paula, Rosa und anderer – zeugt von der Herkunft; es gibt einige russische und polnische Namen. Die Liste der Berufe – Professor, Lehrer, Arzt, Beamter – bezeugt die Sozialstruktur. Nur ganz vereinzelt ist ein Friseur etwa oder ein Lebensmittelhändler, ein Elektriker darunter. Die Handwerker in Rechavia – Schlosser, Schneider, Friseure, Bäcker, ein Blumenhändler, Polsterer – kamen in der Regel aus Polen, Litauen, Russland. Frauen sind allerdings durchaus mit ihrem Handwerk vertreten. Es gibt eine Näherin, unterschieden von einer Schneiderin, eine Topfmalerin oder eine Köchin. Sefardische Namen, wie Abady, sind nur vereinzelt zu finden, arabische gar nicht. Es gibt in der Keren-ha-Kajemet-Straße 21 einen Adolf, mit Nachnamen Lustig, Ingenieur.
Mit der sogenannten fünften Alija, der Einwanderungswelle von 1933 bis Anfang der 1940er Jahre, kamen fünfzig- bis sechzigtausend jüdische Emigranten aus Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei ins Land, der geringste Teil von ihnen zog nach Rechavia, das »Jeckenland«, wie David Kroyanker es nennt, der geringste, aber besonders prägende Teil der alt-neuen Bevölkerung.
Das Hebräische Gymnasium
Der vorgelagerte Posten, um das Nachbarviertel zu erkunden, war das Gymnasium Rechavia, auch das Hebräische Gymnasium genannt, das Amos besuchte. Nach dem gleichnamigen Gymnasium in Tel Aviv war es die zweite höhere jüdische Lehranstalt in Palästina. 1901 zunächst im Bucharenviertel errichtet, bezog die Schule 1929 in der Keren-ha-Kajemet-Straße das heutige Gebäude. Zu den ersten Lehrern gehörten Yitzhak Ben-Zvi, der zweite Präsident des Staates Israel, ein Lehrer und Gelehrter, nach dem heute das stadtgeschichtliche Institut Jerusalems in Rechavia benannt ist, und seine Frau Rachel Yanait. Zu Schülern zählten später berühmte Gelehrte wie Trude Dothan, Politiker wie Dan Meridor oder Reuven Rivlin, der israelische Präsident, Schriftsteller wie A. B. Yehoshua und viele andere.
Das Wort »Gymnasium« verheißt humanistische Bildung, doch ging es hier eher um zionistische Ausbildung: Hebräisch, Bibelstudium, Englisch und moderne Fremdsprachen, aber auch Mathematik, Landeskunde, Psychologie, Sport und technische Fächer.

Das Hebräische Gymnasium, Mitte der 1930er Jahre
Wie sehr die Ansiedlung jüdischer Familien aus Deutschland in Rechavia auch auf Widerstand stieß, schildert Esther Herlitz, die, 1921 in Berlin geboren, 1933 mit ihren Eltern nach Jerusalem kam:
»Ich wollte unbedingt eine Sabre [eine in Israel Geborene] sein, ich versuchte mit aller Kraft, die Merkmale des Jeckes, die an mir klebten, zu tilgen. Ich weigerte mich, mit meiner Mutter Deutsch zu sprechen, obwohl sie nur wenige Worte Hebräisch konnte. Die Sprache war schwer zu erlernen; sie gab es auf. Aber die Sabres in der Klasse [des Gymnasiums Rechavia] gaben mir und meinen drei Freundinnen, die kaum Hebräisch sprachen und sich auf Deutsch verständigten, keine Chance, uns zu integrieren. Sie nannten uns ›Nazis‹. Ich weinte nicht, zeigte kein Zeichen von Beleidigtsein, war aber schrecklich wütend. Ich ging nach Hause und kündigte an zu streiken. Ich ließ meine Eltern wissen, dass ich nicht mehr in diese Schule gehen werde. Ich mochte die Schule nicht und konnte das Verhalten der Schulkameraden nicht ertragen. Die Auslegungen von Raschi [im Religionsunterricht] verstand ich auch nicht. Ich wollte nur weg. Nach einem Jahr nahte die Rettung. Die Leiterin der Zionistischen Schule in Berlin kam nach Israel und eröffnete eine Schule in Talpiot. Gott sei Dank. Alle jeckischen Kinder standen auf und wechselten die Schule.«
Da hatte das dreizehnjährige Mädchen schon ein traumatisches Schuljahr in Deutschland hinter sich, ehe es nach dem unliebsamen Intermezzo in Rechavia in die neugegründete Hebräische Universitätsschule in einem anderen Teil Jerusalems ging. Esther trat robust, herzlich, engagiert in die Dienste ihres Landes, kämpfte als Offizierin in der britischen Armee und in der Hagana, der zionistischen Untergrundarmee. Sie wurde später Botschafterin Israels in Dänemark, ihr Leben lang hielt sie besondere Verbindung zu diesem Land. Für die Arbeiterpartei war sie Mitglied der Knesset.
Joseph Lachmann wurde am 10. November 1882 in Znin bei Bromberg geboren. Der Vater Nachman starb, als das Kind fünf Jahre alt war, die Mutter Louise blieb zunächst mit ihren sechs Kindern allein, ehe sie wieder heiratete und nach Berlin zog. Nach dem Abitur am Humboldt-Gymnasium studierte Joseph Medizin und spezialisierte sich während eines fünfmonatigen Praktikums am Jüdischen Krankenhaus in Berlin in der damals noch jungen Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Als Spezialist ließ er sich in Berlin nieder, versuchte aber schon früh, nach Palästina zu kommen. Einige Reisen führten ihn ins Land. Die Auswanderung scheiterte zunächst an der mangelnden beruflichen Perspektive. Dr. Lachmann wohnte mit seiner Familie in der Motzstraße in Schöneberg.
Als der Nationalsozialismus heraufzog, bot ihm der amerikanische Botschafter in Deutschland, der sein Patient war, die Emigration in die USA an. Lachmann lehnte ab und emigrierte mit seiner Frau Valerie und ihren beiden Töchtern nach Palästina.
Joseph Lachmann errichtete die Hals-Nasen-Ohren-Abteilung im neuen Hadassa-Krankenhaus auf dem Mount Scopus, die er bis zu seiner Pensionierung 1952 leitete. In Rechavia bewohnten die Lachmanns die berühmte Windmill, eine Mitte des 19. Jahrhunderts von der griechisch-orthodoxen Kirche erbaute Windmühle, die Pilgern im Heiligen Land ihr Osterbrot mahlte. Später wurde aus der ländlichen Ikone mitten in einem modernen Stadtteil ein Wohnhaus. Auch Erich Mendelsohn wohnte dort einige Zeit und hatte sein Atelier in der Mühle.
Joseph und Valerie Lachmanns Tochter Ruth, am 19. November 1919 in Berlin-Schöneberg geboren, die ältere Schwester der 1921 geborenen Evelin (Chava), besuchte, nach der Schule in Talpiot, wo Esther Herlitz eine jüngere Schulkameradin war, das Hebräische Gymnasium. Ihr Zeugnis aus dem Jahr 1937 hat sich erhalten: in Naturkunde und Ökonomie werden Ruths Noten mit »kim’at tov«, fast gut, Geschichte gut, Psychologie, Grammatik, Literatur, Englisch, Französisch mit fast gut bewertet, Algebra und Geometrie ausreichend, das kuriose Fach »medizinische Literatur« hingegen wiederum »gut«. Es gibt ein Fach Zion und Landwirtschaftskunde, auch Handarbeit, die aber im Zeugnis durchgestrichen sind, also wohl entfielen. Tanach, also Bibel, fast gut, Talmud ausreichend. Alle jeckischen Tugenden wie Benehmen, Führung, Aufmerksamkeit und Fleiß sind »sehr gut«. Ruth blieb auf dem Hebräischen Gymnasium.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.