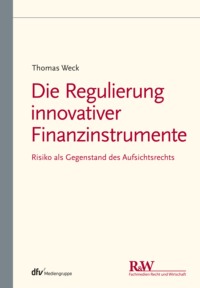Kitabı oku: «Die Regulierung innovativer Finanzinstrumente», sayfa 25
D. Rechtsfolgen
Wenn ein Gefahrentatbestand vorliegt, stellt sich die Frage, ob bzw. inwiefern Maßnahmen auf Rechtsfolgeseite ergriffen werden müssen und inwiefern hierbei Grenzen zu beachten sind. Insofern ist zwischen den grundlegenden regulatorischen Entscheidungen des Gesetzgebers und der Anwendung bzw. Durchsetzung des Aufsichtsrechts durch die Aufsichtsbehörden zu trennen, denn der Gesetzgeber kann als Inhaber der Staatsgewalt den Aufsichtsbehörden nähere Vorgaben für die Anwendung bzw. Durchsetzung des Aufsichtsrechts machen.
I. Ebene der Gesetzgebung
Als Inhaber der Staatsgewalt hat zunächst der Gesetzgeber über die Notwendigkeit aufsichtsrechtlicher Regelungen zu entscheiden. Diese Entscheidung ist aufgrund einer Abwägung der Bedeutung der aufsichtsrechtlichen Schutzgüter mit den betreffenden Risiken zu treffen.
Die angesprochene Rechtsgüterabwägung eröffnet Raum für die Berücksichtigung höherrangiger Rechtsgüter des europäischen und deutschen Rechts, beispielsweise der Grundfreiheiten und Grundrechte. Zwar verfügt der Gesetzgeber über einen Gestaltungsspielraum, und zwar sowohl hinsichtlich eines etwaigen Tätigwerdens an sich („Ob“) als auch hinsichtlich der zu ergreifenden Maßnahmen („Wie“). Ein Handeln erscheint aber um so gebotener, wo die ohne ein Eingreifen möglichen Nachteile für die geschützten Rechtsgüter die Kosten eines Eingriffs deutlich überwiegen. In diesen Fällen dürfte sich der Spielraum zumindest hinsichtlich des „Ob“ aufsichtsrechtlichen Maßnahmen reduzieren. Diesen Überlegungen entsprechend sind die Eingriffsbefugnisse angesichts der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der relevanten Schutzgüter der Entstehung einer konkreten Gefahr, wie schon gesagt, besonders weit vorgelagert und setzen eine Gefahr zumeist nicht einmal explizit voraus. Bei dem gewählten Regelungsansatz dürfte auch der Umstand eine Rolle spielen, dass sich Gefahren nur schwer begrenzen lassen, wenn sie sich realisieren (runs!).
Problematisch kann allerdings die Auswahl der gebotenen Maßnahme und damit das „Wie“ eines aufsichtsrechtlichen Eingriffs sein. Die Schwierigkeiten der Identifikation einer Gefahrenlage und der weit vorverlagerte Eingriffszeitpunkt können es insbesondere auf der Gesetzgebungsebene erschweren, vorab geeignete und erforderliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu bestimmen. Darauf ist bei der Prüfung der Regulierung im Einzelnen näher einzugehen.
II. Ebene der Aufsichtsbehörden
Den Aufsichtsbehörden steht bei der Entscheidung über einen Eingriff und der Auswahl der betreffenden Maßnahmen nach allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätzen typischerweise Ermessen zu (Opportunitätsgrundsatz). Allerdings kann dieses Ermessen für bestimmte Fälle gesetzlich beschränkt werden. Außerdem müssen die Aufsichtsbehörden bei der Anwendung der Gesetze ihrerseits abwägen, ob ein Eingreifen zum Rechtsgüterschutz geboten ist oder umgekehrt zu weit ginge.
Dies wiederum bedeutet, dass sich Grenzen für die Ausübung aufsichtsbehördlichen Ermessens ergeben. So sind im Fall eines bloßen Gefahrenverdachts nach allgemeinem Ordnungsrecht lediglich so genannte Gefahrerforschungseingriffe zulässig. Ein Gefahrenverdacht liegt vor, wenn aus Behördensicht Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Gefahr bestehen, aber die hinreichende Wahrscheinlichkeit ihrer Realisierung nicht hinreichend feststellbar ist.696 Dies bedeutet im finanzaufsichtsrechtlichen Zusammenhang beispielsweise, dass die zuständige Behörde eine Produktintervention nicht vornehmen darf, ohne zuvor gegenüber den Marktteilnehmern ihre Befugnisse zur Durchsetzung von Informations- und Offenlegungspflichten im konkret gebotenen Umfang auszuüben. Allerdings kann die Behörde die Marktteilnehmer als Verursacher oder sonst Verantwortliche (sog. Störer) im Rahmen der behördlichen Befugnisse auch zu so genannten Gefahrerforschungsmaßnahmen verpflichten, um so das Ausmaß vorhandener Gefahren zu ermitteln.
Dessen ungeachtet dürfte den Aufsichtsbehörden grundsätzlich ein sehr weiter Spielraum für etwaige Eingriffe einzuräumen sein. Denn auch in diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass die gesetzlichen Eingriffsbefugnisse angesichts der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der relevanten Schutzgüter der Entstehung einer konkreten Gefahr bewusst weit vorgelagert sind und dass sich Gefahren nur schwer begrenzen lassen, wenn sie sich realisieren.
696 BVerwG, Urteil vom 18. Dezember 2002, 6 CN 4/01, Rz. 31f., 34; Urteil vom 18. Dezember 2002, 6 CN 3/01, Rz. 24, 27 (zit. nach Juris).
E. Abgrenzung zu anderen Bereichen der öffentlich-rechtlichen Gefahrenvorsorge
I. Einleitung
Das Prinzip der Gefahrenvorsorge baut zwar im Finanzaufsichtsrecht wie in anderen Bereichen des Ordnungsrechts auf dem Phänomen des „Risikos“ auf. Dennoch erscheint das rechtliche Verständnis von Risiken aus anderen ordnungsrechtlichen Bereichen nicht übertragbar.
Es wurde bereits dargelegt, dass diese Arbeit vom Gefahrenbegriff des allgemeinen Ordnungsrechts ausgeht und den Begriff des „Risikos“ verwendet, um wirtschaftliche Gegebenheiten zu bezeichnen, die unter Umständen zu Gefahren beitragen können. Risiken im wirtschaftlichen Sinn sind dabei, wie gesagt, durch die von Wahrscheinlichkeiten abhängige Aussicht geprägt, durch eine Transaktion mit einem Finanzinstrument einen wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen oder einen wirtschaftlichen Verlust zu erleiden.697 Zwar wird der Begriff des Risikos in der EU-Finanzmarktregulierung ausdrücklich als Tatbestandsmerkmal verwendet und hat so auch Eingang ins deutsche Recht gefunden.698 In diesen Fällen wird auf das Risiko unter anderem Bezug genommen, um Risiken im wirtschaftlichen Sinne (z.B. in § 2 Abs. 8 [= Abs. 3 a.F.] Nr. 5 WpHG: „Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko“) oder – relativ unspezifisch – die Möglichkeit von Rechtsgutsverletzungen (z.B. in § 63 Abs. 2 S. 1 [= § 31 Abs. 1 Nr. 2 a.F.] WpHG: „Risiko der Beeinträchtigung von Kundeninteressen“) zu bezeichnen. Es dürfte aber zu weit gehen, aus der Formulierung der betreffenden Einzelvorschriften Aussagen zur Regelungssystematik des bestehenden Aufsichtsrechts ableiten zu wollen. Das bedeutet Folgendes:
• Zum einen können für das deutsche Aufsichtsrecht grundsätzlich die hergebrachten Prinzipien des allgemeinen Gefahrenabwehrrechts weiter maßgebend bleiben.
• Zum anderen verlagern die besonderen Regelungen des Aufsichtsrechts die Eingriffsschwelle, soweit sie an die bloße Möglichkeit von Rechtsgutsverletzungen anknüpfen, in den Bereich der Gefahrenvorsorge und gestalten diese sowohl tatbestandlich als auch hinsichtlich der Rechtsfolgen weiter aus.699
In anderen Bereichen des Ordnungsrechts wird dem Risikobegriff jedenfalls im Schrifttum eine weitergehende rechtliche Bedeutung zugeschrieben. Diese rechtliche Bedeutung weicht nicht nur von dem hier zugrunde gelegten wirtschaftlichen Risikoverständnis ab (Abschn. II). Sie wird auch aus Vorgaben des höherrangigen Rechts hergeleitet, bei denen zweifelhaft ist, ob sie in vergleichbarer Weise für den Umgang mit Risiken im Finanzaufsichtsrecht gelten können (wo es ja eigene Vorgaben gibt) (Abschn. III).
II. Der Risikobegriff als Element eines „Risikosteuerungsrechts“?
1. Einführung
Ausgehend von der Beobachtung, dass die Eingriffsschwelle mittlerweile in vielen Bereichen des Ordnungsrechts vorverlagert ist, wird diskutiert, ob sich das Ordnungsrecht zunehmend von einem Gefahrenabwehrrecht zu einem so genannten Risikosteuerungsrecht entwickelt. Die Diskussion ist nicht nur semantischer Natur. Sie erscheint auch im aufsichtsrechtlichen Kontext relevant, zumindest soweit es um die Regulierung von Finanzinstrumenten mit einer neuartigen Risikostruktur geht.
Im Wesentlichen dürfte im einschlägigen Schrifttum Einigkeit bestehen, dass das Prinzip der Gefahrenvorsorge zumindest außerhalb der Finanzmärkte ein allgemeines Regelungsprinzip darstellt, mit dem ein Rechtsgüterschutz in Bereichen gewährleistet werden soll, die einer ordnungsrechtlichen Gefahr vorgelagert sind.700 Diese Gefahrenvorsorge ist von der Abwehr abstrakter Gefahren und auch von der Prüfung eines Gefahrenverdachts abzugrenzen. Bei einer abstrakten Gefahr besteht im Falle einer gedachten Mehrzahl konkret gefährlicher Sachverhalte die Unsicherheit, welcher Sachverhalt voraussichtlich eintreten wird. Beim Gefahrenverdacht bestehen Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Gefahr. Es ist nach den vorliegenden Informationen aber unsicher, wie die bestehende Situation zu deuten ist (Diagnoseproblem) oder welcher Geschehensablauf auf dieser Grundlage zu erwarten ist (Prognoseproblem), sodass sich die Wahrscheinlichkeit eines Schadens noch nicht abschätzen lässt.701
Des Weiteren lässt sich festhalten, dass das Risiko als Merkmal eines ordnungsrechtlich zu beurteilenden Sachverhalts – abweichend vom wirtschaftlichen Verständnis – nicht neutral als Unsicherheitsfaktor, sondern vielmehr in einem engen Zusammenhang mit Schadenspotenzialen gesehen wird. Die gesetzlichen Formulierungen z.B. im Umweltrecht dürften einen solchen Sprachgebrauch auch nahelegen.702 Dabei sind ordnungsrechtlich nur solche Schadenspotenziale relevant, die bei ungehindertem Geschehensablauf ohne staatliches Einschreiten bestehen, nicht aber Schadenspotenziale aufgrund von staatlichen Fehlentscheidungen.703 Des Weiteren wird das Risiko, wenn auch in unterschiedlichen Formulierungen, als Unsicherheitsfaktor angesehen, der gerade deshalb rechtserheblich ist, weil er die Einschätzung eines möglichen Schadens erschwert.704 Dieser am Schaden orientierten Risikobetrachtung soll nicht entgegenstehen, dass Schadenspotenziale mit der Verfolgung eines davon abtrennbaren Nutzens verbunden sein können.705
Eine Gefahrenvorsorge zur Risikosteuerung im zuvor beschriebenen Sinne bedeutet, dass das Finanzaufsichtsrecht grundsätzlich nach ähnlichen Grundsätzen zu betrachten ist wie Regelungen zur Katastrophen- und Seuchenbekämpfung, der Terrorabwehr oder zum Umgang mit Cyberangriffen. Denn in allen derartigen Bereichen können Schadensereignisse zu immensen Schäden führen, die zugleich breit streuen. Die zuständigen Behörden verfügen auch nicht ohne Weiteres über die nötigen Informationen, um eine zutreffende Lagebewertung vorzunehmen. Außerdem kann der Eingriffszeitpunkt für Maßnahmen der Gefahrenabwehr so spät liegen, dass sich die Schäden tatsächlich nicht mehr abwenden lassen. Aus diesen Gründen wird die Eingriffsschwelle vom Gesetzgeber vorverlagert, um eine etwaige Schädigung der Rechtsgüter, deren Schutz die Vorsorge dienen soll, zu vermeiden.
Die Idee eines eigenständigen Risikosteuerungsrechts ist allerdings immer noch von großen Unsicherheiten geprägt. Auf Tatbestandsseite stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis das „Risiko“ als rechtliche Kategorie zur Gefahr steht (dazu nachfolgend Abschn. 2). Auf Rechtsfolgenseite stellt sich die Frage, was aus einer solchen rechtlichen Kategorie für den Umgang mit Risiken folgt (dazu Abschn. 3). Immerhin dürften Risiken rechtsdogmatisch bedeutsam sein, weil sie zu einer Verknüfung von Tatbestand und Rechtsfolge führen. Dies ist auch im vorliegenden Kontext relevant (Abschn. 4).
2. Tatbestandsseite: Risiko als eigenständige rechtliche Kategorie?
Sofern im Schrifttum rechtlich von „Risikosteuerung“ gesprochen wird, erscheint bereits das zugrunde gelegte Risikoverständnis unsicher. Dabei ist vor allem unklar, welche Merkmale das Risiko als rechtliche Kategorie auszeichnen und wie es sich von der Gefahr abgrenzen lässt.706 So ist zwar vorgeschlagen worden, den Risikobegriff zur Bezeichnung einer von einem potenziellen Störer bewusst in Kauf genommenen Sachlage zu verwenden, während der Gefahrbegriff diese Sachlage aus Sicht des davon Betroffenen beschreiben soll.707 Andere wollen die Gefahr als objektive Gegebenheit betrachten und das Risiko als vom Wissenshorizont des Beurteilenden abhängig.708 Allerdings bleibt offen, was der Mehrwert dieser rein terminologischen Abgrenzungen ist, da in der ordnungsrechtlichen Debatte jedenfalls der Schaden für den Betroffenen beherrschend ist.
Ansonsten stehen sich im Wesentlichen zwei Regelungskonzeptionen gegenüber. Die erste und vorherrschende Konzeption geht von einem Stufenverhältnis zwischen Risiko und Gefahr aus. Diese Konzeption wird im Wesentlichen in zwei Varianten vertreten. In der einen Variante wird je nach Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts und Höhe des zu erwartenden Schadens zwischen Gefahr, Risiko und Restrisiko unterschieden (sog. dreistufiges Modell).709 Durchgesetzt habe sich zumindest in Deutschland jedoch ein anderer Ansatz, nachdem von Gefahren im Fall der Wahrscheinlichkeit und von Risiken im Fall der Möglichkeit einer Rechtsgutsbeeinträchtigung gesprochen werde (sog. zweistufiges Modell).710 Das Risiko wird in diesem Fall als umfassendere rechtliche Kategorie angesehen. Diese begreift Gefahren als schadensgeneigte Sachlagen ein, bei denen Abwehrmaßnahmen gerechtfertigt sind, aber auch unbedenklichere Sachlagen, die nur Vorbeuge- oder Vermeidungsmaßnahmen gestatten.
Eine andere Regelungskonzeption geht davon aus, dass sich Gefahren und Risiken ihrem Wesen nach unterscheiden (Risiko als sog. aliud).711 Diese Konzeption beruht auf der Annahme, dass Wahrscheinlichkeiten und Schadenshöhen wertungsabhängig und nicht mathematisch auf Basis empirischer Erfahrungen berechenbar seien. Denn anders als „bei landläufigen Gefahren“ fehlten bei „großen Zvilisationsrisiken“ z.B. aufgrund des Klimawandels, neuer Krankheiten, Terroranschlägen oder globaler Wirtschaftskrisen sichere Erfahrungswerte, oder die Ausgangsbedingungen seien zu komplex.712 Zwischen Risiken und Gefahren müsse daher anhand des Ungewissheitsgrads differenziert werden. Damit wird aus rechtlicher Sicht die ökonomische Unterscheidung zwischen nicht behebbaren Unsicherheiten (uncertainty) und mithilfe von Wahrscheinlichkeitsaussagen behebbaren Ungewissheiten (risk) wieder aufgegriffen.713 Zu weitgehend wird hierbei allerdings teilweise angenommen, der Risikobegriff sei „als prognostisches Gedankenkonstrukt von menschlicher Bewertung abhängig und daher nicht objektivierbar“.714 Wenn dies zuträfe, wäre die Finanzmathematik nur Illusion. Dessen ungeachtet wurde schon zuvor mit Blick auf die Relevanz des Ungewissheitsgrads darauf hingewiesen, dass es für die aufsichtsrechtliche Gefahrenabwehr nur darauf ankommt, ob Informationsdefizite überhaupt bestehen, aber nicht darauf, ob die daraus folgenden Risiken aus unbehebbaren oder behebbaren Informationsdefiziten resultieren. Eine Regelungskonzeption, die auf der Annahme des Risikos als wesensmäßg von der Gefahr unterscheidbarem Regelungsgegenstand aufbaut, bietet für das Finanzaufsichtsrecht folglich keinen Mehrwert.
Im Übrigen kann hier offenbleiben, ob eine Kategorisierung im Sinne einer Stufenbildung außerhalb des Finanzaufsichtsrechts stattfindet und ob sie in der Sache sinnvoll ist.715 Auf das Finanzaufsichtsrecht dürften die Annahmen über eine in der Gesetzgebung verankerte Stufenbildung jedenfalls nicht übertragbar sein oder zumindest ebenfalls keinen Erkenntnisgewinn bringen. Insbesondere ist zu beachten, dass sich aus dem EU-Recht keine Aussagen für das deutsche Konzept der Gefahrenvorsorge herleiten lassen dürften. Das EU-Recht hat auf das nationale Aufsichtsrecht zwar einen sehr starken und zuweilen begriffsprägenden Einfluss. Dabei trifft es aber stets nur Aussagen zu konkreten Regelungsgegenständen und macht den Mitgliedstaaten darüber hinaus keine rechtssystematischen Vorgaben. Wenn sich im nationalen Recht zwischen Gefahren als rechtlichem Tatbestandsmerkmal und Risiken als Sachverhalt unterscheiden lässt, ist das EU-Recht insofern also grundsätzlich auch dann neutral, wenn es selbst den Risikobegriff zur Bezeichnung eines bestimmten Regelungsgegenstands (z.B. Finanzmarktrisiken) verwendet. Davon abgesehen wird der Begriff des Risikos im Finanzaufsichtsrecht zu uneinheitlich verwendet, als dass eine Kategorisierung sinnvoll erscheint.716
3. Rechtsfolgeseite: Rechts- oder präventionsstaatliche Funktionslogik?
Ihre eigentliche Bedeutung gewinnt die Debatte um ein Risikosteuerungsrecht, wenn es um die Rechtsfolgen von Risiken geht. Denn die Vorverlagerung staatlichen Handelns im Rahmen der Gefahrenvorsorge bedeutet, dass die Möglichkeiten von Fehlentscheidungen zunehmen. Wenn diese Entscheidungen mit Rechtseingriffen verbunden sind, dann kann der Schaden für die Betroffenen größer sein als der Nutzen erhöhter Sicherheit für die übrige Bevölkerung. Im Kern geht es um die Grenzen, die dem Ordnungsrecht im modernen Rechtsstaat allgemein zu ziehen sind. Das Rechtsstaatsprinzip verlangt einerseits, dass verfassungsrechtlich anerkannte Schutzgüter in einem Mindestumfang geschützt werden (Untermaßverbot), aber fordert andererseits, dass Rechtseingriffe den gebotenen Umfang nicht übersteigen (Übermaßverbot).
Die Anforderungen des Rechtsstaatsprinzips kollidieren bei Lichte betrachtet mit der Funktionslogik eines auf Effektivität ausgerichteten Risikosteuerungsrechts. Denn absolute Sicherheit ist nur dann denkbar, wenn es keine Risiken gibt. Der Präventionsgedanke führt bei konsequenter Anwendung somit dazu, dass an die Stelle einer durch Verhältnismäßigkeit begrenzten Rechtsdurchsetzung eine unbegrenzte Risikominimierung treten muss.717 Die rechtsstaatlichen Bewertungsparameter verlieren unter diesen Umständen ihre maßstabbildende Kraft.718 Statt dessen kann es dazu kommen, dass der staatliche Schutz der Rechtsgüter, zu deren Gunsten Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden, die uneingeschränkte Oberhand gegenüber dem Schutz anderer Rechtsgüter gewinnt, in die zu diesem Zweck eingegriffen wird. Zugleich wird die Entscheidung immer stärker auf die Beurteilung verengt, welche der zuständige Amtswalter im konkreten Einzelfall zu treffen hat. Die „Nichtgefährlichkeit des Bürgers ist nicht mehr selbstverständliche Normalität.“ Im Gegenteil können Maßnahmen auch anlassunabhängig und mithin unabhängig davon getroffen werden, ob der Bürger zumindest in einer „Nähebeziehung“ zu einer von ihm zu trennenden Gefahrenursache steht.719 Entscheidend ist vielmehr, ob der im Einzelfall entscheidende Amtswalter aus seiner Warte heraus die Möglichkeit sieht, durch die ergriffenen Maßnahmen zur Neutralisierung etwaiger Risiken beizutragen.
Der Wunsch nach einer effektiven Gefahrenvorsorge hat auch in anderen Bereichen des Polizei- und Ordnungsrechts als dem Finanzaufsichtsrecht zu einer erheblichen Vorverlagerung der behördlichen Aufgaben und Eingriffsbefugnisse geführt. Dies lässt sich beispielhaft anhand der polizeilichen Datenerhebung aufzeigen. Zusätzlich zu den ohnehin bestehenden Befragungsrechten im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen sind den Behörden hier Befugnisse eingeräumt worden, die Identität von Personen festzustellen, deren Aufenthalt an bestimmten Orten die Annahme rechtfertigt, dass dort Straftaten vorbereitet werden oder dass es aus anderen Gründen zu einer konkreten Gefahr kommen kann.720 Weitergehend sind Maßnahmen wie die Rasterfahndung eingeführt worden, die eine automatisierte Verarbeitung der Daten einer unbestimmten Anzahl von Personen beispielsweise zur Ermittlung terroristischer „Schläfer“ gestattet.721 Noch einen Schritt weiter geht das Land Bayern, das Aufklärungsmaßnahmen und sogar eine elektronische Überwachung von Personen bei einer lediglich „drohenden“ Gefahr für bedeutende Rechtsgüter zulässt.722 Eine drohende Gefahr soll dann vorliegen, wenn sich der zum Schaden führende Verlauf noch nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorhersehen lässt, soweit bereits bestimmte Tatsachen auf eine Gefahr im Einzelfall hinweisen.723 Zusammengefasst findet also eine zunehmend verdachts- und ereignisunabhängige Informationssammlung statt, um bei Eintritt einer Gefahrenlage für die Gefahrenabwehr vorbereitet zu sein.724
Die hiermit einhergehende Verlagerung behördlicher Befugnisse ins Gefahrenvorfeld ist umstritten geblieben. Die neuen polizeilichen Befugnisse sind im Schrifttum teilweise mit dem staatlichen Gewaltmonopol und dem Anspruch der von Straftaten Betroffenen auf eine vorbeugende Bekämpfung gerechtfertigt worden.725 Kritiker wenden hiergegen ein, dass schwere Grundrechtseingriffe etwa zur Identitätsfeststellung oder Überwachung in einem nur vage umgrenzten Gefahrenvorfeld nicht zu rechtfertigen seien.726 Das bayerische Gesetz ist bisher singulär geblieben.727 Das Bundesverfassungsgericht hat aber angesichts der Streubreite von weit im Vorfeld greifenden Maßnahmen auch besondere Grenzen definiert, die den Spielraum für in die Rechte der Betroffenen eingreifende Maßnahmen begrenzen. Danach kann eine allgemeine Bedrohungslage („Dauergefahr“) keine Eingriffe rechtfertigen, die nach ihrem Gewicht eine konkrete Gefahr für hochrangige Rechtsgüter erfordern.728 Bei einem noch nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorhersehbaren Kausalverlauf müssen zudem bereits bestimmte Tatsachen auf eine im Einzelfall drohende Gefahr für ein „überragend wichtiges“ Rechtsgut hinweisen. Zwar wird diese Rechtsprechung wegen ihrer Unbestimmtheit kritisiert.729 Jedoch dürfte eine verfassungsrechtlich zulässige Gefahrenvorsorge danach zumindest davon abhängen, ob es ein schutzfähiges Rechtsgut und eine speziell die betreffenden Maßnahmen rechtfertigende Gefahrenlage (insb. im Fall von Eingriffen in die Rechte Dritter) gibt.730
Diese Anforderungen sollten die Effektivität der Gefahrenvorsorge nicht grundsätzlich beeinträchtigen. Der Effektivitätsgrundsatz wird vielfach zur Begründung von Präventionsmaßnahmen herangezogen. Dabei bleibt bisweilen unklar, wo dieser Grundsatz rechtlich genau verortet wird und welchen Inhalt er hat.731 Zutreffend erscheint ein Effektivitätsverständnis, wonach rechtliche Effektivität einen Rationalitätsmaßstab für die Verwaltungsorganisation darstellt und sich danach bemisst, ob das Recht in seiner Steuerungswirkung bzw. mit Blick auf die Zielerreichung anwendungswirksam ist.732 Ein solches Effektivitätsverständnis lässt sich für den Gesetzgeber aus der demokratischen Legitimation seines Handelns (Art. 20 Abs. 1, 2 GG) und für die Verwaltung aus deren Gesetzesbindung (Art. 20 Abs. 3 GG) ableiten.733 Es gestattet insbesondere eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Diese muss von den Anforderungen ausgehen, die das höchstrangige Recht (EU-/Verfassungsrecht) an den Schutz der dadurch anerkannten Rechtsgüter stellt. Der Effektitätsgrundsatz kann dann genutzt werden, um aus den betreffenden Rechtsgütern Kriterien für die Bemessung der zumindest zu ergreifenden Maßnahmen zur Risikoerkennung, Risikobewertung und zum Risikomanagement abzuleiten.734 Die Zulässigkeit der jeweiligen Maßnahmen wird nach außen hin durch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz begrenzt. Dieser steht unverhältnismäßigen Eingriffen in mitbetroffene Rechtsgüter entgegen.
Eine effektive Gefahrenvorsorge ist bei gegebener Unsicherheit realistischerweise nur darauf zu richten, dass Maßnahmen auf absehbare Sicht überhaupt einen Beitrag zur Vermeidung oder Verminderung konkreter Gefahren leisten können und nicht zugleich selbst mit übermäßigen Belastungen einhergehen.735 Wann dies der Fall ist, dürfte in erster Linie der Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers unterliegen. In Hinblick auf die Finanzmärkte hat sich der Gesetzgeber für eine im Ganzen sehr weitgreifende und daher auch sehr belastende Gefahrenvorsorge entschieden. Dabei hat er Instrumente gewählt, die vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus der Finanzkrise 2008–2012 und früherer Krisen aussichtsreich erschienen.736 Die rechtspolitische Entscheidung zu einer derart umfangreichen Gefahrenvorsorge ist angesichts der schwerwiegenden Folgen, die Finanzkrisen für die Gesamtwirtschaft haben können, nicht per se zu beanstanden, auch wenn sich angesichts der Belastungen für die Marktteilnehmer die Frage stellen kann, ob die Gesetzgebung noch verhältnismäßig ist.737