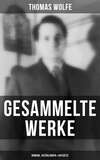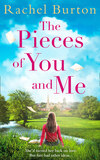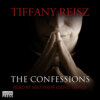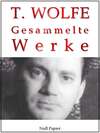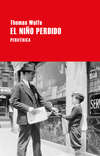Kitabı oku: «Gesammelte Werke: Romane, Erzählungen & Aufsätze», sayfa 9
Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin
Türler ve etiketler
Yaş sınırı:
18+Litres'teki yayın tarihi:
13 kasım 2024Hacim:
2761 s. 2 illüstrasyonISBN:
9788075830562Tercüman:
Yayıncı:
Telif hakkı:
Bookwire