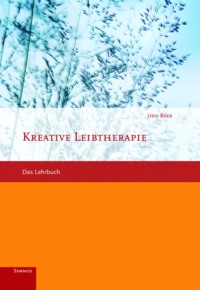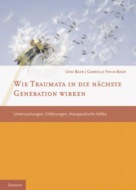Kitabı oku: «Kreative Leibtherapie», sayfa 3
2.1.3 Die Spaltung und ihre Aufhebung: Leib und „Körper”
René Descartes als Begründer des aufklärerischen bürgerlichen Denkens bezeichnete wie erwähnt den Menschen als „denkendes Ding”. In der Abgrenzung zum Körper differenziert er, der Mensch sei – als geistiges Wesen – ein „denkendes, kein ausgedehntes Ding”, während der Körper „lediglich ein ausgedehntes, kein denkendes Ding” ist (Descartes 2009, S. 85). Er schrieb, er sei sich „sicher, dass ich von meinem Körper tatsächlich unterschieden bin und ohne ihn existieren kann” (a.a.O.). Diese Spaltung zwischen Geist und Körper zog sich von dort an durch das abendländische Denken. Der Körper wurde als „Maschine der Körperteile” bezeichnet, „wie sie sich auch an einem Leichnam zeigt und die ich mit dem Namen Körper betitele” (a.a.O., S. 29). Der Körper wird zu etwas Objektivem, Unbeseelten, das sich nicht bewegt, sondern bewegt wird.
Der Körper taugt so allenfalls als Behälter des Bewusstseins, so wie auch heute in manchen Strömungen der Neurobiologie der Körper nur noch als Organ betrachtet wird, dem vor allem oder ausschließlich die Funktion zukommt, das Gehirn von einem Ort zum anderen zu transportieren – als ob es ein „Gehirn” ohne Körper und ohne Leiblichkeit geben könnte.
Dagegen setzt die Leibphänomenologie die Auffassung, dass es keine Leiblichkeit ohne Körper und keine Körperlichkeit ohne Leib gibt. Der Körper ist im Leibsein eingebettet. Wenn ein Mensch eine Haltung des aufrechten Ganges einnimmt, dann spannt er wahrscheinlich seine Rückenmuskulatur an, hebt seinen Kopf und streckt seine Glieder nach oben und unten. Und gleichzeitig spürt er sich aufrecht und aufrichtig, fühlt sich vielleicht erhaben und nimmt seine Umwelt anders wahr, so wie er anders wahrgenommen wird, als wenn er gebeugt durchs Leben gehen würde. Das Bild des Eingebettet-Seins ist stimmig. Wenn ein Mensch sein Bett verlässt, in das er sich eingekuschelt hatte, sind beide nicht mehr dasselbe, weder der Mensch noch das Bett. Auch das Bild, als Mensch in seiner Leiblichkeit „verwurzelt” zu sein, ist hilfreich. Eine Wurzel und das umgebende Erdreich sind miteinander verwoben, ein gemeinsamer Organismus. Wird die Wurzel aus dem Erdreich entfernt, verliert sie ihre Bedeutung und wird zu bloßem Holz oder Gemüse.
Hellmuth Plessner, der sich in seiner „philosophischen Anthropologie” um die Aufhebung der Körper-Geist-Seele-Spaltung seit Descartes bemüht, spricht von der „Doppelnatur des Menschen, die nicht statisch zu fassen ist, sondern eine ständig zu durchlebende und zu vollziehende Verschränkung des Leibes mit dem Körper bedeutet.” (Plessner 2003, S. 396)
Körperlichkeit und Leiblichkeit sind untrennbar verwoben. U n d es gibt eine Unterscheidung. Um ihr nahe zu kommen, bitte ich Sie um ein Experiment:
Strecken Sie eine Hand aus und betrachten Sie sie. Betrachten Sie ihre Form und ihr Aussehen. Unterscheiden Sie zwischen der Hand und ihrer Umgebung. Sie können ihre Hand wiegen und vermessen. Sie können ihre Muskulatur trainieren, sie pflegen und – bei Verletzungen – operieren lassen. Das ist der körperliche Aspekt, den Sie wahrnehmen.
Und nun schließen Sie die Augen und spüren Sie Ihre Hand. Vielleicht fühlt sie sich leicht oder schwer an, anpackend oder zurückhaltend, sanft oder kräftig ... Vielleicht erinnern Sie sich an Berührungen, die diese Hand erfahren oder vorgenommen hat ... Sie werden merken, dass die Grenzen dieser Hand nach außen verschwimmen ... Das ist der leibliche Aspekt in der Körperwahrnehmung.
Sie können diese Unterscheidung noch deutlicher wahrnehmen, wenn Sie eine Hand auf ihr Herz legen und sich eine oder zwei Minuten der Achtsamkeit gönnen. Sie werden sich leiblich spüren, in Bildern und Erinnerungen, Gefühlen und diesen oder jenen Impulsen. Mit dem EKG Ihres Herzens oder dessen Ultraschallbild dagegen betrachten Sie Ihr Herz von außen. Beides gehört zusammen, ist Teil ihrer Person, Ihres Menschseins, und beides beeinflusst sich gegenseitig – Panik und Druck können den Herzrhythmus beschleunigen und Herzrhythmusstörungen werden bei den meisten Menschen Angst hervorrufen. Doch das vermessene Herz des EKG („Körper”) und das spürende Herz („Leib”) sind zwei unterschiedliche und unterscheidbare Aspekte menschlichen Seins.
Menschen haben einen Körper, verhalten sich zu ihm, trainieren ihn, bewegen ihn, behandeln ihn bei Krankheiten und anderen Störungen usw. Und Menschen sind der Leib, sind leiblich. Immer und ohne etwas dafür tun zu müssen. „Diesen Körper habe ich; ich bin aber mein Leib.” (Gabriel Marcel 2001, zit. nach Frick 2009, S. 125)
Wird der Körper nur als „Ding” oder als „Maschine” behandelt, dann mag das für manche Berufe und Tätigkeiten sehr sinnvoll sein, z. B. bei chirurgischen Eingriffen. Doch im Alltagsleben beinhaltet solche Objektivierung des Körpers eine Verkümmerung des Lebens und der Lebendigkeit und führt zu Leiden. Gerade wenn es um Krankheit und Gesundheit geht, ist ein Verständnis der Doppelnatur von Leib und Körper hilfreich und notwendig. So betont Hermann Schmitz, dass „ein großer Teil der heute ‚psychosomatisch‘ genannten Krankheiten, (...) seinen Sitz weder im Körper noch in der Seele (hat), sondern im Leib (Gegenstandsgebiet des eigenleiblichen Spürens), von wo er auf den Körper ausstrahlt.” (Schmitz 1989, S. 16) Und Thomas Fuchs beklagt die Beschränkung der Medizin und der medizinischen bzw. psychiatrischen Forschung auf den Körper: „Unsere Leiberfahrung in Gesundheit und Krankheit geht der Erkenntnis des Organismus immer voraus. Die Leiblichkeit ist selbst der Rahmen, innerhalb dessen der menschliche Körper erst zum Gegenstand von Spezialwissenschaften werden kann. Um ihn zu erforschen, müssen sie das Leibsubjekt auf das Körperobjekt reduzieren, den Leib aus seiner gelebten Situation isolieren und in bestimmte wiederholbare Untersuchungsschemata bringen. Dabei entgleitet ihnen jedoch der Leib als Leib, in seinen Vollzügen und Funktionen. Sie können nur die organismischen Bedingungen dieser Funktionen erforschen und feststellen, nicht jedoch das Sehen, Hören, Sich-Bewegen als solches. Aber Kranksein ist leibliches Erleben, und so muss der Arzt immer wieder zum Erleben des Kranken zurückkehren, von dem er ausgegangen ist.” (Fuchs 2000b, S. 10) Der Rückbezug auf die Leiblichkeit ist nicht nur notwendige Aufgabe, wenn es um psychosomatische Störungen geht, sondern muss alle Heilungsprozesse und Heilungserfahrungen betreffen. Eine „Körpertherapie”, „Tanztherapie” oder „Bewegungstherapie”, die die leiblichen Zusammenhänge ignoriert, widerspricht der Leibhaftigkeit von Erkrankungen und von Gesundungsprozessen.
In der Therapie leidender Menschen begegnen wir Therapeut/innen den Trennungen des Körpers vom Leib in zwei Extremen: Entweder wird der Körper ignoriert und missachtet oder er wird als Behandlungsobjekt vergöttert, mit Medikamenten, Trainings, Operationen und Diäten. (Nichts grundsätzlich gegen Medikamente, Trainings usw. – es geht hier um die H a l t u n g dem Körper gegenüber!) Absicht der Kreativen Leibtherapie ist folglich oft, Körperlichkeit und Leiblichkeit wieder zu versöhnen und zu reintegrieren. Denn es gibt viele Aspekte des auch körperlichen Lebens, die sich der Objektivierung und Behandlung auf Dauer entziehen. Dazu gehört die Sexualität und der Schlaf, dazu gehört auch das Lachen und Weinen, in denen Körper-Haben und Leib-Sein mineinander verschmelzen. Schlaf und Sexualität sind leibliche Zustände, die heute auch chemisch zu steuern versucht werden. Das gelingt zeitweise, aber nicht auf Dauer und immer auf Kosten der Leiblichkeit. „Die Objektivierung des Leibes zum beherrschbaren Körper hat also zur paradoxen Konsequenz, dass ich das selbstverständliche Zuhausesein in ihm verliere.” (Fuchs 2000a, S. 133)
Ein Klient ging täglich eine Stunde Laufen und dann ins Fitnessstudio. Auf die Frage, wie es ihm gehe, konnte er nicht antworten. Als ich ihn einmal bat, eine Hand auf sein Herz zu legen und zu spüren, was er fühle, antwortete er: „Mein Herz ist jetzt im Ruhepuls.”
Die theoretische Abspaltung des „Körpers” – also vor allem der Körperempfindungen und des Körpererlebens – vom „Rest” des Menschen begegnet uns in der Therapie als pathologischer Ausdruck individuellen Leidens. Ein Versuch, körperliche Regungen nicht mehr zu spüren oder durch Kontrolle der Beherrschung zu unterwerfen, ist immer Produkt sozialer Erfahrung. Solche Versuche entstehen als Notwehr-Reaktionen auf ein Erleben, das unaushaltbar war. Werden z. B. nach einer Erfahrung sexueller Gewalt Ekel und Schmerz übermächtig, kann die Entfremdung des Körpererlebens als Schutz sinnvoll und wirksam sein. Das Problem besteht meist darin, dass die betroffenen Menschen allein gelassen bleiben und sich die ursprünglich als Notwehr fungierende Körper-Dissoziation chronifiziert und so zu einem Teil des Leidens wird.
Thomas Fuchs geht in der Verknüpfung zwischen Körper und Leib noch weiter als Plessner. Er spricht im Gefolge von der „Koextension” und „Korrespondenz” von Leib und Körper: Streicht eine Hand über die Haut, dann sehe ich die Hand und spüre subjektiv gleichzeitig das Streichen oder Streicheln. Bedeutsam für die therapeutische Arbeit halte ich seine über Plessner hinaus gehende Differenzierung zwischen Körper und Leib, die er mit den Ebenen A bis D beschreibt:
Da gibt es die Ebene A, den „unwillkürlich fungierenden, präreflexiv gelebten Leib” (2000a, S. 136), also die Leiblichkeit, die immer vorhanden ist, solange ein Mensch lebt, als Grundqualität, als Grunderleben seines Daseins.
B erscheint, wenn diesem Leib Achtsamkeit geschenkt wird; er wird dann zum „erlebten, gespürten (...) Leib” (s.o.).
Als Ebene C führt er den „in der Negativität (als Gegenstand, Hindernis u.a.) erscheinenden Körper, der mir als mein Körper bewusst und als Instrument verfügbar wird (körperlicher Leib)” auf. Dies wird z. B. dann deutlich, wenn der Körper trainiert wird oder der Bauch sich in einer zu engen Hose befindet oder der Arm schmerzt.
Schließlich folgt auf der Ebene D der „reine Körper der Anatomie oder Physiologie”.
Um die Bedeutsamkeit dieser vier Ebenen am Beispiel des aufrechten Gangs zu erläutern: Auf der Ebene D ist die Physiologie des aufrechten Ganges sicherlich naturwissenschaftlich zu untersuchen: Veränderungen des Blutbildes, des Blutdrucks, des Energiehaushaltes usw. Über das Erleben des aufrechten Ganges sagt dies genauso wenig aus wie die Ebene A, die präreflexive Leiblichkeit. In der therapeutischen Arbeit setzen wird uns vor allem mit den beiden mittleren Ebenen auseinander, den Ebenen B und C. Wir Kreative Leibtherapeut/innen fragen z. B. nach Bildern und Vorstellungen eines aufrechten Ganges (B) oder bitten darum, mit dem Körper so zu experimentieren, dass eine als aufrecht gespürte Haltung entsteht (C). Dabei geht es hier nicht darum, den Körper als defizitär oder hinderlich zu erfahren oder gegen ihn zu kämpfen, sondern ihn als Impulsgeber der Veränderung und Potential neuer Körpererfahrungen zu erleben (C), die zu neuem Erleben führen können (B). Dieser Prozess kann dann in den Alltag integriert werden und durch Wiederholungen so selbstverständlich werden, dass sich die Anatomie (z. B. Muskulatur) eines Menschen verändert (D) und der aufrechte Gang, seine Art des aufrechten Ganges, zu einem Teil der selbstverständlichen Leiblichkeit (A) wird.
Kreative Leibtherapie ist in diesem Sinne immer auch Körpertherapie. Doch der Körper steht weder in seiner Funktionalität noch in seiner Formbarkeit als Objekt im Vordergrund. Im Vordergrund steht das Körpererleben, das sich in den Big Ten vor allem in der leiblichen Körperbildarbeit wie auch in allen anderen Hauptmodellen der Kreativen Leibtherapie wiederfindet. In der Krankengymnastik ist es meist notwendig, „richtige” Bewegungen zu üben, um Störungen der Körperlichkeit zu beheben (aber auch da sind die Zuwendungen und die Freundlichkeit der Physiotherapeut/innen oft genauso heilend wie die Bewegungen). In der Kreativen Leibtherapie einschließlich der leiborientierten Tanz- und Bewegungstherapie geht es nie um „richtige” oder „falsche” Bewegungen, sondern um das Körpererleben, um die Erweiterung der Möglichkeiten der Leiblichkeit. Nach einer Lungenoperation kann es zum Beispiel notwendig sein, über bestimmte Übungen den Atemraum zu erweitern. Aber selbst dabei können die Grundsätze der leiborientierten Atemtherapie den Heilungsprozess fördern. Wir unterstützen die Achtsamkeit für das Atmen, so dass die meisten Menschen, mit denen wir arbeiten, unmittelbar einen Zugang dazu haben, wie sie sich und ihren Atem erleben: eingeengt oder weit, offen oder abgehackt, hechelnd oder friedlich, kraftvoll oder sich verlierend ... Jede Einengung der Beschäftigung mit dem Atmen nur auf die körperlichen Funktionen oder andererseits z. B. nur auf die Gefühle, die beim Atmen entstehen, ohne das Körpererleben einzubeziehen, würde die Erfahrungsmöglichkeiten der Klient/innen einengen. Die Einbettung des Körpers in die Leiblichkeit verschafft viele Möglichkeiten der Erfahrung und Veränderung.
2.1.4 Die Spaltung und ihre Aufhebung: Leib und „Umwelt”
In dem Verständnis der klassischen Psychoanalyse wurde der Mensch als für sich zu betrachtendes und aus sich heraus wirkendes Wesen betrachtet und seine psychischen Instanzen als „Organe” der Seele oder des „psychischen Apparats” angesehen. Sicherlich waren in dieser Sichtweise auch gesellschaftliche Wirkungen relevant, aber nur oder zumindest überwiegend in ihrer psychischen Repräsentation z. B. als Über-Ich.
Gegen diese Individual-Psychologie und -Psychotherapie entwickelte sich seit den 1950er, vor allem seit den 1970er Jahren eine Gegenbewegung, aus der die systemische Theorie und Therapie entstand. Hier soll es weder um eine Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse noch mit der systemischen Therapie gehen, was angesichts der Vielfalt und auch Unterschiedlichkeit ihrer jeweiligen Strömungen gar nicht möglich wäre. Diskutiert werden soll die Gegenüberstellung von Person und Umwelt oder sozialem System, die m. E. in beiden therapeutischen Richtungen zu einer Abspaltung sozialer Bezüge von der Leiblichkeit geführt hat.
Die Auseinandersetzung mit Haltungen, die den Menschen aus seinen sozialen Bezügen herauslösen und diese ignorieren, werde ich an anderer Stelle führen (Kap. 2.7), nachdem ich die Qualitäten des Erlebens herausgearbeitet habe und darauf Bezug nehmen kann. Hier geht es vor allem um die Auseinandersetzung mit einem Menschenbild, das die Trennung von Leib und Umwelt zugunsten einer Verabsolutierung der sozialen Welt zur Grundlage macht und das menschlichen Seins darauf reduziert, ein Teilchen sozialer Systeme zu sein. Gegen diese Reduktion wende ich mich und stelle das Menschenbild der Kreativen Leibtherapie dagegen.
So verdienstvoll der systemische Hinweis auf die Zusammenhänge der Probleme einzelner Menschen mit ihren Familien- und sonstigen Systemen war und ist, so gefährlich sind die Trennungen und Gegenüberstellungen. Grundauffassungen der Systemischen Therapie bestehen darin, dass soziale Systeme eine eigenständige Kraft und Wirkungsweise haben. Psychische Leiden einzelner Personen sind so ausschließlich Ergebnis systemischer Wirkungen. In den krassesten Annahmen spielen deshalb Gefühle und andere leibliche Regungen keine Rolle, in abgeschwächteren Varianten wird formuliert: „Immer mehr setzte sich die Überzeugung durch, dass es einfacher und erfolgreicher ist, ein Interaktionssystem zu therapieren statt eines Individuums. Denn es ist relativ einfach möglich, die Interaktionsregeln eines Systems direkt zu beobachten, während die intrapsychischen Vorgänge eines Individuums, seine Gedanken und Gefühle lediglich mit Hilfe sehr unsicherer hypothetischer Konstrukte zu erschließen sind.” (Webseite der DGSF, 2011)
Entscheidend ist hier, dass das „System” und die „intrapsychischen Vorgänge eines Individuums” als voneinander getrennt betrachtet werden. Die leibphänomenologische Auffassung und damit die Grundhaltung Kreativer Leibtherapie ist eine andere: „Der Leib steht dem Umraum nicht gegenüber; er ist nicht Dingliches, Gegenständliches, das sich auf den Raum des Körpers begrenzen ließe. Leiblichkeit bedeutet vielmehr ein lebendiges Geschehen, nämlich den fortwährenden Prozess der Vermittlung zwischen den Polen von Leib und Welt, die nicht voneinander zu trennen sind.” (Fuchs 2000b, S. 12)
Wir begegnen den Abspaltungen zwischen der Person und dem Umraum bei einzelnen Klient/innen:
„Nein”, sagte eine Klientin, „wie es mir geht, das kann ich niemandem erzählen. Ihnen schon, ein bisschen, denn Sie werden ja dafür bezahlt. Aber anderen? Das interessiert doch keinen. Das ist doch normal.”
Die Verbindung zwischen dem eigenen Spüren und der Umgebung ist unterbrochen, die Fähigkeit zum Mitschwingen im Umraum gestört. Vielleicht sind die Belastungen aus dem sozialen Umfeld so unerträglich geworden, dass die Betroffenen sich aus Selbstschutz abschotten mussten. Vielleicht sind sie mit ihren leiblichen Impulsen so oft ins Leere gegangen oder beschämt worden, dass sie ihre Impulse abbremsen. Aus welchen Gründen auch immer, die Trennung zwischen individueller Leiblichkeit und sozialem Umfeld ist ein Faktor des Leidens und nicht der Normalität.
Wird diese Trennung als gegeben hingenommen und zum Ausgangspunkt der Therapie gemacht, muss dies schwerwiegende Konsequenzen haben. Ein Beispiel: „Paarbeziehungen, Familien und Organisationen bestehen in dieser Sicht aus Kommunikationszusammenhängen, und wenn diese Kommunikationszusammenhänge pathogene Folgen haben, müssen nicht die Gedanken der Klienten verändert werden, sondern es genügt, die entsprechenden Kommunikationsmuster zu verändern.” (von Ameln 2004, S. 164) Dieses Konstrukt widerspricht unserer Erfahrung menschlichen Lebens, denn es kann keine getrennte Veränderung von Kommunikationsmustern und Gedanken geben. An der Kommunikation mit anderen sind die eigenen Selbsteinschätzungen, Gedanken, Gefühle und anderen Regungen beteiligt. Es gibt keine Person ohne Kommunikation und keine Kommunikation ohne Person.
In der systemischen Theorie etwa von Niklas Luhmann werden dann konsequenterweise Personen völlig entpersonalisiert und entleiblicht. Unter Personen werden Einheiten verstanden, die von einem sozialen System konstruiert werden, das „Verhaltenserwartungen an die betreffenden Einzelmenschen bündelt” (a.a.O., S. 138, s.a. Luhmann 1984). Die Person verliert das Eigene, wird nur noch zum Sammelbecken der Erwartungen anderer. Was nach meinem Verständnis pathologisch ist, wird zum gesunden Zustand der Menschen erklärt. Solche pathologischen Zustände kennen wir von manchen Klient/innen, die darunter leiden, dass sie ihren Sinn für das Eigene verloren haben. Wenn sie sich nur noch als Mülleimer oder „Bündelung” von Erwartungen anderer fühlen, dann ist der Kern der Person, die Meinhaftigkeit (siehe Kap. 2.2.1) verloren gegangen oder zumindest gefährdet.
Da nimmt es nicht wunder, wenn den Gefühlen in diesen Theoriekonstrukten keine oder kaum Aufmerksamkeit geschenkt wird. Bei Niklas Luhmann werden Gefühle als unspezifische „Immunreaktion” verstanden, die auftreten, wenn die sogenannte „Selbstproduktion des Bewusstseins” gefährdet ist. „Die bekannte Vielfalt unterschiedlicher Gefühle (...) kommt erst sekundär, erst durch kognitive und sprachliche Interpretation zustande; sie ist (...), wie aller Komplexitätsaufbau sozialer Systeme, sozial bedingt.” (Luhmann 1984, S. 372) Da müssen schon gewaltige gedankliche Verrenkungen unternommen werden, um die Gefühle vom Leib zu trennen und ausschließlich als eine Funktion sozialer Systeme zu deuten. Ganz gleich, wie systemisch-konstruktivistisch argumentiert und konstruiert wird: Den Unterschied zwischen meiner Trauer und meiner Freude spüre ich – dazu brauche ich keine „kognitive und sprachliche Interpretation”.
Was bei den systemischen Reduktionen verloren geht, ist eine wesentliche Eigenschaft der Leiblichkeit und insbesondere der Gefühle: ihre Intentionalität. Sie haben Bedeutung und sie schaffen Bedeutung. Sie zeigen mir die Richtung meiner Absichten. Wenn ich neugierig auf eine Person bin, habe ich eine andere Haltung ihr gegenüber, als wenn ich sie liebe oder auf sie zornig bin. „Leiblichkeit ist das Medium zur Welt: Meine Empfindungen, meine Sinne, meine Triebregungen und Stimmungen erschließen mir die Welt, etwa als ‚angenehm‘ oder ‚unangenehm‘, als ‚nützlich‘ oder ‚schädlich‘.” (Fuchs 2000b, S. 3)
Wird die Leiblichkeit des Einzelnen vom sozialen Zusammenhang abgetrennt und interessiert nur das pathogene System, wird alles wertfrei. Jedes Verhalten kann dann Sinn machen und positiv bewertet werden. In einem Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung wird als theoretische Grundlage der Methode des „Reframing” (= Umdeuten) formuliert: „Jedes Verhalten macht Sinn, wenn man den Kontext kennt. Es gibt keine vom Kontext losgelösten Eigenschaften einer Person. Jedes Verhalten hat eine sinnvolle Bedeutung für die Kohärenz des Gesamtsystems. Es gibt nur Fähigkeiten. Probleme ergeben sich manchmal daraus, daß Kontext und Fähigkeiten nicht optimal zueinander passen. Jeder scheinbare Nachteil in einem Teil des Systems zeigt sich an anderer Stelle als möglicher Vorteil.” (Schlippe/Schweitzer 1996, S. 179)
Nur „vom System aus” betrachtet mögen diese Aussagen stimmig sein. Doch wir arbeiten mit Menschen, mit lebenden und leidenden Menschen. Wenn eine Klientin vom Vater vergewaltigt wurde, dann mag dieser „scheinbare Nachteil” durchaus ein „möglicher Vorteil” für die Aufrechterhaltung des Familiensystems gewesen sein und dafür „Sinn” gemacht haben. Als leibhaftige Menschen, die in der therapeutischen Praxis anderen leibhaftigen Menschen begegnen, sind wir allerdings empört und parteilich. Wir haben und zeigen Mitgefühl, und das ist uns (und den Klient/innen) wichtiger als jede „Sinnhaftigkeit” für irgendein System. Nur wenn die leiblichen Regungen einer Person mit ihrem sozialen Umraum verknüpft bleiben, ist es möglich, eine Haltung einzunehmen, die an der Seite der Leidenden bleibt und nicht auf einem scheinbar objektiven Beobachter-Standpunkt. Um es noch einmal zu sagen: Ich weiß, dass Therapeut/innen im Rahmen der systemischen Familientherapie würdigende Arbeit machen. Ihnen gilt keine Abgrenzung. Unsere Abgrenzung gilt einem Menschenbild, welches das Leid der Menschen den Systemen gegenüber stellt und Parteilichkeit für die leidenden Menschen zugunsten eines scheinbar „objektiven” Beobachter-Standpunkts verlässt.