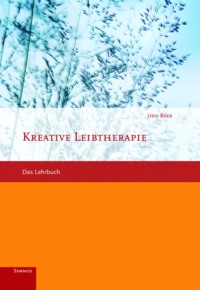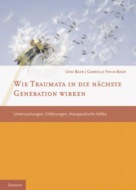Kitabı oku: «Kreative Leibtherapie», sayfa 5
2.2.4 Zeitlichkeit
Dem Erleben wohnt immer eine zeitliche Dimension inne. Es gibt die objektiv messbare Zeit der Stoppuhren und Stempeluhren, der Sekunden, Tage und Jahre. Und es gibt die erlebte Zeit. Eine Stunde oder ein Tag können sich „unendlich dahin ziehen” oder „wie im Flug vorbei” sein. Das Zeiterleben ist eine Qualität der Leiblichkeit und ist verknüpft mit anderen Leibqualitäten: Es ist meinhaft und subjektiv, es pulsiert usw.
Die erlebte Zeit hat darüber hinaus bestimmte Besonderheiten. Zuallererst einmal ist sie gegenwärtig. Wir Menschen spüren uns jetzt und hier. Und wenn wir Vergangenes spüren, dann erleben wir es jetzt, weil es in der Gegenwart für uns von Bedeutung ist. Wenn wir Menschen uns nach etwas sehnen, das in der Zukunft liegt, dann sehnen wir uns jetzt.
Bei vielen Klient/innen ist diese Gegenwärtigkeit des Zeiterlebens gestört. Sie leben und erleben sich, als wären sie in der Vergangenheit, oder sind in all ihrer Lebendigkeit damit beschäftigt, was geschehen soll. Oft hat das die Funktion, von gegenwärtigem Erleben, das unerträglich oder nicht zugänglich ist, abzulenken. Therapeutische Bemühungen werden sich dann zumeist darauf richten, Achtsamkeit für das Erleben im Hier und Jetzt zu fördern. In der „Jetzthaftigkeit” sortiert der Leib aus dem Vergangenen und Zukünftigen aus, was subjektiv von Bedeutung ist. Wir Menschen können einen „objektiven” Lebenslauf mit chronologisch angeordneten Daten und Fakten verfassen, und wir können „subjektiv” erzählen oder aufschreiben, was in unserer Geschichte j e t z t für uns von Bedeutung ist (s. a. Kap. 2.1.7: Intentionalität).
Oft hat vergangenes Erleben Macht über Klient/innen und überlagert das gegenwärtige. Flashbacks traumatischer Erfahrungen führen dazu, dass man Grauenvolles so erlebt, „als wäre es jetzt”. Das Leibgedächtnis, mit dem wir uns noch näher beschäftigen werden, lässt Vergangenes gegenwärtig werden. Das kann ein Fluch sein wie bei traumatischen Erfahrungen oder ein Segen, wenn wir Therapeut/innen es, wie bei Menschen mit Demenzerkrankungen, nutzen, um ihre verschütteten Ressourcen in der Gegenwart wiederzubeleben.
Manchmal überlappen Erinnerungen oder Visionen, z. B. Angstvorstellungen, das gegenwärtige Erleben oder überschwemmen es sogar. Doch das ist nur e i n Phänomen, unter dem Menschen leiden können. Genauso häufig sind Phänomene, dass das Zeiterleben zwangsfokussiert und unter einem bestimmten Gesichtspunkt eingeengt ist. Schuldgefühle z. B. können dazu führen, dass das Erleben der Gegenwart nur noch oder überwiegend von der Vergangenheit bestimmt wird. Alles wird nur noch unter dem Filter der wirklichen oder vermeintlichen Schuld wahrgenommen; das gegenwärtige Handeln wird darauf ausgerichtet, die Schuld zu verbergen oder „ungeschehen” zu machen oder schuldhaftes Geschehen „wieder gut” zu machen.
Oft ist auch das Erleben der Zukunft nicht angebunden an das Jetzt, sondern fast wie abstrahiert von der eigenen Person und dem gegenwärtigen Erleben. Dabei können Menschen sich verlieren, als würde der Faden zwischen Gegenwart und Zukunft zerschnitten. „Zukunft braucht Herkunft”, betitelte Odo Marquard die Veröffentlichung seiner philosophischen Essays (2003). Ich möchte ergänzen: Zukunftgerichtetes Leben und Erleben braucht die Verankerung der Vergangenheit in der Zentralität der Gegenwart. (Zentralität ist eine weitere Qualität des Erlebens, s. Kap. 2.2.6.)
Ein weiterer Aspekt kommt hinzu. Tiere und auch Säuglinge richten sich im unmittelbaren Fluss ihrer Leiblichkeit auf die Zukunft hin. Sie folgen ihren Bedürfnissen und Impulsen. In späteren Jahren erwerben Menschen die Fähigkeit, diesen zukunftsgerichteten Fluss der Leiblichkeit zu unterbrechen. Sie halten inne. Dies kann darin bestehen, dass sie nachdenken, ob der eingeschlagene Weg der richtige und sinnvolle ist. Das Innehalten geht aber über das bloße Denken hinaus. Es kann ein Moment des Spürens sein, z. B., ob das Handeln und die zukunftsgerichteten Impulse wirklich meinhaftig sind. Die Impulse des Innehaltens können auch eher in von außen kommenden Vorwürfen oder Befürchtungen wurzeln. In diesem Innehalten stecken zu bleiben, kann genauso Leiden hervorrufen wie das Fehlen der Fähigkeit, überhaupt innezuhalten.
So entsteht der Doppelcharakter des Erlebens, der – wie in so vielen anderen leiblichen Aspekten – auch im Zeiterleben auftritt.
2.2.5 Pulsieren
„Leben ist Bewegung, kann ohne Bewegung nicht stattfinden.” (Plessner 1975, S. 132) Leiblichkeit ist also immer Prozess, nie starrer Zustand – ist Veränderung, nie Status. Dieser Prozess, diese Bewegung vollzieht sich nicht linear, nicht gradlinig, sondern pulsierend, wie ich es nennen möchte.
Die äußeren Lebensbedingungen eines Menschen sind einem pulsierendem Rhythmus unterworfen: Tag und Nacht wechseln einander ebenso ab wie die Jahreszeiten. In der Biologie des Menschen werden Rhythmen vor allem im Atmen und im Herzschlag spürbar.
Diese äußeren oder biologische Lebensbedingungen sind eng verknüpft mit dem Pulsieren der Leiblichkeit. Wenn es uns friert, legen wir oft die Arme um den Körper und machen uns eng. Wenn die Sonne scheint, recken wir uns ihr entgegen, weiten uns, öffnen uns … Im Atmen ist der körperliche Prozess des Hinein und Hinaus untrennbar verbunden mit der damit verwobenen leiblichen Erfahrung. Wir weiten uns beim Atmen und engen uns wieder ein, so wie wir uns auch in unserem Erleben der Welt öffnen oder uns von ihr zurückziehen.
Menschen sind in ihrem Erleben nie „nur außen” oder „nur innen”, sondern befinden sich in einem pulsierenden Prozess des Engens und Weitens, des Hinein und Hinaus oder sonstiger leiblicher Befindlichkeiten. Herman Schmitz beschreibt dies als Spannung oder Schwellung. Thomas Fuchs redet von der „Dynamik des Leibes” (Fuchs 2000a, S. 104). In der Analyse der räumlichen Qualität des Erlebens sind wir schon der hier beschriebenen Qualität des Pulsierens begegnet. Wenn sich der Mensch in seinem Erleben in einem „Prozess der Vermittlung” zwischen den Polen Leib und Welt bewegt, dann geschieht dies pulsierend: engend und weitend, hinein und hinaus, anspannend und lösend. Wir legen dieses Pulsieren zwischen leiblichen Befindlichkeiten den theoretischen Modellen, der Diagnostik und der therapeutischen Arbeit mit den Raum- und Richtungsleibbewegungen (Kap. 4.3.7) und den Konstitutiven Leibbewegungen (Kap. 4.3.8) zugrunde.
Das Pulsieren vollzieht sich keineswegs in einem stetigen, gleichen Rhythmus, sondern ist unregelmäßig und individuell einzigartig. Ebenso einzigartig ist das Panorama der Störungen und Beeinträchtigungen des Pulsierens. Um die leibliche Qualität des Pulsierens zu wissen, ist deshalb wichtig für die leibtherapeutische Diagnostik jedes einzelnen Menschen.
Menschen mit starker Depression leiden zumeist darunter, dass das Pulsieren nicht mehr gelingt, sondern durch eine „Restriktion”, „ein Erstarren in der Enge des Leibes” (Fuchs 2000b, S. 100), abgelöst wurde. Das leibliche Pulsieren ist in einem eingeengten Zustand erstarrt, aus welchen Gründen auch immer. Die Menschen sind von sich aus nicht in der Lage, ihr Pulsieren wieder in größerem Maße zu reaktivieren, und bedürfen dabei der therapeutischen Hilfe.
In der kreativ-therapeutischen Arbeit bedeutet das Wissen um die erstarrte Engung z. B., solchen Menschen keine großen und freien Bewegungen anzubieten oder kein Malen auf großformatigem Papier vorzuschlagen, denn dazu sind sie aufgrund der Engung zumeist nicht in der Lage. Kleine Bewegungen und kleine Papierformate können eher dem eingeschränkten Maß des Pulsierens entsprechen, damit von dort aus kleine Schritte der Erweiterung beschritten werden können.
Auch an diesem Beispiel wird deutlich, dass ein Verständnis der Qualitäten des Erlebens unmittelbar praktische Relevanz bewirkt. Die kreativen Methoden der Kreativen Leibtherapie können Menschen, die von Einschränkungen des Pulsierens betroffen sind, niedrigschwellige Möglichkeiten bieten, kleine oder große Veränderungen ihres Pulsierens zu erleben. Im Musizieren können verschiedene Rhythmen ausprobiert werden und Klänge „nach innen” oder zu anderen hin geschickt werden. In der künstlerischen Arbeit bieten sich unterschiedlich große Formate an, sich in der Gestaltung Raum zu nehmen oder sich wieder zurückzuziehen. Und im Tanz wird das Pulsieren so spürbar und augenscheinlich, dass man sagen kann: Tanz ist pulsierende Bewegung, Tanzen ist ein Angebot, sich als pulsierender Mensch zu erleben. Bei all dem begegnen die Klient/innen auch den Einschränkungen ihres Pulsierens und den Verletzungserfahrungen, die meist als Ursache dahinter stehen. U n d sie können neue Erfahrungen machen und die leibliche Qualität als pulsierende Menschen erleben.
2.2.6 Zentralität
Im vorherigen Kapitel habe ich das Pulsieren als Qualität der Leiblichkeit beschrieben: „Die Beziehung von Leib und Umwelt ist eine polare: Jeder Pol ist, was er ist, nicht ohne den anderen; und beide sind miteinander vermittelt durch leibliche Richtungen.” (Fuchs 2000a, S. 120) Diese Richtung der Leiblichkeit hat einen Ausgangspunkt, ein Zentrum. Dieses Zentrum ist weder anatomisch zu lokalisieren noch geometrisch zu definieren. Fuchs bezeichnet die „Zentralität des Leibes” (a.a.O.) als „einen (nicht näher lokalisierbaren) ‚Quellpunkt‘, dem die leibliche Dynamik entspringt”, als „ein vitales Zentrum der Person, das zwar nie als solches zur Gegebenheit kommt, aber in allen gerichteten leiblichen Äußerungen erscheint”. (Fuchs 2000a, S. 109)
Eine Klientin, die an den Folgen mehrfacher Traumatisierung litt, war verzweifelt: „Ich verliere mich, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin!” Die Verletzungen, die ihr zugefügt worden waren, hatten sie in ihren Grundfesten erschüttert, ihren Intimen Raum (s. Kap. 4.5.1) verletzt, so dass ihre Selbstsicherheit und Selbstverständlichkeit erschüttert war. Als Kreative Leibtherapeut/innen arbeiten wir mit solchen Klient/innen meist am zentralen Ort, den wir in der leiborientierten Traumatherapie „unzerstörbaren Kern” nennen.
Die Therapeutin bat die Klientin, für kurze Zeit ihrem Atem zu lauschen und ihrem unzerstörbaren Kern nachzuspüren: „Und wenn uns Menschen noch so sehr Schlimmes angetan wurde, wir haben einen unzerstörbaren Kern in uns, dem niemand etwas antun kann, solange wir leben. Ich bin sicher, auch Sie haben ihn und können ihn finden. Dieser Kern erscheint auf keinem Röntgenschirm und Sie finden ihn in keinem Anatomieatlas – aber Sie, und nur Sie, können ihn in sich spüren.”
Die Klientin ging auf die Suche und legte nach einiger Zeit eine Hand auf eine Stelle neben ihrem Herzen.
„Gehen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit auf diese Stelle und schenken Sie Ihrem unzerstörbaren Kern Ihre Achtsamkeit. Wie sieht er aus? Welche Form hat er? ...” Und danach gestaltete die Klientin ihren unzerstörbaren Kern aus Ton. (...)
Helmuth Plessner bezeichnet die Leib-Qualität der Zentralität als „kernig”: „Lebendige Dinge stehen nicht nur im Aspekt eines Kerns, erscheinen ‚vom Kern her‘, sondern sind kernig, kernhaltig. Dieser Kern hat das Ding mit allen seinen Teilen in ihrer Wirkeinheit, er hat die Gestalt mit ihren Eigenschaften, denn er ist (…), weil der Sinn seines Wesens darin liegt, Subjekt des Habens zu sein.” (Plessner 1975, S. 161)
In der Kreativen Leibtherapie arbeiten wir oft an und mit dieser Zentralität bzw. Kernigkeit des Erlebens. Hilfreich ist es, die Klient/innen dabei zu unterstützen und sie zu ermutigen, einen Ort oder Klang der Zentralität in sich zu spüren und ihm einen Ausdruck zu geben: durch ein Bild oder Objekt, eine Bewegung oder einen Klang. Dieser Prozess hilft ihnen, sich die oft verschüttete Zentralität wieder anzueignen und eine Beziehung zu ihr herzustellen.
Die Dynamik, die in der Zentralität des Leibes zum Tragen kommt, wird psychologisch oft als Antrieb beschrieben. Phänomenologisch wird darunter eine „leiblich verankerte Disposition zur Mobilisierung der expansiven Richtungen” (Fuchs 2000a, S. 107) verstanden. Die Zentralität des Leibes ist nicht selbstgenügsam, sondern weist in all ihren leiblichen Regungen über sich hinaus, zu einem Wollen, Können und Handeln.
Dieser Aspekt der Leiblichkeit ist den meisten Menschen selbstverständlich, wobei auch offenbar ist, dass es Menschen mit unterschiedlich ausgeprägtem Antrieb gibt. Manche sind sehr antriebsschwach, andere extrem antriebsstark und vital. Die Bedeutung der dynamischen Qualität der Zentralität des Erlebens wird vor allen Dingen dann deutlich und begegnet uns bei Klient/innen, wenn die Antriebskraft ganz oder nahezu erlischt. Dies ist bei Depressionen oder anderen psychiatrischen Erkrankungen der Fall. Druck oder gutes Zureden und andere sogenannte Motivationsmaßnahmen gehen ins Leere, weil die dynamische Qualität der Zentralität des Leibes eingeschränkt oder erloschen ist. Sie muss wiederbelebt und gestärkt werden, andere Bemühungen gehen ins Leere. Eine andere Ausdrucksweise der Störung dieser leiblichen Qualität besteht darin, dass der Antrieb sich von seinem Quellpunkt löst und verselbstständigt. Menschen sind aktiv, angestrengt, kraftvoll und höchst vital und werden bei extremer Ausprägung als manisch erlebt – ohne zu wissen und vor allem ohne sich sicher zu sein, was sie bewegt, warum und mit welchem Sinn sie all ihre Aktivitäten vollbringen. Hier ist die leibliche Verbindung zum Quellpunkt verloren gegangen, Antrieb und daraus folgende Aktivitäten werden auf Dauer als leer und schal erlebt und ihr Maß geht verloren.
Bei manchen psychischen Störungen gibt es Phänomene der Derealisierung, das heißt, dass die Wirklichkeit der Lebenswelt als unvertraut und teilweise unreal erlebt wird. Dieses Erleben ist Ausdruck der geschwächten oder gar fehlenden Zentralität des Erlebens, denn die Zentralität stiftet den Wirklichkeitsbezug: „Der Leib bleibt daher immer unser Garant für die Wirklichkeit, für die ‚Leibhaftigkeit‘ dessen, was uns begegnet. (…) Was wirklich ist, steht in gegenwärtiger Beziehung zu meinem Leib; er ist das Zentrum aller Orientierung.” (Fuchs 2002, S. 169)
Ein weiterer Aspekt der Zentralität des Leibes ist seine Räumlichkeit. Das Gerichtetsein aus dem Zentrum, das Gerichtetsein im Pulsieren zwischen Leib und Umwelt hat auch eine Dimension des Raumerlebens: Wohin richtet sich mein Wollen und Handeln, welche Richtungen schlage ich ein, aus welcher Richtung erlebe ich andere –von hinten, nach vorn, hoch hinaus oder tief hinunter usw.? Die Zentralität des Leibes wird dabei zumeist nicht wahrgenommen, sondern bleibt im Hintergrund des Erlebens. „Die Perspektivität unserer primären Umweltbeziehung ist Ausdruck der Zentralität des Leibes, auf den zunächst alles Wahrgenommene bezogen ist. (…) Der Leib ist der raumzeitliche Nullpunkt, der Quell- und Zielpunkt aller Wahrnehmungs- und Bewegungsrichtungen. Auch wenn ich ganz in einer Wahrnehmung oder Handlung engagiert bin, bleibt der immer mitgegebene Hintergrund, von dem ich mich nicht lösen kann.” (Fuchs 2000b, S. 65)
2.2.7 Intentionalität
Intentionalität ist ein zentraler Begriff der Phänomenologie, der von Clemens von Brentano und Edmund Husserl eingeführt wurde. Von Husserl über Merleau-Ponty bis zu den aktuellen phänomenologischen Philosophen wie Waldenfels ist die Intentionalität Grundlage des Verständnisses von Leiblichkeit. „Intentionalität ist der Grundbegriff, der in der Phänomenologie aufgekommen ist und auch in die Hermeneutik hineinspielt. Er besagt, dass jedes Erleben sich auf etwas bezieht, indem es dieses in einem bestimmten Sinne meint.” (Waldenfels 2000, S. 367)
Konkret ist gemeint, dass jedes leibliche Handeln, jeder leibliche Impuls mit einer Bedeutung behaftet ist. Intentionalität wird als untrennbarer Bestandteil der Leiblichkeit verstanden.
Nehmen wir ein Beispiel: Sie sitzen am Frühstückstisch und greifen nach Ihrer Tasse Tee oder Kaffee. Dies ist für Sie wie für die meisten Menschen wahrscheinlich ein präreflexiver Vorgang. Sie überlegen nicht, sondern greifen aus dem leiblichen Impuls des Durstes oder des Genussbedürfnisses zur Tasse. Wahrscheinlich bekommen Sie dies gar nicht bewusst mit. Sie unterhalten sich dabei, lesen Zeitung oder dösen vor sich hin. Der Griff zur Tasse während des Frühstücks ist zur Gewohnheit geworden.
In diesem einfachen Vorgang sind viele Trennungen aufgehoben, von denen manche psychologischen Konstrukte und Experimente ausgehen. Es gibt in dem geschilderten Vorgang weder eine bewusste Entscheidung (Sie haben Durst und entscheiden sich deshalb, etwas zu trinken) noch ein daraus entstandenes Wollen (Sie wollen jetzt zur Tasse greifen) oder eine sich dann daraus ergebende motorische Bewegung (Sie strecken Ihren Arm und Ihre Hand aus, greifen um den Tassenhenkel …). Nein, es ist ein fließender, ein in sich stimmiger und ungeteilter Vorgang, die motorische Bewegung ist von ihrem Sinn, von ihren Bedeutungen nicht abgetrennt, sondern in dem Bewegungsimpuls, im Ausstrecken der Hand nach der Kaffeetasse ist die Bedeutung dieser Bewegung enthalten. Das meint Intentionalität.
An dieser Stelle können wir wieder einmal feststellen, dass die Aufspaltungen dieses in sich geschlossenen leiblichen Vorgangs, wie sie manchen naturwissenschaftlich orientierten Konzepten zu Grunde gelegt werden, nicht den Allgemeinzustand menschlicher Leiblichkeit wiedergeben, sondern besondere pathologische Ausnahmen bilden. Wer nach einer Operation seines Armes diesen mühsam wieder zu bewegen lernen muss, braucht die Aufteilung in verschiedene Schritte: Ich möchte etwas trinken … ich muss meinen Arm bewegen, und zwar in diese Richtung und mit dieser Intensität… ich muss mich konzentrieren, die Tasse zu fassen … usw. Im alltäglichen Zustand sind diese Trennungen jedoch aufgehoben.
Die Intentionalität leiblicher Regungen und Bewegungen hat enorme Konsequenzen für die therapeutische Arbeit der Kreativen Leibtherapeut/innen. Wir versuchen der Intentionalität bei störendem und verstörendem Verhalten von Menschen auf die Spur zu kommen. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass jedes Verhalten eines Menschen ursprünglich intentional ist, also einen Sinn hatte. Die Hocherregung und Erstarrung einer traumatisierten Frau hatte ursprünglich eine sinnvolle Schutzfunktion während des traumatischen Ereignisses. Sie hat sich später von der ursprünglichen Sinnhaftigkeit gelöst und führt zu Einschränkungen der Wahlmöglichkeiten des Verhaltens und Lebens. Verstehen können wir sie aber nur in ihrer ursprünglichen Intentionalität.
Oft kann man die ursprüngliche oder wesentliche Intentionalität des als störend oder pathologisch empfundenen und so scheinenden Verhaltens eines Menschen nicht herausfinden. Doch in vielen Fällen und Situationen ist dies der notwendige und wichtige Ansatz und wir Therapeut/innen können gemeinsam mit den Klient/innen dem auf die Spur kommen. Wenn wir unruhigen Kindern begegnen, gehen wir erst auf die Suche und fragen, was sie beunruhigt – und versuchen nicht gleich gegen die Unruhe zu intervenieren. Wenn wir mit einem aggressiven alten Herrn in einem Altenheim arbeiten, bemühen wir uns, die Quelle seiner Aggressivität herauszufinden, die vielleicht in seiner Hilflosigkeit liegen mag. Der Bedeutung und damit dem Sinn als störend empfundenen Verhaltens nachzuforschen, ist Grundlage unserer diagnostischen Einstellung und damit auch unserer therapeutischen Arbeit. Sie entspringt unserem Verständnis von Intentionalität.
Das gilt auch für die Fälle, in denen Impulse leiblicher Regungen und sonstige lebendige Äußerungen eines Menschen abgebremst werden oder stocken. Wenn eine Frau ihren Freund mit ihrer Hand berühren möchte, aber diesen Vorgang aus Angst oder Scham unterbricht, dann wird die Intentionalität ihrer Bewegung nicht in der ausgeführten Bewegung sichtbar, sondern im erstarrten Bewegungsansatz. Solchen zurückgehaltenen und gebremsten Bewegungsimpulsen begegnen wir oft in den Schattenbewegungen, mit denen wir in der Kreativen Leibtherapie, vor allem in der Tanz- und Bewegungstherapie und in der Kreativen Traumatherapie, arbeiten. Unter Schattenbewegungen werden Bewegungen verstanden, die nur im Kleinen oder im Ansatz ausgeführt werden und dem Menschen nicht mehr bewusst sind. Sie können, wenn sie bewusst werden und ohne Stocken fortgeführt werden, wertvolle Hinweise zu gebremsten leiblichen Impulsen geben. Deswegen werden solche Schattenbewegungen von Kreativen Leibtherapeut/innen auch nicht gedeutet, sondern es werden den Klientinnen und Klienten Angebote gemacht, mit diesen Schattenbewegungen selbst zu experimentieren und der in ihnen verborgenen eigenen Intentionalität auf die Spur zu kommen (Frick-Baer 2009).