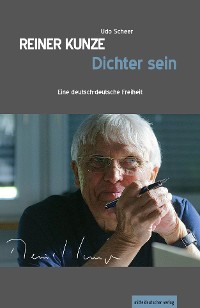Kitabı oku: «Reiner Kunze. Dichter sein», sayfa 4
SPÄTSOMMER
Die menschen ducken sich,
wie die vögel sich ducken in den bäumen
unter einer sonnenfinsternis:
(…)
Und der berg Milešovka, zu dem wir aufbrachen wird sinnlos
Er senkt sich zwischen das wort ich und das wort
liebe und das wort dich,
die ich endlich sage, ohne von der haut zu
sprechen,
und die nun keinen satz ergeben
(…)41
Für das Jahr 1961 vereinbart Reiner Kunze mit dem Verlag „Volk und Welt“ einen Sammelband tschechoslowakischer Lyrikübersetzungen. Das ermöglicht ihm mehrere Arbeitsaufenthalte und das Zusammensein mit Elisabeth. Sie besuchen Ludvík Kundera und fahren zusammen zu dessen Cousin Milan. Sie kommen in Kontakt mit Vladimír Holan, Miroslav Holub, František Hrubín, Jaroslav Seifert, Jan Skácel. Die Zahl seiner Nachdichtungen in den nächsten Jahren beeindruckt. Allein die Titelliste spricht für sich.42
Besonders verbunden fühlt er sich dem Dichter und Erzähler Jan Skácel. Beide spüren die Seelenverwandtschaft in ihrer Dichtung, in ihrem Schweigen, in ihren Leben. Skácel formt Verse, die auch von Reiner Kunze sein könnten, – und die es in der Nachdichtung werden: „Mit einemmal entsann ich mich / wo wir zu hause das salz haben.“43 Skácel dichtet und Kunze überträgt:
KLEINE BAHNHÖFE
Gegenden gibt’s, da winken die kinder den zügen noch.
Immer ist in uns ein hauch von traurigkeit
auf kleinen bahnhöfen,
wo niemand wartet.
Plötzlich ist in uns die weiße seele des holunderbaums,
plötzlich ist in uns zu viel vom menschen.44
Ihre Begegnung ist ein fruchtbringender Glücksfall. Peter Handke schwärmt in seiner Laudatio für den Petrarca-Preisträger Jan Skácel 1989 von der „märchenhaft glücklichen Übersetzung“ durch Reiner Kunze.
Wie Kunze wächst der elf Jahre ältere Skácel in ärmlichen Verhältnissen auf - in einem Dorf in Mähren. Wie Kunze besitzt auch Skácel eine ausgeprägte Sensibilität für die Natur. Während des Zweiten Weltkrieges wird er als Zwangsarbeiter zum Tunnelbau nach Österreich deportiert. Nach dem Krieg studiert Skácel in Brünn, er wird Literaturredakteur beim Rundfunk und von 1963 bis zu ihrem Verbot 1968 bestimmt er als Chefredakteur das Profil der renommierten Literaturzeitschrift Host do domu (Der Gast ins Haus).
Ähnlich wie Reiner Kunze überträgt auch Jan Skácel das Erlebte assoziativ und bildintensiv ins Gedicht. Viele seine Metaphern spielen mit der Naivität und reichen zugleich in das Elementare hinein, in Zeit und Sein, Sprachlosigkeit und Vergängnis.
KINDHEIT
Goldne goldne brücke
Wer hat sie denn zerbrochen
Gegen abend wuschen die mütter uns die füße
heute würde ich dieses wasser trinken
Und wie heftig wir schliefen
(…)45
In seinen Versen verwandeln die Dinge der Natur sich auf überraschende Weise. Da wird die „distel, das königszepter voller blattläuse“ und „im quaken der frösche / grünte die nacht“, oder nach einem lange versprochenen Aufbruch werden die „wolken, naßkalt wie gesprenkelte forellen, / schnellen über unsere köpfe. // Und wir geben diesem wind den namen Jaromír …“. Besorgnis um das Dasein, die Menschen eingeschlossen, macht die Aura der Verse dieses Dichters aus, egal ob sie von Heiterkeit oder von Melancholie getragen sind.
Jan Skácel und Reiner Kunze verbindet lebenslang eine herzliche Freundschaft. In einem seiner langen Briefe schreibt der Brünner Freund: „Wirst Du wieder einmal zu uns kommen? Briefe sind ein zu dünnes eis, sie tragen nicht alles, womit man einen fluss überqueren möchte.“46
Nach 1968 kann Jan Skácel seine Gedichte nur noch im Ausland oder im Samisdat veröffentlichen. Die tschechischen Kulturverhinderer erreichen ihr Ziel. Als er 1989 stirbt, ist er den jüngeren tschechoslowakischen Lesern nahezu unbekannt.
1961 veröffentlicht Reiner Kunze im DDR-Verlag „Volk und Welt“ seinen ersten Band tschechischer und slowakischer Nachdichtungen unter dem Titel Der Wind mit Namen Jaromír nach einer Gedichtzeile Skácels. Dieser kleine Band verschafft ihm Hochachtung unter tschechoslowakischen Kollegen. Ihr Land ist ihm da längst zur Wahlheimat geworden. Durch Elisabeth und die Schriftstellerfreunde findet er nach dem Tiefpunkt Leipzig für sich einen neuen Sinn.
Und er ist herzlich willkommen. Milan Kundera schreibt 1964 in den Literární noviny, Kunze sei der slawischste Deutsche, den er kenne. Welch ein Kompliment! Wann immer er die Möglichkeit erhält, fährt er auf Besuch:
(…)
In den nächten, da das visum abläuft
mit dem ticken meiner uhr,
brechen die alten wunden auf in mir, kreisen die
gedanken, sich formierend
für die rückkehr in die unbewältigte
vergangenheit …
(…)47
Einmal bekommt er einen schweren Asthmaanfall in der schwerst belasteten Luft von Aussig. Er muss ins Krankenhaus, und die Ärzte verlängern den Aufenthalt mit einer mehrwöchigen Krankschreibung über das abgelaufene Visum hinaus. Er dankt ihnen auf seine Weise:
ENTSCHULDIGUNG
(den waschfrauen des bezirkskrankenhauses Aussig
an der Elbe)
Seit mir das chemische konglomerat über der stadt,
physikalisch durchsetzt mit flugasche und
lokomotivenruß
und unlängst vom wochenblatt SEVER gereinigt
geboten
in dem begriff „luft“,
schwarz in der lunge verblieb
(nebst einem schock nebel über der Elbe),
werde ich reichlich beschenkt
mit der weisheit der ärzte, den mühen der
schwestern,
(…)
Das bettuch mit den schlimmen tintenflecken im
haufen der abgezogenen wäsche
ist meines.48
Reiner Kunze nutzt die Aufenthalte für Gespräche, für die Arbeit an Nachdichtungen und als freier Mitarbeiter für tschechoslowakische Literaturzeitschriften:
Wir haben nie geschwätzt. Es ging immer um Literatur, um Übersetzungen, um die einzelnen Texte und um die Frage: Was machen wir? Wie können wir helfen? Es war eine solidarische Gemeinschaft. Und dann erschien „Iwan Denissowitsch“. Die ČSSR war das einzige Ostblockland, in dem dieses Buch von Solschenizyn veröffentlicht wurde. So habe ich es kennengelernt. Inzwischen ging es auch um das Politische. Was wir da alles besprochen haben, Nächte haben wir so verbracht. Manchmal haben wir auch einen Ausflug gemacht, mit Ludvík Kundera, oder wir haben bei ihm lange Abende in seinem Riesengarten gesessen, haben „Špekáčky“, das sind fette, dicke Würstchen, ins Feuer gehalten. Und immer ging es um Literatur oder um die politische Situation.
Was wesentlich ist, und was oft nicht unterschieden wird: In der Opposition der Intellektuellen gab es eine große Gruppe und eine ganz winzige Gruppe. Die große Gruppe begehrte auf gegen den Parteikurs und gegen das Stalinistische, forderte Lockerungen. Da waren sicher auch viele darunter, die westliche Demokratie wollten, aber sie artikulierten es nicht. Wer wirklich ein demokratisches System mit Gewaltenteilung, Mehrparteiensystem, freie Wahlen, soziale Marktwirtschaft forderte, war die winzige Gruppe um Václav Havel und Rio Preisner.
In der DDR habe ich nie differenziert zwischen dieser kleinen Gruppe und den anderen intellektuellen Empörern. Es hätte sie gefährden können.
Eine große Ehre wird Reiner Kunze 1968 zuteil. Der Einmarsch der sowjetischen Besatzungstruppen steht direkt bevor, doch er wird in Prag mit dem Übersetzerpreis des tschechischen Schriftstellerverbandes ausgezeichnet: „Es war allein schon eine unwahrscheinliche Geschichte, dort hinzufahren. In dieser Situation den Preis zu bekommen, war eine beglückende Auszeichnung.“
Kurz darauf wird der Verband aufgelöst, kritische Autoren und Intellektuelle emigrieren oder erhalten Berufsverbot und werden zum Teil als Hilfsarbeiter im Straßenbau oder in der Forstwirtschaft zwangsverpflichtet.
Begonnen hatte alles in Aussig durch jene junge Frau namens Elisabeth. Doch das Hochzeitsversprechen, das das Paar sich gab, ist weit schwerer einzulösen, als sie dachten. Tschechoslowakische Staatsbürger, die einen Ausländer heiraten wollen, benötigen die Einwilligung des Innenministers. Und die scheint auch in ihrem Fall aussichtslos. Elisabeth Kunze erzählt:
Wie oft bin ich nach Prag gefahren. Am Eingang des Ministeriums befand sich eine kleine Telefonzelle. Weiter durfte man nicht hinein. Von dort aus musste man anrufen und seinen Namen nennen. Dann kam die Antwort: „Nein, ist nicht erledigt.“
Geholfen hat uns, dass mein Mann Nachdichtungen machte, die er in der DDR als kleines Bändchen herausbrachte. Dieses Büchlein hat er an den tschechischen Schriftstellerverband geschickt und gebeten, ob sie sich nicht dafür einsetzen könnten, dass wir heiraten dürfen.
Zuvor hatte Reiner Kunze sich an die zuständigen Stellen der DDR, selbst an Ministerpräsident Otto Grotewohl gewandt. Erfolglos. Den glücklichen Ausgang ergänzt er so:
Im tschechischen Schriftstellerverband witterte man einen Nachdichter tschechischer Poesie. Das Büchlein in der Hand intervenierten sie beim tschechischen Kulturminister und erklärten, dass unsere Heirat im nationalen Interesse liege. Eines Tages kam mit unscheinbarer Post die Heiratserlaubnis. So wurde meine Frau mein erster und kostbarster Literaturpreis. 49
Im Sommer 1961 können Elisabeth und Reiner Kunze endlich in Aussig ihre Hochzeit feiern. Wie viel sie einander bedeuten, erzählen
DIE GROSSEN SPAZIERGÄNGE:
Die großen Spaziergänge, auf denen wir
nicht ins leere greifen
Immer geht die hand des anderen mit50
Hier, spricht die Gewissheit, finden und verbinden zwei sich auf ein Leben. Dennoch müssen sie noch fast ein Jahr warten, bis Elisabeth Kunze die Ausreisegenehmigung in die DDR erhält.
Bisher ist Elisabeths Tochter Marcela die meiste Zeit bei den Großeltern in Znaim aufgewachsen. Der Schichtdienst im Krankenhaus lässt keine andere Möglichkeit für ihr kleines Kind. Als Marcela auf die Welt kommt, ist ihre Mutter noch Studentin. Der Vater trennt sich vor der Geburt.
Beim ersten Besuch beugt Reiner Kunze sich zu ihr hinab und sagt: „Du bist aber groß geworden!“ Sie ist dreieinhalb und stolz: Das ist ihr Vater. Sie lassen sie in dem Glauben, bis sie zwölf ist. Da entdeckt Marcela in Vögel über dem Tau eine Widmung „Für Elisabeth Littnerová“. Als die Mutter von der Arbeit kommt, ist das Mädchen verstört. Beide setzen sich auf den Boden mit dem Rücken an den Kachelofen und Elisabeth erzählt ihr Leben. Danach ist alles gut.
Auch die Briefe, die wir schweigen,
werden durchleuchtet
Als Schriftsteller will Reiner Kunze dort leben, wo man seine Sprache spricht. Auch Elisabeth, durch Erziehung und Sprache dem Deutschen verbunden, möchte den Umzug der Familie in die DDR.
Im Juni 1962, elf Monate nach ihrem Antrag, nach zahllosen Briefen, Nachfragen in Prag, nach diskriminierendem Warten erhält sie die Ausreisegenehmigung aus der ČSSR für sich und Marcela.
Reiner Kunze sucht einen Lebensraum zum Arbeiten außerhalb der Zentren. Intrigen und existenzielle Erschütterungen wie an der Universität Leipzig will er sich nicht noch einmal aussetzen. Als Kind war er notgedrungen ein Einzelgänger. Als Dichter bleibt er es bewusst, wenn auch mit vielen Freunden, aber er wird nie einer Gruppe angehören. Er sucht einen Ort, der ihm den Rückzug auf sich und seine Arbeit erlaubt.
Die kleine, abgelegene Residenz- und Textilstadt Greiz im thüringischen Vogtland scheint ihm gute Voraussetzungen zu bieten. Die dünn besiedelte Landschaft der Umgebung, die bewaldeten Höhenzüge, die Hangwiesen und die weiten Hochebenen erinnern ihn an die Gegend seiner Kindheit im Erzgebirgsbecken.
Die Dreißigtausend-Einwohner-Stadt fernab der großen Städte wirkt wie verwunschen mit ihren grauen Häuserreihen, mit ihren Bürgerhäusern und hangwärts darüber den Textilarbeiterkaten, mit dem maroden Oberen Schloss auf dem mächtigen Felsen mitten in der Stadt. Im Kontrast dazu stehen das schmucke Untere Schloss in der Innenstadt, die helle Häuserzeile am Ufer der Weißen Elster mit ihren gepflegten Jugendstilfassaden und der große, gepflegte Landschaftspark um das Sommerpalais. Sie künden von vergangenen besseren Zeiten.
Elisabeth Kunze findet eine Anstellung als Kieferorthopädin in der Kreisjugendzahnklinik und als Kieferchirurgin im Kreiskrankenhaus. Ihr durchaus nicht üppiges Arzteinkommen in der DDR reicht zur bescheidenen Sicherung des Familienunterhalts. Auf dem Hainberg über der Stadt bekommen sie in einem dreistöckigen Wohnblock aus den fünfziger Jahren eine Drei-Raumwohnung zugewiesen, mit Bad, Küche, Kinderzimmer und mit je einem Raum, eigentlich Wohn- und Schlafzimmer, den der Dichter sich als Arbeitszimmer und die Ärztin sich als Arbeits- und Schlafraum einrichten. Für DDR-Verhältnisse ist diese Wohnung mit rund siebzig Quadratmetern für eine dreiköpfigen Familie vergleichsweise großzügig bemessen.
Das ist ihr Neuanfang, und der Dichter begrüßt Greiz mit einer ausgelassenen Verbeugung:
FISCHRITT AM NEUJAHRSMORGEN
Stadt, schlüpfrige, halt still
Ah, jetzt erkenn ich’s, du
bist ein fisch
He, ich balanciere auf dem rücken eines
fisches
Dächer, sagt ihr, nüchtern gebliebene, das
sind silberne schuppen
Jaja, ein märchenfisch, das schloß
trägt er wie eine krone
Ein verzauberter prinz, ein
Reuß, ein
debiler
Schon gut, wir werden schlafen
und zu mittag
wird er wieder eine
stadt sein51
In Greiz sucht Reiner Kunze die notwendige Ruhe für seine Arbeit. Geistig und seelisch zu Hause ist er in der Tschechoslowakei.
Er arbeitet an Übersetzungen, findet damit Lob und Freunde im Nachbarland. Für den Mitteldeutschen Verlag stellt er mit Aber die Nachtigall jubelt. Heitere Texte einen neuen eigenen Band zusammen. Bis 1963 erreicht der drei Auflagen. Wobei eine Auflage in einem Literaturverlag der DDR gewöhnlich nicht unter zehntausend Exemplaren liegt. Für 1963 genehmigt ihm das Büro für Urheberrechte, die Institution, die Veröffentlichungen überwacht und Auslandshonorare den staatlichen Deviseneinnahmen zuführt, seinen Band Widmungen im Bad Godesberger Hohwacht Verlag. Die Genehmigung wird problemlos erteilt, da für den Band in der DDR bereits veröffentlichte Gedichte vorgesehen sind. Lyrik, die Reiner Kunze seit den Widmungen veröffentlicht, betrachtet er für sich als gültig. Die Neue Zeit, die Zeitung der DDR-CDU, die bisweilen SED-Informationspolitik mit mehr Offenheit unterläuft, gibt ihren Lesern eine Ahnung von Kunzes Westresonanz:
Man würdigte Reiner Kunze als eine der wichtigsten Begabungen der jungen DDR-Literatur. Die Schweizer Zeitung Baseler Nachrichten stellt ihn westlichen Autoren gegenüber und kommt zu dem Schluß, daß sein Gedichtband „Widmungen“ zukunftsweisend ist, da er „jeden Fortschritt, der durch die heutige Sachlichkeit und Wachheit des Dichters möglich wird, nutzt“.52
1964 freut sich Reiner Kunze besonders über Věnování (Widmungen), seinen ersten Lyrikband auf Tschechisch. Dieser Band ist für ihn ein großes Zeichen der Anerkennung. Unter den vier Übersetzern sind keine Geringeren als Ludvík und Milan Kundera.
Im selben Jahr telegrafiert ihm Ludvík Kundera: + DIE ÜBERSETZUNG DER NEUGIER IST GLÄNZEND HERVORRAGEND KOLOSSAL ICH AUTORISIERE SIE GRATULIERE UND DANKE BRIEF FOLGT = LUDVIK +. Reiner Kunze hatte sein Hörspiel Neugier übertragen. Es erscheint 1966 im Bärenreiter Verlag Kassel.
Reiner Kunzes Arbeitsbeziehungen in die Tschechoslowakei tragen immer mehr Früchte. Im Jahr 1964 bringt der Hohwacht Verlag in Bad Godesberg Die Tür, einen Sammelband tschechoslowakischer Lyrik heraus, den Reiner Kunze ebenfalls besorgt hat. Zusammen mit acht darin vertretenen tschechischen und slowakischen Lyrikern wird er zu einer Lesereise nach Bad Godesberg, Bonn, Köln, Essen, Düsseldorf, München eingeladen.
Der Geheime Informant „Hannes“ berichtet seinem MfS-Führungsoffizier, mit Kunze sei wegen seiner Einladung eine Aussprache im DSV, dem Schriftstellerverband der DDR, erfolgt. „Während dieser Aussprache teilte man ihm in nicht überzeugender Weise mit, daß er nicht nach Westdeutschland reisen darf. Als Grund nannte man ihm, daß die Einladung nicht über den DSV gegangen sei.“53
Reiner Kunze darf dennoch reisen. Das Ministerium für Kultur erteilt vermutlich auf die Bitte tschechischer Genossen die Erlaubnis.
Im Frühjahr 1965 führt das Kleist-Theater in Frankfurt/Oder Milan Kunderas Schauspiel Die Schlüsselbesitzer auf, ein Stück über Anpassung und Gehorsam, das Kundera im Nationalsozialismus spielen lässt. Eine Rezension lobt die deutsche Übersetzung von B. K. Becher und Reiner Kunze als „sprachlich eindringlich, nicht ohne Poesie“.54
Um in der DDR den Beruf eines Schriftsteller ausüben zu dürfen, benötigt man eine Steuernummer. Voraussetzung dafür ist die Mitgliedschaft im Schriftstellerverband der DDR. Seit seinem Umzug nach Greiz ist Reiner Kunze Mitglied im Verband Erfurt/Gera. Er nimmt an den Verbandstagungen teil, betrachtet die Veranstaltungen aber als Pflichttermine und hält Distanz zu den regionalen Autorengrößen mit ihrer herausgekehrten Parteilichkeit. Gelegentlich macht er sich Notizen. Allein schon das befremdet. Für diese Kollegen ist er ein Eigenbrötler, für manche auch ein Abweichler, der sich etwas Besseres dünkt. Den einzigen engeren Kontakt, der zu einer Freundschaft wird, hält er zu dem nahezu gleichaltrigen Weimarer Lyriker Wulf Kirsten, der seine Themen in der Natur und Landschaft findet.
So verlaufen im Wesentlichen die Jahre 1962, 1963, 1964. Reiner Kunze steht nicht im Fokus der Staatssicherheit, auch wenn sie routinemäßig, wie von allen Personen im öffentlichen Leben, Rasterinformationen sammelt. In einer späteren Analyse vermerkt die für Strafermittlung zuständige Hauptabteilung IX für das Jahr 1962 nur: „Kunze schreibt für die ‚Schublade‘ antidogmatische Gedichte.“55
1964 versucht die Staatssicherheit, ihn als Inoffiziellen Mitarbeiter anzuwerben. Auch das ist nicht außergewöhnlich. Kritische Köpfe sollen dem Sicherheitsdienst der Schlüssel zu ihren Kreisen sein. Reiner Kunze sagt dazu:
Das war 64. Da kamen eine Frau und ein Mann in unsere Wohnung und wollten mich direkt werben. Als das Gespräch begann, machte die Frau den Reißverschluss ihrer Tasche zu. Da wusste ich, aha, jetzt hat sie das Aufnahmegerät eingeschaltet. Es war aber nicht der erste Werbungsversuch. Während des Studiums hatten sie es schon einmal versucht. Da wurden wir alle vorgeladen und sie haben ihre Leute rausgesucht. Ich sagte, dass ich das nicht machen möchte, weil ich Schriftsteller bin. Das habe ich ehrlich gemeint.
Andere haben ja gesagt. Auch einer, der ein großartiger Kerl war. Später sagte er mir einmal in der Straßenbahn: „Reiner sei froh, dass du da nicht zugesagt hast. Mein Leben besteht darin, früh morgens in mein Büro zu fahren. Dazu muss ich dreimal die Straßenbahn wechseln, damit niemand sieht, wohin ich fahre. Und dann sitze ich von früh bis Abend, lese Westpresse und muss Berichte schreiben, was da drin steht. Das ist kein Leben.“
Nach dem Hausbesuch in Greiz erzählt Reiner Kunze im Bekanntenkreis von dem unsittlichen Ansinnen. Daraufhin trägt der Geheime Informant „Hannes“ weiter, „daß vor einiger Zeit zwei Genossen des MfS bei ihm gewesen wären. Diese wollten ihn für die Zusammenarbeit gewinnen …“56
Mit dieser Dekonspiration ist der Kandidat „verbrannt“. Die Staatssicherheit schließt die Anwerbeakte und vermerkt:
Kunze wurde 1964 im Rahmen der analytischen Arbeit unter den Künstlern des Bezirkes Gera überprüft. Die Überprüfung des K. erfolgte mit dem Ziel, seine Verbindungen zu Schriftstellern sowie nach der BRD und Westberlin operativ zu nutzen. Eine Aussprache mit ihm ergab jedoch, daß er für die inoffizielle Zusammenarbeit ungeeignet ist. 57
Anfang der sechziger Jahre findet man in der DDR-Presse gelegentlich kleine Meldungen über Reiner Kunze, über seine Veröffentlichungen, über Anthologien, an denen er beteiligt ist, über Lesungen und Lesereisen. Er wird in einem Atemzug genannt mit Christa Wolf, Erwin Strittmatter, Volker Braun, Günter Kunert und Brigitte Reimann.
Brigitte Reimann und Reiner Kunze hatten sich 1954 in seiner Magdeburger Redakteurszeit während des Studiums kennengelernt. Beide besuchten die Arbeitsgemeinschaft „Junger Autoren“ und Reiner Kunze sagt:
Das meiste, was da „Junger Autor“ hieß, war indiskutabel. Aber Brigitte war klasse. Sie war von uns allen die Begabteste. Wir waren wirklich sehr gute Freunde.
Brigitte Reimanns Roman Ankunft im Alltag (1961) gibt der neuen Autorengeneration und ihrer „Ankunftsliteratur“ den Namen. Nach den Aufbaujahren mit dem Resultat Mauerbau prüfen und hinterfragen diese Autoren, wenn auch vorsichtig, allgegenwärtige Fortschrittsparolen, konfrontieren den sozialistischen Anspruch mit der Wirklichkeit und suchen literarisch nach neuen Lösungen.
In der Lyrik sorgt Reiner Kunze mit jenen Gedichten für Aufsehen, die davon künden: Der Einzelne macht Sinn. Damit setzt er sich hinweg über das verordnete „Wir“. Im Mittelpunkt steht für ihn nach seinen Lehrjahren in Leipzig das Individuum, der einzelne Mensch, nicht das kollektive anonyme Wesen.
Ethik
Im mittelpunkt steht
der mensch
Nicht
der einzelne58
Diese Ironie wird von den Vordenkern einer „sozialistischen Menschengemeinschaft“ und ihren Ideologiewächtern sehr genau verstanden. Kunzes lyrisches Plädoyer für die Anerkennung des Einzelnen mit seinen Erfahrungen stört. Die Dogmatiker wissen um die Brisanz von Literatur und Lyrik, die sich ihren Vorgaben entzieht, die sich verselbstständigt, die von ihren Lesern auch zwischen den Zeilen entziffert wird.
Es sind keineswegs so ruhige Jahre einer schöpferischen Normalität, wie es den oberflächlichen Anschein hat. Reiner Kunze sagt im Rückblick:
Gerungen haben wir immer, auch wenn das nicht an die Öffentlichkeit kam. Und nachdem ich eine wesentlich freiheitlichere und intellektuellere ČSSR erlebt hatte, war die DDR für mich schon ziemlich finster.
Eine Ahnung, welche Spannungen Anfang der sechziger Jahre unterhalb der öffentlichen Wahrnehmung herrschen, bekommt man, wenn man einige Briefe an Reiner Kunze liest. Etwa wenn Reiner Kunzes erste Frau ihm von einem Chorkonzert in Leipzig berichtet: „Die Plakate trugen alle Deine Titel, aber nicht Deinen Namen.“59
Ludvík Kundera schreibt ihm, er habe an einem Kolloquium des DDR-Schriftstellerverbandes teilgenommen und nach dem Hauptreferat des stellvertretenden Vorsitzenden Prof. Dr. Hans Koch vier Fragen gestellt. Darunter auch die:
… warum Kunert und Kunze im Hintergrund gehalten werden? Ich dachte, es würde ein Ausgangspunkt zu einem Gespräch werden, aber das Kolloquium verlief weiter so, daß die Leute zum Rednerpult mit mehr oder weniger improvisierten Referaten kamen. Eine Antwort erhielt ich erst am 5., d. h. am letzten Tag, sehr lückenhaft und auf Dinge, die ich nicht gefragt hatte.60
Das ist tschechischer Humor. Tatsächlich wird Kundera abgekanzelt, er sei kein Mitglied des DDR-Verbandes, also habe er kein Recht zur Einmischung.
Etwas braut sich zusammen. Reiner Kunze wird inzwischen nicht nur als Schriftsteller in seiner öffentlichen Wahrnehmung beschnitten, er muss auch feststellen, dass seine Briefe auf dem Index der Postkontrolleure stehen. Im Zusammenhang mit dem tschechischen Sammelband Die Tür schreibt sein Bad Godesberger Verleger:
Sehr geehrter Herr Kunze, vielen Dank für Ihren letzten Brief, dem ich entnehmen muß, daß Sie auch mein letztes Schreiben nicht erhalten haben. Mit ihm hatte ich Ihnen mitgeteilt – ebenfalls handschriftlich (!) – daß ich bereits Nachforschungen durch die Post nach dem verlorenen Einschreiben habe anstellen lassen. 61
Etwas später steht Reiner Kunze mit dem Merlin-Verlag Hamburg im Briefwechsel, auch zu Übersetzungen aus dem Tschechischen. Der Verleger fragt:
Lieber Herr Kunze, wie ich schon in meinem Telegramm zum Ausdruck zu bringen versuchte, … ein Brief – obwohl Eilbote – scheint verloren zu sein. Der 2. Gibt das zu denken? 62
Nachforschungsaufträge bei der Deutschen Bundespost und bei der Deutschen Post der DDR bleiben ohne Erfolg. Manuskripte, Korrekturfahnen, selbst handschriftliche Briefe von und an die Adresse 66 Greiz, Franz-Feustel-Straße 10 erreichen ihr Ziel nicht. Der Dichter konstatiert:
Brief du
zweimillimeteröffnung
der tür zur welt du
geöffnete öffnung du
lichtschein,
durchleuchtet, du
bist angekommen63
Überhaupt anzukommen, manchmal mit wochenlanger Verspätung, ist ein Moment der Freude für den Empfänger und tiefer Herzlichkeit für das „du“. Denn er sieht, wie, um welchen Preis der Brief seinen Adressaten fand: Geöffnet, geschändet, seiner Intimität beraubt. Die Freude ist eine bittere Freude.
Das längste Einschreiben ist 56 Tage unterwegs. Mehrfach wird das Datum des Poststempels unkenntlich gemacht. Wiederholt kommen Briefe exakt einen Tag nach Verstreichen eines Termins an. In ihrer Akribie vermerken die Postkontrolleure im März 1976 einen Zwischenstand über „bisher analysierte Briefe“:
| Insgesamt: | 377 |
| Davon | |
| BRD: | 194 |
| WB (Westberlin): | 22 |
| NSA (Nichtsozialistisches Ausland): | 67 |
| SA (Sozialistisches Ausland): | 9464 |
Es gibt Post, die liest ihr Empfänger zum ersten Mal bei der Einsicht in seine Stasi-Akten. Das Netz um Reiner Kunze wird enger. Die Augen der Macht nehmen ihn zunehmend in ihren Blick.
Im August 1964 kündigt der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Schriftstellerverbandes der DDR und Volkskammerabgeordnete Prof. Dr. Hans Koch sein Kommen beim Schriftstellerverband Erfurt/Gera an. Sein Auftritt ist Teil einer Parteikampagne zur Disziplinierung der Kulturschaffenden und Schriftsteller. In Weimar greift er vor allem Reiner Kunze an. Sein Gedichtband Widmungen, genauer die Aufmerksamkeit, die dieser in der Bundesrepublik erfährt, ist den Funktionären ein Ärgernis. Gereizt führt der Gast aus Berlin den Artikel aus der „Westpresse“ an: „Ein Dichter der Zone meldet sich zu Wort“, der Kunzes Verszeile „Die Jugend schläft nicht“ Applaus spende.65 Es folgen Vorwürfe und deutlichen Warnungen: Kunzes Gedichte seien nicht parteilich, sein Individualismus nicht tragbar, seine Veröffentlichungen beim Klassengegner führten ihn auf eine gefährliche Bahn. Noch ist er keine Unperson, doch Distanz scheint den meisten Verbandskollegen ratsam. Kunze ist gewarnt.
Aber noch hat und nutzt er Möglichkeiten, seine Position gegen die dominierende Kunstauffassung zur Diskussion zu stellen. In der Zeitschrift Neue Deutsche Literatur schreibt er 1965:
Das Höchste, das eine kritische Meinung bewirken kann, ist, zum Maßstab hinzuführen; denn die Poesie, der die Maßstäbe verloren gehen, ist verloren.
Liest sich dieser erste Satz noch wie ein allgemeiner Appell, wird er im weiteren Text so deutlich, dass die Veröffentlichung überrascht:
Deshalb kann keine Meinung den Anspruch erheben, von absoluter Gültigkeit zu sein. (…) Man kann jedoch eine Art öffentliche Nötigung ausüben, indem man eine bestimmte Meinung als „Massenmeinung“ oder Meinung des Volkes deklariert (was natürlich eine Fiktion ist, denn das Verhältnis zur Poesie ist ein zutiefst individuelles Verhältnis.) (…) Manchem, der glaubt, über Poesie den Stab brechen zu dürfen, sollte zumindest die Hand ein wenig zittern. 66
Auf die Frage, ob das vielleicht seine vorweggenommene Antwort auf das 11. Plenum des ZK im Dezember gewesen sei, meint Reiner Kunze schmunzelnd: „Das war Gottes Voraussicht.“
Die Forderung nach weniger ideologischer Gängelung, nach mehr Realismus und künstlerischen Freiräumen, findet Anfang der Sechziger breiten Konsens. Autoren, Filmemacher, Theaterleute, Bildende Künstler versuchen, sich aus dem engen Kulturkorsett zu lösen. Sie fühlen sich bestätigt, seit Walter Ulbricht auf der II. Bitterfelder Konferenz 1964 einräumen musste, dass „das Ringen um eine höhere Qualität“ in der Kunst „neue Normen“67 erfordere. Um so überraschender trifft sie das 11. Plenum des Zentralkomitees der SED vom 15. bis 18. Dezember 1965 in Berlin.
Eigentlich sollte es einberufen werden, um den Einfluss der Partei auf die Wirtschaft neu zu bestimmen. Denn das zwei Jahre zuvor begonnene Experiment des „Neuen Ökonomischen Systems der Planung und Leitung“, das den Betrieben im Ansatz marktwirtschaftliche Freiheiten zugestand, offenbart den Wirtschaftsfunktionären zugleich: In dem Maße, in dem die Wirtschaft sich verselbstständigt, die Betriebe erfolgreich eigenverantwortlich handeln, gefährdet das ihre Führungsrolle, machen sie sich perspektivisch überflüssig.
Doch noch wichtiger als eine Kurskorrektur in der Wirtschaft ist der SED-Führung Ende 1965 die Kurskorrektur in der Kultur. Nach einer vergleichsweise liberalen Kulturpolitik seit Anfang der sechziger Jahre sehen die Ideologiewächter sich alarmiert einer Kulturfront gegenüber, die droht, außer Kontrolle zu geraten. Auf ihren Schreibtischen landen Analysen über „ideologische Aufweichungserscheinungen“, über „Zweifel an der Richtigkeit der Politik der Partei“, „Nihilismus“, „Skeptizismus und bürgerliche Ideologien“ unter den „Kulturschaffenden“.
Mit dem 11. Plenum holt die Führung zum Rundumschlag aus. Zwölf DEFA-Filme, das ist fast die ganze Jahresproduktion, werden verboten. Der wohl bekannteste Fall ist der Spielfilm Das Kaninchen bin ich, der sich kritisch mit der politischen Strafjustiz und einem karrieristischen Richter auseinandersetzt. Selbst die Verfilmung von Erik Neutschs Roman Spur der Steine läuft nur drei Tage in wenigen ausgewählten Kinos. Erich Honecker fordert eine „saubere Leinwand“ und bekommt sie. Günter Witt, Leiter der Hauptverwaltung Film, wird geschasst. Er nennt das 11. Plenum „Inquisition“.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.