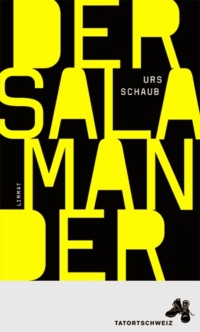Kitabı oku: «Der Salamander», sayfa 3
DREI
Es war wie verhext. Am anderen Morgen erwachte Tanner wieder kurz vor sechs. Diesmal ohne Telefonanruf. Auf jeden Fall durch keinen realen. Er hatte noch unter der Dusche das vage Gefühl, dass er geträumt habe, Bodmer habe schon wieder angerufen und er deswegen um die gleiche Uhrzeit aufgewacht sei. Aber nach der Dusche war alles in seiner Erinnerung verblasst, und er wusste nicht mehr, ob er sich das bloß eingebildet hatte oder ob es wirklich ein Traum gewesen war.
Draußen herrschte noch tiefschwarze Nacht. Kein Mond und keine Sterne. Fröstelnd stand Tanner für einen Augenblick am offenen Fenster und zog die nasskalte Luft durch die Nase tief in seine Lunge. Immerhin klärte sich dadurch sein Kopf ein wenig. Plötzlich hatte er das Gefühl, er müsse irgendetwas tun, und sei es auch nur, die monatelang verwaiste Wohnung zu putzen. Er holte tief Atem und entschloss sich zu einer ausführlichen Putzaktion seiner nun monatelang verwaisten Wohnung. Gegen Mittag durchschritt er stolz und zufrieden sein auf Hochglanz poliertes Reich, und dachte, dass er jetzt wirklich angekommen sei. Das Reinigungsritual hatte ihn irgendwie erneut mit diesem Ort geerdet. Wie auf Verabredung klingelte in diesem Augenblick die Hausglocke.
Beschwingt trabte er hinunter, nahm zwei Stufen aufs Mal, und schloss die schwere Haustür auf.
Draußen stand, bibbernd vor Kälte, Jean D’Arcy. Immer noch bloß mit diesem dünnen grauen Anzug bekleidet. Den Koffer hielt er in der Hand.
Er hob linkisch die freie Hand zum Gruß und lächelte.
Guten Tag, Herr Tanner. Entschuldigen Sie bitte vielmals, äh … die Stör…
Tanner fasste ihn kurzerhand am Arm und unterbrach ihn.
Wissen Sie was? Sie kommen jetzt erst mal rein an die Wärme. Entschuldigen können Sie sich immer noch.
D’Arcy nickte und trat bereitwillig ins Haus. Tanner schloss die Tür und ging die Treppe hoch.
Kommen Sie. Ich gehe vor.
Setzen Sie sich einfach ins Wohnzimmer, ich mache uns einen Kaffee.
Als Tanner ins Wohnzimmer kam, saß D’Arcy am Tisch. Den Koffer hatte er am Boden zwischen die Beine gestellt.
Hier. Bitte bedienen Sie sich.
D’Arcy nahm Zucker und Milch. Seine Hand zitterte leicht. Dann atmete er mit geschlossenen Augen den Duft des Kaffees ein. Trank aber nicht.
Ja, äh … was ich sagen … ich meine, ähm … was ich Sie fragen wollte … es ist eine, äh … große Bitte.
D’Arcy blickte kurz zum Fenster und fuhr sich fahrig durch die blonden Haare.
Also, äh … vielleicht ist es schwer zu verstehen, aber …
Lieber Herr D’Arcy, sagen Sie mir einfach, was ich für Sie tun kann. Wenn es in meiner Macht steht, werde ich es tun.
D’Arcy blickte ihn mit großen Augen an.
Sie sind sehr liebenswürdig. Es tut mir leid, dass ich Sie störe, Sie haben sicher viel zu tun und äh …
Tanner fuhr mit der Hand durch die Luft.
Machen Sie sich keine Sorgen. Also, was kann ich für Sie tun?
D’Arcy griff unter den Tisch und brachte den Koffer zum Vorschein.
Darf ich Sie bitten, diesen, äh … Koffer für mich aufzubewahren? Es ist nur für ein paar Tage. Natürlich nur, ähm … wenn es Ihnen nichts ausmacht.
Tanner stand auf und wollte nach dem Koffer greifen. D’Arcy hielt ihn aber noch zurück.
Ich will Ihnen noch sagen, äh … dass in dem Koffer nichts ist, was äh … irgendwie illegal ist, verstehen Sie. Das schwöre ich bei meinem Leben. Und ich hoffe, Sie können mir glauben. Es ist etwas, was mir persönlich sehr wertvoll ist, aber ohne, ähm … materiellen Wert.
Dann überreichte er den Koffer. Tanner nahm ihn. Er war überraschend leicht.
Gut, ich glaube Ihnen. Wissen Sie was, D’Arcy? Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wo ich ihn aufbewahre. Nur für alle Fälle.
Tanner ging in eines der praktisch leeren Zimmer seiner großen Wohnung. Es war ein relativ schmaler Raum mit nur einem Fenster zur Straße hin. Auf der einen Längsseite bestand das Zimmer aus lauter eingebauten Wandschränken mit massiven Türen. Er öffnete einen der Schränke, stellte den Koffer hinein und schloss den Schrank. Den Schlüssel nahm er ab und bot ihn D’Arcy an.
Schauen Sie, D’Arcy. All diese Schränke sind leer. Ich brauche den Schrank nicht. Nehmen Sie den Schlüssel mit. Wenn Sie den Koffer holen, müssen Sie allerdings den Schlüssel wieder mitbringen.
D’Arcy nahm den Schlüssel mit beiden Händen entgegen, als empfange er eine heilige Reliquie.
Das ist sehr großzügig von Ihnen, Herr Tanner. Sie können sich nicht vorstellen, ähm … wie froh ich bin, ja, wie erleichtert und froh.
Sie setzten sich beide wieder an den Tisch, und D’Arcy rührte erneut in seinem Kaffee, trank aber nicht. Er sah dabei gedankenverloren zum Fenster hinaus.
Tanner räusperte sich.
Haben Sie Familie, Herr D’Arcy? Ich meine, haben Sie jemanden, zu dem Sie gehen können?
Er lächelte.
Ja, wissen Sie, an Familie herrscht an sich kein Mangel. Im Gegenteil.
Jetzt lachte er gequält.
Die gibts sogar im Überfluss, aber äh …, die haben mich schon länger abgeschrieben, wissen Sie.
Weil Sie im Gefängnis waren?
Nein, nein, das hat andere Gründe.
Er nahm den Kaffeelöffel in den Mund. Dann hielt er ihn wie einen kleinen Spiegel in Augenhöhe, als wolle er sein Gesicht darin beobachten.
Das hängt eher mit meiner, ähm … Lebenseinstellung zusammen. Zudem ist meine, äh … ganze Familie sehr katholisch, und ich – ich habe mich seit einiger Zeit davon losgesagt.
Tanner nickte.
Aha, ich verstehe.
D’Arcy hob jetzt die Tasse mit beiden Händen an seine Lippen und trank sie in einem Zug leer. Tanner blickte auf seine Uhr.
Herr D’Arcy, darf ich Sie zu einer kleinen Spazierfahrt einladen? Ich war seit über einem Jahr weg und hätte große Lust, ein bisschen übers Land zu fahren. Zudem will ich wissen, ob mein Auto überhaupt noch fährt.
D’Arcy lächelte und machte wieder diese Andeutung einer Verbeugung.
Ja, gut. Ich komme gerne mit. Das ist sehr liebenswürdig von Ihnen. An dem Ort, von dem ich komme, habe ich oft davon geträumt, einfach übers Land zu fahren ohne Ziel und ohne Zeitdruck.
Tanner nickte ernst.
Diese Sehnsucht kann ich gut verstehen. Übrigens habe ich da noch einen sehr guten Mantel. Den können Sie sich gerne ausleihen, nicht dass Sie noch erfrieren.
Tanner wartete gar keine Antwort ab, sondern ging den grauen Fischgratmantel aus einem Schrank im hintersten Zimmer seiner weitläufigen Wohnung holen.
Als Tanner zurückkam, stand D’Arcy bereits unter der Wohnungstür. Tanner warf ihm den Mantel zu.
Er müsste Ihnen eigentlich perfekt passen. Als ich ihn gekauft habe, war ich noch etwas schlanker. Kommen Sie, D’Arcy, kommen Sie.
Tanner nahm zwei Treppen aufs Mal. Unten angekommen, ging er direkt zur Garage und öffnete die schweren Flügeltüren. Dann blickte er zum Haus.
Kommen Sie, D’Arcy.
D’Arcy stand im Mantel unschlüssig unter der Tür. Der Mantel war ihm zwar etwas zu groß, aber immerhin musste er jetzt nicht mehr frieren.
Sie müssen die Tür nur hinter sich zuziehen.
Tanner setzte sich in den Wagen und war gespannt, ob der Motor nach so langer Ruhezeit überhaupt anspringen würde. Er tat es ohne Probleme. Er fuhr den Wagen aus der Garage und bedeutete D’Arcy einzusteigen.
Wir fahren durchs flache Land zwischen den Seen, wenns recht ist.
D’Arcy lachte.
Ob es recht ist, fragen Sie mich? Oh ja. Sehr sogar. Sie sind sehr großzügig zu mir, Herr Tanner.
Dann wiederholte er dieses schöne, altmodische Dankeswort, das seine Großmutter bisweilen zu sagen pflegte.
Schon waren sie aus dem Dorf heraus, am Schloss vorbei, das man zu dieser Jahreszeit sehr gut von der Straße aus sehen konnte, da all die alten Bäume kahl waren. Kurz darauf entschied sich Tanner für die Umfahrungsstraße um das Bezirksstädtchen.
Sie schwiegen beide. Erst als sie die pfeilgerade Straße erreichten, die sie tief ins fruchtbare flache Land bringen würde, räusperte sich D’Arcy.
Äh … das ist ein sehr schöner und bequemer Wagen, Herr Tanner. Einer meiner Onkel hatte auch so einen, vielleicht ein etwas älteres Modell. Aber auch mit diesen weichen Ledersitzen. Ich habe mir nie etwas aus Autos gemacht, müssen Sie wissen. Ich bin immer sehr gerne Fahrrad gefahren. Alles andere war mir irgendwie zu schnell. Wissen Sie, ich komme mit meinen Augen gar nicht mit.
Tanner schaute ihn fragend an. D’Arcy lächelte.
Ja, verstehen Sie, ich kann gar nicht so schnell schauen, wie man es beim Autofahren braucht. Oder vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so schnell, äh … denken kann. Das war auch früher beim, äh … Sport so. Ich konnte die Bälle einfach nicht sehen. Meine Schulkameraden haben nie verstanden, äh … warum ich keine Bälle fangen konnte, dabei habe ich sie gar nicht gesehen, wenn sie geflogen kamen. So einfach war das. Ich habe sie nicht gesehen. Können Sie sich das, ähm vorstellen?
Tanner nickte, sagte aber nichts. Er konnte es sich sogar sehr gut vorstellen. Vor allem den Spott, dem D’Arcy sicher ausgesetzt gewesen war. Kinder waren in der Hinsicht gnadenlos.
Plötzlich kicherte D’Arcy.
Beim Militär war es dann natürlich ein Glück. Nach drei Tagen hat man mich als unbrauchbar wieder nach Hause geschickt.
Er korrigierte sich.
Nein, nein. Das Wort war nicht unbrauchbar! Untauglich wurde das damals genannt. Genau: untauglich. Und meine Familie, äh … schämte sich. Sie müssen wissen, in meiner Familie ist man einfach nicht untauglich. In meiner Familie wimmelt es nur so von, ähm … Eichenlaub und goldenen Spaghetti um die, äh … Hüte.
Er ließ seinen Finger um seinen Kopf kreisen.
Dafür war ich gut in allem, was äh … Geduld erforderte. Laut meiner Mutter konnte ich schon mit vier Jahren Puzzles mit Hunderten von Teilen zusammensetzen.
Tanner nickte bewundernd.
Was haben Sie denn für einen Beruf gelernt, Herr D’Arcy?
Uhrmacher. Ich habe Uhrmacher gelernt. Bei einem genialen, alten Meister …
Seine Miene verdunkelte sich.
… der leider nicht mehr lebt.
Tanner wartete eine Weile. Aber D’Arcy schwieg.
Erzählen Sie mir von Ihrem Meister?
Er nickte, begann zögernd zu erzählen und kam dann immer mehr in Schwung.
Als ich Aziz Haddad, so hieß er, kennenlernte, war er bereits ein älterer Mann, schlaksig bis hager, aber bei bester Gesundheit. Alle Welt nannte ihn Monsieur Adda. Er betonte immer, dass er sein Lebtag nie krank gewesen sei und dass er immer noch alle seine Zähne besitze und niemals ein Loch gehabt habe. Sein Vater sei Ringer gewesen, und auch er habe es in seiner Jugend ein wenig ausprobiert. Er führte gerne seinen starken Bizeps vor, der bei so einem schmächtigen Körper überraschte. Wenn er auf jemand eine Wut hatte oder sonst irgendwie schlecht gelaunt war, ging er in den Hof der Werkstatt und spaltete in kurzer Zeit einen riesigen Berg Holz. Ansonsten war er die Gutmütigkeit in Person, fast wie eine gütige Person oder eine Fee aus einem Märchen, wissen Sie.
Tanner nickte.
Am liebsten unterhielt er sich über das Uhrmacherwesen. Viele Leute hielten ihn für einen großen Gelehrten, dabei hatte er kaum eine Schulbildung. Er sagte immer: Es waren die Uhren, die mich alles gelehrt haben. Er war sicher einer der besten Uhrmacher weit und breit.
Jean D’Arcy lächelte.
Uhren waren für ihn Persönlichkeiten. Wie soll ich sagen? Ja, er behandelte Uhren, als ob sie lebendige Wesen wären. Er behandelte sie mit Ehrfurcht und Liebe. Brachte man ihm eine Uhr, die wirklich rettungslos defekt war, wurden seine Gesichtszüge ganz weich: Das Herz schlägt nicht mehr. Das Gehirn ist beschädigt, sagte er zum Beispiel, oder: Wie soll sie denn gehen, die arme, wenn beide Füße gebrochen sind.
Unterdessen hatten sie das flache Land durchquert. Die Anhöhen des sanften Hügels, der den See säumte, waren zum Greifen nahe. Tanner entschied sich für die Route am See entlang.
Tanner blickte kurz auf D’Arcys Gesicht. Er schien tief in Gedanken versunken. Er fragte sich einmal mehr, ob die Traurigkeit in den Augen D’Arcys vom Gefängnisaufenthalt kam oder ob es andere Gründe gab? Hatte er keine Frau, die auf ihn wartete? Was hatte er vor? Warum ist er ausgerechnet in dem kleinen Dorf am See ausgestiegen?
Unvermittelt schaute D’Arcy auf.
Darf ich Sie etwas fragen, Herr Tanner? Ja, sicher. Fragen Sie.
Ich meine, äh … etwas, äh … Persönliches, verstehen Sie?
Ja, fragen Sie halt. Wir sehen ja dann, ob ich in der Lage bin zu antworten.
Gut.
Glauben Sie an Gott?
Tanner lächelte und lehnte sich zurück.
Nein, ich glaube nicht an einen Gott.
D’Arcy fuhr sich nervös durch die Haare.
Wenn Sie nicht an, äh … Gott glauben: An wen wenden Sie sich denn, wenn Sie, äh … allein sind und oder ähm … verzweifelt?
Lieber D’Arcy, seien Sie mir nicht böse, aber ich glaube, das ließe sich bei einem kleinen Kaffee besser besprechen. Meinen Sie nicht auch?
D’Arcy nickte.
Sie haben recht.
Im nächsten Weindorf hielten sie bei einem Restaurant mit einer kleinen Seeterrasse an. Sie setzten sich in die leere Gaststube, und Tanner bestellte zwei Kaffee.
Als der Kaffee vor ihnen stand, räusperte sich der junge Mann umständlich.
Wenn Sie also nicht an Gott glauben, dann glauben Sie auch nicht, dass er seinen, äh … Sohn, äh … auf die Erde geschickt hat, um uns zu erlösen.
Das vermuten Sie ganz richtig, D’Arcy. Das glaube ich auch nicht. Abgesehen davon sehe ich weit und breit keine Erlösung. Sie etwa?
Und was ist mit den Zehn Geboten?
Was soll damit sein? Meines Wissens haben wir unsere ganze Ethik den Griechen zu verdanken. Das sind Grundbedingungen für ein menschenwürdiges Zusammenleben. Ganz zuoberst steht: Die Würde jedes einzelnen Menschen ist unantastbar. Dazu braucht es meiner Meinung nach keinen Gott.
Tanner trank seinen Kaffee.
An wen wenden Sie sich denn, wenn Sie verzweifelt sind, D’Arcy?
Er zeigte lächelnd nach oben.
Ich bete. Und dann bin ich noch einer lieben Gemeinschaft verbunden, die nicht weit von hier ihr Zentrum hat.
Er zeigte vage in eine Richtung.
Eine religiöse Gemeinschaft?
Ja, ja. So was Ähnliches.
D’Arcy wiegte den Kopf. Offenbar wollte er nicht weiter darüber sprechen. Er rührte unentwegt in seinem Kaffee.
Wissen Sie, warum ich in dieses Dorf gekommen bin?
Nein. Wieso?
Mein alter Meister, äh … also mein Uhrmachermeister, Monsieur Adda, liegt hier begraben. Gott hab ihn selig. Er ist leider verstorben, während ich in, äh … in Spanien war. Ich konnte also nicht an seine Beerdigung.
Ach. War er denn von hier?
Nein, nein. Er ist in Algerien geboren. Aber seine Frau ist hier aufgewachsen, und somit liegen beide hier begraben.
Tanner stutzte.
Sagen Sie mal, D’Arcy, warum hätte Bodmer Sie eigentlich gestern so früh wecken sollen?
D’Arcy errötete und blickte auf seine Fingerspitzen.
Ja, wissen Sie, mein Meister liebte die frühen Morgenstunden. Und so wollte ich ihm äh … die äh … Ehre erweisen und ganz, ganz früh am Morgen zu seinem Grab gehen und sagen: Meister, hier bin ich endlich – und ähm … Sie sehen, ich bin früh aufgestanden.
Tanner lachte.
Aha, ich verstehe.
Wissen Sie, ganz früh am Morgen, wenn jeweils alles noch geschlafen hatte, liebte es mein Meister, seinen Uhren zu lauschen. Und ich, als sein Schüler, musste es ihm gleichtun. Da saßen wir dann beide und lauschten. Bei Armbanduhren hatten wir Stethoskope, so wie die Ärzte sie verwenden. Bei großen Uhren lauschten wir mit dem Ohr am Gehäuse. Auf der einen Seite mein Meister, auf der anderen ich. Zuerst habe ich wochenlang, ja monatelang nichts anderes gehört als tic-tac-tic-tac. Er sagte immer, man müsse so zuhören, dass man alles andere vergessen, sich ganz in die Uhr hinein versetzen könne. Man müsse quasi zur Uhr selber werden, dann könne man herausfinden, was dem Mechanismus fehlte, dann würde man die Seele der Uhr verstehen.
D’Arcy sprach jetzt ohne Stocken, seine Augen leuchteten.
Wie gesagt, zuerst hören Sie nur das Ticken einer Uhr, aber dann – plötzlich öffnet sich ein neues akustisches Universum. Plötzlich können Sie die Geräusche so zerlegen, dass Sie die Reibung jedes einzelnen Zahnrädchens hören, jedes Schleifgeräusch eines Lagers orten, das sich nicht ganz im Gleichgewicht befindet. Bei mir dauerte es allerdings über drei Jahre, bis ich alles hörte.
Drei Jahre lang? Sind Sie da zwischendurch nicht verzweifelt?
Doch, natürlich. Mein Meister verbot mir zudem, die Uhren zu öffnen, bevor ich hören konnte, was mit ihr los war. Ich habe natürlich gelernt, Uhren zu bauen. Aber die wertvollen Uhren, die mein Meister zur Revision oder zur Reparatur erhalten hatte, durfte ich erst öffnen, wenn ich ihm vorher genau beschreiben konnte, was drinnen los war.
Das ist ja interessant.
Sie schwiegen beide.
Konnten Sie im Gefängnis wenigstens etwas lernen oder von Ihren Fertigkeiten Gebrauch machen?
Ja, als der Direktor merkte, dass ich etwas von Uhren verstehe, belieferte er mich dann und wann mit Uhren, die ich reparieren musste –, und er strich das Geld ein.
Er lachte.
Die Werkzeuge musste ich natürlich immer wieder vollständig abgeben, denn damit hätte man auch allerhand anderes herstellen können.
Ja, ich verstehe.
Tanner überlegte, was er alles damit hätte herstellen können.
Hat man Ihnen, als man Sie gefasst hatte, eigentlich keinen Handel vorgeschlagen?
D’Arcy schaute ihn erschrocken an.
Handel?
Strafmilderung gegen Informationen. Zum Beispiel, woher Sie die Drogen hatten oder für wen Sie die geschmuggelt hatten?
Aber … äh … ich habe Ihnen doch … äh … man hat sie mir ja heimlich in die Tasche gesteckt!
Ja, das schon, aber Sie haben doch gesagt, dass Sie wüssten, wer Ihnen das eingebrockt hat.
D’Arcy wurde noch blasser und wandte sich schnell ab.
Ja, aber das ist etwas anderes. Das sind schließlich keine … äh … ja, wie gesagt, das ist etwas anderes.
Er räusperte sich.
Herr Tanner, seien Sie mir nicht böse, aber könnten wir langsam umkehren, ich hätte heute Nachmittag noch etwas zu erledigen.
Tanner nickte und verkniff sich die Frage, um was es sich denn handelte. Sonnenklar aber war, dass Jean D’Arcy über das Thema nicht reden wollte. Tanner blieb nichts anderes, als es zu akzeptieren. Er bezahlte den Kaffee. Beim Rausgehen zückte er sein Telefon, blickte nach der Uhrzeit und sah, dass er eine Sprachmitteilung hatte.
Nachtessen bei Bodmer. Habe interessante Informationen. Wenn Sie nicht kommen, bitte melden. Sonst 20.00 Uhr. Wille.
VIER
Wenn er etwas hasste, dann waren es diese verfluchten Schießübungen. Schon zweimal war es ihm dieses Jahr gelungen, sich davor zu drücken, heute hatte er daran glauben müssen. Dass er in seinem Beruf schießen können musste, leuchtete ihm ein. Aber er hasste die Atmosphäre im Schießkeller. Die Art von Kameradschaft erinnerte ihn fatal an die Polizeirekrutenschule, die er längst als ein übles Kapitel in seinem Leben abgehakt hatte.
Seine Schießresultate waren denn auch alles andere als berauschend gewesen. Der Verantwortliche hatte die Stirn gerunzelt und ihm nur zögernd den Stempel aufs Formular gedrückt. Ein Punkt weniger, und er wäre reif gewesen, und zwar für den ganzen Rattenschwanz von medizinischen Untersuchungen, Augentests und so weiter und so fort. Wer all die Tests nicht besteht, wird in den Innendienst versetzt. So einfach war das. Und davor graute Michel.
Der Beamte hatte mit schiefem Maul gegrinst.
Gerade noch die Kurve gekriegt, mein Lieber. Wünsche viel Glück für den Ernstfall. Besser, du kommst in keinen!
Ja, ja, bla … bla … bla.
Michel winkte ab. Im sogenannten Ernstfall – die Kollegen liebten das Wort über alles – ist sowieso alles ganz anders. Außerdem hatte er sich längst zur Regel gemacht, so lange wie möglich zu verhandeln und dann die Einsatztruppe zu bestellen, wenns denn unumgänglich war.
Nach diesem verlorenen Morgen – und auch ein bisschen zur Belohnung – leistete er sich ein saftiges und kunstvoll arrangiertes Wildmenu beim Stocker auf der anderen Seite des Sees.
Das Restaurant war wie immer ziemlich voll, trotzdem fand der Chef Zeit, sich zu Michel an den Tisch zu setzen.
Ich habe gehört, dass Tanner wieder in der Gegend ist. Der hohe Norden soll ihm nicht so gut bekommen sein!
Michel grunzte.
Wer behauptet denn so was? Stimmt doch alles nicht. Wer erzählt denn so einen Bockmist?
Ach, die Spatzen, die Spatzen. Du weißt ja, wer alles bei mir isst. So was spricht sich schnell herum, zumal im Winter, wo sich die ganze Welt zu Tode langweilt. Weißt du denn, wie es unserer lieben Solveig geht?
Ich weiß nur, dass sie ihre kranke Mutter pflegt, den Rest musst du Tanner fragen. Früher oder später wird er hier ja wieder auftauchen.
Mein Gott, bist du schlecht gelaunt! Schmeckt dir mein Essen nicht?
Doch, doch, Stocker. Nimms nicht persönlich. Ich hatte heute mein persönliches Schießprogramm zu absolvieren. Ist nicht gerade mein Tag.
Aha. Ich verstehe. Wenn du beim Kaffee bist, komme ich noch einmal zu dir. Ich spendier dir, wenn du willst, auch gerne ein Dessert. Ich muss dich nämlich dringend etwas fragen.
Als Stocker wieder in seine Küche verschwunden war, stocherte Michel lustlos in seinem Teller. Musste dieser Scheißkerl auch noch Solveig erwähnen? Mein Gott, war er damals in sie verknallt gewesen! Und dann diese kalte Abfuhr. Es gab ihm immer noch ein Stich, und zwar an der Stelle, wo es empfindlich wehtat.
Das Ego – das unsichtbarste, aber zugleich empfindsamste Organ vor allem der Männer –, wie es die neue Polizeipsychologin nannte, die letzthin, auf Anordnung von ganz oben, einen ewig langen Vortrag vor der ganzen Mannschaft gehalten hatte.
Na, wenn schon, dann hats mich halt am Ego getroffen. Wen geht das etwas an! Ist ja schließlich mein Ego!
Irgendwie mochte er es Tanner gönnen, dass es offenbar nicht ganz so geklappt hatte mit ihr. Wenn es denn so war. Aber warum sonst wäre Tanner freiwillig zurückgekommen? Er wollte es ihm ja partout nicht erzählen. So eine Frau lässt man doch nicht allein. Keine Stunde. Schon gar keinen ganzen Tag. Na ja, wenn schon.
Gleichzeitig schämte er sich für diese kleinen hämischen Ge fühle. Ging es ihm denn besser? Um diese aufkommenden Gedanken zu verdrängen, trank er den Rest des Bieres in einem Zuge aus und bestellte sich per Handzeichen kurzerhand ein neues, obwohl er mit sich ausgemacht hatte, dass er am Mittag nur noch ein einziges Bier trinken wollte. Aber heute war sowieso ein Ausnahmetag – Schießtag eben –, und zudem wartete im Büro nichts Dringendes auf ihn. Im Gegenteil: seit ein paar Wochen dümpelte das Kommissariat vor sich hin, als habe sich auf einen Schlag die Menschheit gebessert – zumindest im Bereich seiner Abteilung Leib und Leben. Er konnte sich nicht erinnern, dass es während seiner ganzen Dienstzeit jemals über so lange Zeit so ruhig gewesen wäre. Sämtliche Schreibtische waren aufgeräumt wie nie. Die Aktenberge verschwunden. Die Bleistifte gespitzt. Er fragte sich allen Ernstes, ob es so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm gab? Er versuchte ein wenig zu ergründen, wie denn so ein Sturm aussehen könnte, kam aber auf keine besonders einfallsreiche Idee. Vielleicht finden demnächst schreckliche Terrorakte statt mit Dutzenden von Geiseldramen oder weiß der Teufel was.
Freudig nahm er das frisch gezapfte Bier entgegen, das die Bedienung ihm brachte, und er gönnte sich einen tiefen ersten Schluck. Er war der Meinung, dass er sich den redlich verdient hatte. Seine Laune hellte zunehmend auf.
Das einzige Geschäft, das er sich für heute Nachmittag vorgenommen hatte, war die Akte Wille. Sie war letzthin bei ihm vorstellig geworden, denn sie wollte partout weg von der Straße, aus der Uniform raus und in seine Abteilung. Sein Chef hatte ihm erstaunlicherweise freie Hand gelassen – auch so ein Wunder. Immerhin war seine Abteilung unterbesetzt, was in dieser ruhigen Zeit kein Schaden war, aber sobald die Abteilung wieder auf gewohnten Hochtouren laufen würde – und dieser Tag würde kommen –, fehlte mindestens ein Mitarbeiter oder eben eine Mitarbeiterin. Die Wille hatte genug Dienstzeit auf Streife und Innendienst und wohl auch sämtliche notwendigen Kurse absolviert – mit Bravour, wie man munkelte. In der Akte würde ja dann alles zu finden sein.
Ja! Und sie war ziemlich attraktiv. Nicht unbedingt schön, es war eher ihre Art sich zu bewegen. Und sie hatte dieses aufreizende Lachen.
Saufrech ist sie. So ist es.
Seine Miene verfinsterte sich.
Wenn er mit ihr sprach, hatte er immer das Gefühl, sie nehme ihn nicht besonders ernst. Er war irgendwie sauer auf sie, ohne genau zu wissen, warum.
Sie ist eine eingebildete Kuh.
Plötzlich erschien Stocker und setzte sich ihm schwungvoll gegenüber.
Wolltest du was bestellen oder führst du schon Selbstgespräche?
Michel winkte ab. Stocker ließ sich nicht beirren.
Na, Gott sei Dank. Ich sehe, die Laune hat sich mächtig gebessert. Kann wirklich mein Essen so etwas bewirken, oder denkst du gerade an etwas Schönes? An etwas, was man weniger essen als vielleicht abschlecken kann? Du hattest gerade so einen verzückten Glanz in deinen Augen …
Ach wo. Du bist und bleibst ein Spinner, Stocker. Aber dein Essen ist Spitze, das muss dir der Feind lassen.
Gut. Dann gebe ich dir noch meine neueste Kreation mit Feigen in Vanille und Schokolade zum Kosten.
Er machte ein Zeichen zu seiner Frau, die an der Theke stand und formulierte mit den Lippen lautlos seinen Wunsch. Sie nickte und verdrehte die Augen. Stocker schickte ihr einen Kuss per Flugpost.
Michel verzog seinen Mund zu einem Grinsen.
Schön zu sehen, wie auch ältere Ehepaar noch miteinander schnäbeln.
Ach Michel, du bist ja nur neidisch, gib es zu. Und was heißt hier älter? Ich bin sicher mindestens eine Generation jünger als du.
Ja, aber seit mindestens zwanzig Jahren verheiratet. Damit seid ihr ein älteres Ehepaar.
Michel lachte dröhnend. Er war ziemlich stolz auf seine Schlagfertigkeit.
Ja, lach nur. Wenn du wüsstest …
Wenn ich was wüsste?
Was unser Geheimnis ist. Na ja, wahrscheinlich jeder guten, langjährigen Beziehung.
Und was wäre das Geheimnis?
Kennt das die Polizei nicht? Das magische Dreieck!
Wie bitte.
Michel beugte sich vor. Sein Interesse war nicht geheuchelt.
Was ist denn das magische Dreieck?
Stocker lehnte sich zurück.
Ich verrate dir das Geheimnis, wenn du mir versprichst, dass du dir nachher in Ruhe meine Geschichte anhörst.
Michel hob indianermässig die Hand.
Versprochen! Was ist denn jetzt dieses Geheimnis?
Stocker beugte sich vor und dämpfte seine Stimme.
Es sind die berühmten drei Gs.
Michel runzelte die Stirn.
G wie Guter Sex. G wie Großzügigkeit. G wie gemeinsames Geschäft. Verstehst du? Die Reihenfolge ist wurscht. Aber alle drei müssen stimmen.
Michel konnte seine Enttäuschung nicht verhehlen.
Ist das alles?
Stocker lachte.
Ja, bist du noch bei Trost, Michel? Was hast du denn erwartet? Irgendwas mit Hokuspokus?
Stocker stippte mit seinem Finger in Richtung von Michels mächtiger Stirn, als ob er dort ein Loch bohren wollte.
Was ich dir beschreibe, ist die hohe Kunst, das sage ich dir. Geht das nicht in deinen Schädel?
Michel nickte.
Doch, doch.
Er schielte zur Frau vom Stocker, die sich gerade abwandte, sodass er ihr zugegebenermassen verlockendes Profil sehen konnte.
Stocker warf die Hände in die Luft.
Ich sprach von gutem Sex. Mein Gott, den kann man nicht sehen. Das kann man nur erleben. Bist du so, oder tust du gerade ein bisschen kompliziert? Das Aussehen zählt vielleicht am Anfang, wusstest du das nicht?
Ja, ist ja gut, Stocker. Reg dich ab. Wenn bei euch wirklich alles so gut läuft wie das Geschäft, dann ist ja alles gut. Das verstehe sogar ich, stell dir vor. Ist ja sicher auch schön für dein Ego. Falls du weißt, was das ist.
Ja, was meinst du, was du denn heute gegessen hast. Gebratenes Ego!
Sie lachten herzhaft.
Also, was ist das für eine Geschichte, die du mir unbedingt erzählen willst?
In diesem Augenblick brachte Frau Stocker persönlich das Dessert und den Kaffee für Michel.
Ich wünsche einen guten Appetit.
Sie ging betont Hüfte schwingend in Richtung Theke. Dann wandte sie sich lächelnd noch einmal um.
Stocker grinste übers ganze Gesicht und schaute Beifall heischend zu Michel.
Ja, ja, Stocker. Ich habe es begriffen. So. Jetzt aber zum Dessert.
Michel nahm einen Löffel voll und roch daran.
Oh, das riecht ja fantastisch.
Dann steckte er den Löffel in den Mund.
Stocker, du bist ein Genie.
Der Angesprochene lachte.
Sag ich doch. Also, hör mal. Bevor ich die Geschichte erzähle, eine wichtige Frage: Verjährt Mord?
Michel schluckte erst runter, dann wischte er sich bedächtig den Mund mit der Serviette.
Nein, Stocker. Mord verjährt nicht. Warum? Hast du jemanden ermordet? Ich habe ausnahmsweise keine Handschellen dabei.
Mach jetzt keine Witze, Michel. Mord verjährt also nie, sagst du?
Ja. Genau so ist es. Mord verjährt nie.
Michel blickte ihn an.
Kommt jetzt die Geschichte oder was?
Ich erzähle dir eine Geschichte von einer ziemlich ärmlichen Familie aus dem Seeland da unten. Das ist auf der anderen Seite vom Hügel. Etwa eine halbe Stunde Fahrzeit von hier. Sie waren zu Pacht auf einem kleinen Bauernhof. Der Vater hatte zu seinen besten Zeiten nie mehr als sieben Kühe. Sie pflanzten ein bisschen Gemüse, ein bisschen Kartoffeln und so weiter. Sie hatten drei Kinder, und alle hatten ständig Hunger. Die Mutter pflegte zu sagen: Wir sind zwar arm, aber anständig und zufrieden.
Michel nickte.
Ja, den Spruch kenne ich. Weiter.
Direkt in unmittelbarer Nachbarschaft lag noch ein Hof, der war sogar noch kleiner. Da lebte Karst, Heinrich Karst, und zwar ganz allein. Sie nannten ihn Onkel Karst, obwohl sie nicht miteinander verwandt waren. Also, alt war er eigentlich noch nicht gewesen. Für Kinder ist jemand über dreissig alt, zumal er körperlich leicht behindert war. Er hatte es mit dem Rücken und lief etwas gekrümmt. Er war wohl früher längere Zeit im Ausland gewesen, aber die Kinder wussten nichts Genaues. Er lebte also allein und hatte weit und breit keine Familie. In dem Sinne waren sie seine Familie. Sie durften bei ihm drüben spielen, und der Vater half ihm in allem aus, als wäre der Karst sein eigener Bruder oder so. Wenn es nötig war, half er ihm im Wald oder auf dem Feld und erledigte wohl vor allem Karsts ganzen Papierkram und stritt auch mal mit der Gemeinde, wenn der Karst das Gefühl hatte, dass man ihn bescheißen wollte. Die Mutter pflegte den Karst, wenn er krank war und besorgte ihm Arzneimittel und so weiter. Kannst du dir die Situation vorstellen, Michel?