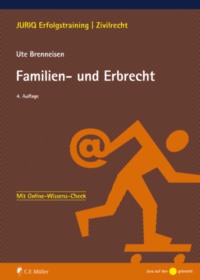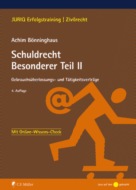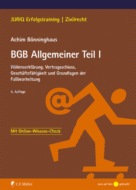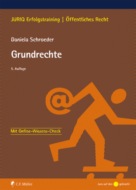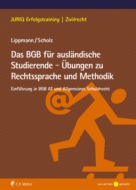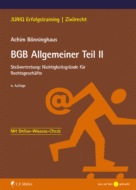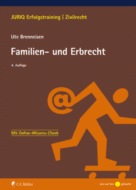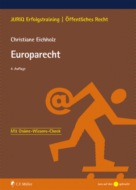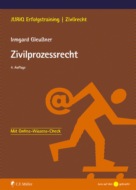Kitabı oku: «Familien- und Erbrecht», sayfa 5
2. Voraussetzungen der Mitverpflichtung
a) Wirksame Ehe
62
Für die Annahme einer Mitverpflichtung des anderen Ehegatten muss eine wirksame Ehe bestehen.
JURIQ-Klausurtipp
In einer Klausur ist für den Fall, dass vor der Hochzeit ein Angebot zum Abschluss eines Rechtsgeschäfts gemacht worden ist, genau zu prüfen, in welchem Zeitpunkt das Rechtsgeschäft angenommen worden ist. Die Vorschrift des § 1353 findet keine Anwendung, wenn das Rechtsgeschäft vor der Eingehung der Ehe abgeschlossen worden ist.
63
Auch bei einer aufhebbaren Ehe findet § 1357 Anwendung. Erst mit Rechtskraft des Urteils, das die Ehe aufhebt, ist die Ehe unwirksam § 1313 S. 2.
b) Kein Ausschluss nach §§ 1357 Abs. 2, 1412
64
Interne Beschränkungen der Ehegatten untereinander oder ein Ausschluss der Haftung aus § 1357 Abs. 1 im Innenverhältnis wirken nach außen nur, wenn sie im Güterrechtsregister eingetragen sind, §§ 1357 Abs. 2, 1412.
c) Kein Getrenntleben, § 1357 Abs. 3
65
Nach § 1357 Abs. 3 findet die Vorschrift des § 1357 keine Anwendung, wenn die Ehegatten getrennt i.S.v. § 1567 leben. Nach h.M.[54] liegt ein Getrenntleben der Ehegatten auch dann vor, wenn die Ehegatten noch in einer Wohnung leben, aber einen getrennten Haushalt führen. Dagegen tritt ein Verlust der Schlüsselgewalt nicht dadurch ein, dass die Ehegatten nur vorübergehend getrennt sind. Entscheidend für eine Trennung ist der beiderseitige Wille der Ehegatten, die häusliche Lebensgemeinschaft nicht mehr aufrechterhalten zu wollen.
Beispiel
An einem solchen Willen fehlt es und ein Getrenntleben scheidet aus, wenn ein Ehegatte einen längeren Aufenthalt in einem Sanatorium hat oder bei einer vorübergehenden Tätigkeit eines Ehegatten im Ausland.
d) Rechtsgeschäft zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs
66
Die aus § 1357 sich ergebende Verpflichtungsermächtigung bezieht sich nur auf solche Rechtsgeschäfte, die zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs der Familie erforderlich sind. Der Lebensbedarf ist ein Begriff aus dem Unterhaltsrecht (§§ 1360a, 1610). Er erfasst alle Rechtsgeschäfte des unmittelbaren Bedarfs (Ernährung, Kleidung, Miete, Heizkosten etc.) und des persönlichen Bedarfs (Bücher, Genussmittel, Kurzreisen), für die wegen des Umfangs des Rechtsgeschäfts eine vorherige Verständigung der Ehegatten nicht stattfindet.

Angemessen ist die Deckung des Lebensbedarfs, wenn sie nach Art und Umfang den durchschnittlichen Gebrauchsgewohnheiten einer Familie in vergleichbarer sozialer Lage entspricht.
Für die Beurteilung ist der nach außen in Erscheinung getretene Lebenszuschnitt der Familie maßgebend.[55] Rechtsgeschäfte, die den bisherigen Lebensstandard der Familie überschreiten oder die die Lebensbedingungen grundlegend ändern, unterliegen daher nicht der Schlüsselgewalt.

[Bild vergrößern]
Beispiel
Kauf eines Eigenheims, Kauf eines Luxusautos oder einer Segelyacht
67
Von der Vorschrift des § 1357 werden auch solche Rechtsgeschäfte nicht erfasst, die in der persönlichen Sphäre eines Ehegatten liegen oder die der Vermögensverwaltung oder der Vermögensanlage dienen.
Beispiel
Abschluss eines Arbeitsvertrags oder Buchung einer Fortbildungsveranstaltung, Abschluss eines Sparvertrages
68

Nach h.M.[56] können auch Rechtsgeschäfte, die den Vorschriften des Verbraucherschutzes (§§ 312 ff., Verbraucherdarlehen nach §§ 491 ff., Finanzierungshilfen nach §§ 506 ff., Ratenlieferungsverträge nach § 510) unterliegen, generell in den Anwendungsbereich von § 1357 Abs. 1 S. 1 fallen. Sofern die sonstigen Voraussetzungen des § 1357 erfüllt sind, werden beide Ehegatten aus einem Ratenlieferungsvertrag über § 1357 berechtigt und verpflichtet. Nach h.M. ist es auch ausreichend, wenn die Formvorschriften des §§ 492, 355 nur gegenüber dem handelnden Ehegatten erfüllt sind und nur ihm gegenüber die Widerrufsbelehrung nach § 355 erfolgt ist. Soweit der nicht handelnde Ehegatte mit verpflichtet worden ist, werden auch ihm gegenüber die Schutzwirkungen der verbraucherschützenden Regelungen zuteil. Ihm steht insbesondere das Widerrufsrecht zu.[57] Für die Fristberechnung muss sich der andere Ehegatte die Kenntnis des handelnden Ehegatten von der Widerrufsbelehrung in entsprechender Anwendung der Vertretungsregelungen zurechnen lassen.[58]
Hinweis
Bei Verbraucherdarlehen und Ratenzahlungsverträgen kann eine Mitverpflichtung des Ehegatten nach § 1357 nicht mehr angenommen werden, soweit die Valuta ein Viertel des monatlichen Einkommens überschreitet.[59]
Der Abschluss einer Vollkaskoversicherung für ein Familienfahrzeug der Ehegatten kann ein Geschäft zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs der Familie i.S.v. § 1357 Abs. 1 sein. Gleiches gilt für die Kündigung eines solchen Vertrags.[60]
e) Keine anderen Umstände
69

Es dürfen keine für den Vertragspartner erkennbaren Umstände vorliegen, die die Mitverpflichtung und die Mitberechtigung des anderen Ehegatten ausschließen. Das ist der Fall, wenn der handelnde Ehegatte eindeutig klarstellt, dass er der alleinige Vertragspartner sein will. Auch aus objektiven Umständen kann sich ein solcher Ausschluss ergeben. Der Abschluss von ärztlichen Behandlungsverträgen unterliegt der Vorschrift des § 1357, wenn die Heilbehandlung eine medizinisch notwendige Maßnahme betrifft und die Behandlung unaufschiebbar ist.[61] Überschreiten die Behandlungskosten die finanziellen Verhältnisse der Familie, so tritt keine Mitverpflichtung des anderen Ehegatten ein, wenn dies für den Vertragspartner anhand des wirtschaftlichen Erscheinungsbilds der Familie erkennbar ist.
f) Übungsfall Nr. 1
70
„Behandlungskosten“
M und F waren 10 Jahre im Güterstand der Zugewinngemeinschaft verheiratet. Aus der Ehe sind drei Kinder hervorgegangen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Ehegatten waren sehr angespannt, da der M in den letzten Jahren nur geringe Einkünfte aus einer selbständigen Tätigkeit erzielt hat. Die Allgemeine Ortskrankenkasse hatte das mit M bestehende Krankenversicherungsverhältnis gekündigt, nachdem er die Krankenkassenbeiträge nicht mehr zahlen konnte. M musste sich nach der Kündigung des Versicherungsverhältnisse wegen eines Bronchialkarzinoms einer Chemotherapie in einer Klinik unterziehen. Vor der Behandlung schloss er als Selbstzahler einen Behandlungsvertrag mit der Klinik K ab, um absolut notwendige Behandlungsleistungen in Anspruch zu nehmen. Nach Beendigung der Behandlung leistete M die vertraglich vereinbarten Behandlungskosten nicht. Kurze Zeit später verstirbt M und wird von seinen drei Kindern testamentarisch beerbt. Die Klinik K nimmt die F wegen der für den M entstandenen Behandlungskosten in Höhe von 20 000 € in Anspruch.
(Anmerkung: Dem Sachverhalt liegt die Entscheidung des BGH[62] zugrunde.)
71
Lösung
K kann gemäß §§ 611 Abs. 1, 1357 die Behandlungskosten von F als Mitverpflichtete des von M mit K geschlossenen Behandlungsvertrags verlangen.
I. Vertraglicher Anspruch nach § 611
Ein solcher Anspruch setzt zunächst das Bestehen eines Dienstleistungsvertrags zwischen M und K voraus. M schloss mit K einen privatrechtlichen Behandlungsvertrag in Form eines Dienstvertrages gemäß § 611, durch den K einen Anspruch gegen M auf Leistung der vereinbarten Behandlung erwarb. Durch diesen Vertrag ist nur der M zur Zahlung der Behandlungskosten verpflichtet worden. F ist auch nicht im Rahmen einer Stellvertretung durch M bei dem Abschluss des Behandlungsvertrags vertreten worden, da M den Dienstvertrag im eigenen Namen abgeschlossen hat.
II. Mitverpflichtung der F gemäß § 1357 Abs. 1
F könnte durch den Vertragsschluss zwischen M und K nach § 1357 mit verpflichtet worden sein. Nach dieser Vorschrift kann jeder Ehegatte Geschäfte zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs der Familie auch mit Wirkung für den anderen Ehegatten abschließen, wodurch beide Ehegatten berechtigt und verpflichtet werden, solange sich nicht aus den Umständen etwas anderes ergibt.
1. Anwendbarkeit des § 1357 Abs. 1
Die Vorschrift des § 1357 Abs. 1 greift ein, wenn eine wirksame Ehe zwischen F und M im Zeitpunkt des Abschlusses des Behandlungsvertrags bestanden hat und sie nicht getrennt gelebt haben. Für diese Ausschlussgründe bestehen vorliegend keine Anhaltspunkte.
2. Geschäft zur Deckung des angemessenen Lebensbedarfs
Der zwischen M und K bestehende Behandlungsvertrag müsste ein Geschäft zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs gewesen sein. Geschäfte zur Deckung des Lebensbedarfs sind alle Geschäfte, die nach den Verhältnissen der Ehegatten der Deckung ihres Lebensbedarfs dienen. Der Umfang des Lebensbedarfs bestimmt sich in Anlehnung an das Unterhaltsrecht. Dazu zählt nicht nur der gesamte Bedarf der gemeinsamen Haushaltsführung, sondern auch ein eventuell persönlicher Bedarf der Ehegatten und der mit ihnen gemeinsam lebenden unterhaltsberechtigten Kindern.[63] Auch Aufwendungen, die nur einem Ehegatten zugutekommen, können Teil des Lebensbedarfs der Ehegatten sein. Zu ihrem Lebensbedarf gehört auch die ärztliche Versorgung eines Ehegatten, da die Behandlung im Interesse der gesamten Familie erfolgt. Ärztliche Behandlungen dienen der Gesundheit als dem primären und ursprünglichen Lebensbedarf der gesamten Familie. Dem steht nicht entgegen, dass aus dem ärztlichen Behandlungsvertrag wegen der Höchstpersönlichkeit der Leistung nur der behandelte Ehegatte berechtigt und der andere Ehegatte nur mit verpflichtet werden kann. Eine Mitverpflichtung der F tritt nach § 1357 Abs. 1 indes nur dann ein, wenn das Geschäft der angemessenen Deckung des Lebensbedarfs dient. Angemessen ist ein Geschäft, wenn es den wirtschaftlichen Verhältnissen und den tatsächlichen Lebensverhältnissen der Familie entspricht. Hierbei kommt es allein auf die tatsächlich verwirklichte Lebensführung der Ehegatten an. Im Hinblick auf die bescheidenen wirtschaftlichen Lebensverhältnisse der F und des M erscheint es zweifelhaft, ob die Inanspruchnahme von Behandlungsleistungen in Höhe von 20 000 € noch als angemessen beurteilt werden kann. Allerdings können trotz des bescheidenen Lebenszuschnittes der Ehegatten ärztliche Heilbehandlungskosten auch ohne Abstimmung unter den Ehegatten zu dem angemessenen Lebensbedarf gehören, wenn es sich um unaufschiebbare und medizinisch notwendige Maßnahmen handelt. Durch die wegen des Bronchialkarzinoms erforderliche Chemotherapie sollte eine lebensgefährliche Krankheit gelindert werden, so dass eine medizinisch absolut unerlässliche Behandlung vorlag. Solche Aufwendungen zählt die Rechtsprechung[64] zu dem Grundlebensbedarf jedes Ehegatten, die infolgedessen unabhängig von den Einkommens- und Lebensverhältnissen der Familie als angemessen eingestuft werden, auch wenn sich die Ehegatten zuvor nicht darüber abgestimmt haben.
III. Ausschluss der Mithaftung
Aus § 1357 Abs. 1 S. 2 folgt nur dann eine Mitverpflichtung des nicht den Vertrag schließenden Ehegatten, soweit sich nicht aus den Umständen etwas anderes ergibt. Das ist der Fall, wenn sich für den Vertragspartner aus dem Vertragsschluss ausdrücklich oder erkennbar der Wille des vertragsschließenden Ehegatten ergibt, nur sich allein verpflichten zu wollen.[65] Im Übrigen nimmt die Rechtsprechung an, dass eine Mithaftung für die den Lebensbedarf deckenden Geschäfte nur insoweit entsteht, wie der mitverpflichtete Ehegatte auch unterhaltsrechtlich zur Leistung verpflichtet gewesen wäre. Daran fehlt es, wenn das Geschäft die Leistungsfähigkeit der Familie überschreitet (sog. „Sonderbedarf“).[66] In diesen Fällen entsteht eine Mithaftung nur im Rahmen der Leistungsfähigkeit des mithaftenden Ehegatten. Die durch das Bronchialkarzinom erforderlichen Heilbehandlungskosten stellen einen Sonderbedarf dar. Die Mitverpflichtung der F hängt daher von ihrer Leistungsfähigkeit ab, die sich wiederum nach den wirtschaftlichen Verhältnissen der Familie bestimmt. Da für M kein Krankenversicherungsschutz vorhanden war und die Ehegatten über kein weitergehendes Vermögen verfügten, übersteigt der durch die Heilbehandlung entstandene Sonderbedarf die Leistungsfähigkeit der Familie und damit auch der F. Ihre Mitverpflichtung ist daher gemäß § 1357 Abs. 1 S. 2 ausgeschlossen.
IV. Ergebnis
K hat daher gegen die F keinen Anspruch auf Zahlung der Heilbehandlungskosten in Höhe von 20 000 €.
1. Teil Familienrecht › C. Die Ehe › IV. Haftungserleichterungen nach § 1359
IV. Haftungserleichterungen nach § 1359
72
Nach § 1359 ist der Umfang der Sorgfaltspflichtverletzung der Ehegatten auf die Sorgfalt beschränkt, die ein Ehegatte in eigenen Angelegenheiten (diligentia quam in suis) anzuwenden pflegt. Gemäß § 277 ist derjenige, der für eine solche Sorgfalt einzustehen hat, von der Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz nicht befreit. Der in § 1359 geregelte Haftungsmaßstab bezieht sich nur auf die Erfüllung der Pflichten, die sich aus den ehelichen Lebensverhältnissen ergeben. Er gilt nicht, wenn die Ehegatten sich rechtsgeschäftlich wie beliebige Dritte gegenüberstehen.
Beispiel
Ein Ehegatte ist aufgrund eines mit dem anderen Ehegatten geschlossenen Arbeitsvertrags in dessen Betrieb tätig. Beschädigt er in diesem Rahmen Waren oder Betriebsgegenstände, findet die Haftungserleichterung des § 1359 keine Anwendung.
73
Der mildere Haftungsmaßstab des § 1359 ist infolge teleologischer Reduktion nach h.M.[67] auch nicht anzuwenden, wenn bei der gemeinsamen Teilnahme der Ehegatten im Straßenverkehr durch Verschulden eines Ehegatten Schäden an dem Körper oder an dem Eigentum des anderen Ehegatten entstehen. Der Geltendmachung von fahrlässig verursachten Schadensersatzansprüchen kann zudem § 1353 Abs. 1 S. 2 entgegenstehen, wenn dies den Umständen nach dem ehelichen Zusammenleben widerspricht. Nach der Rechtsprechung[68] soll sich in diesen Fällen ein stillschweigender Haftungsverzicht ergeben, der allerdings nur dann eingreift, wenn die Ehegatten nicht getrennt leben bzw. geschieden sind.
74
Bei der Haftung der Ehegatten ist § 207 zu beachten, wonach die Verjährung von Ansprüchen zwischen Ehegatten für die Zeit des Bestehens der Ehe gehemmt ist. Die Haftungsprivilegierung führt in Klausuren oft zum Problem des gestörten Gesamtschuldverhältnisses.
1. Teil Familienrecht › C. Die Ehe › V. Eigentumsvermutung, § 1362
V. Eigentumsvermutung, § 1362
75
Für die Eigentumsverhältnisse gilt grundsätzlich die Vermutung des § 1006. Danach wird zugunsten eines Besitzers einer beweglichen Sache vermutet, dass er Eigentümer der Sache ist. Nach den allgemeinen Regelungen bestünde an den gemeinsam benutzten Gegenständen Mitbesitz der Ehegatten, der die Vermutung von Miteigentum der Ehegatten zu gleichen Teilen begründen würde, §§ 1008, 741, 742. Wegen der uneindeutigen Besitz- und Eigentumsverhältnisse in einer Ehewohnung stellt § 1362 Abs. 1 S. 1 für das Eherecht eine weitere vom Güterstand unabhängige Vermutung auf, wonach zugunsten der Gläubiger der Ehegatten vermutet wird, dass die im Besitz beider Ehegatten stehenden beweglichen Sachen dem Schuldner gehören. Die in § 1362 geregelte Vermutung gilt nur im Verhältnis zum Gläubiger und nicht im Innenverhältnis der Ehegatten untereinander.
76
Die Eigentumsvermutung des § 1362 Abs. 1 S. 1 wird in der Zwangsvollstreckung durch die Gewahrsamsvermutung des § 739 ZPO ergänzt. Nach dieser Vorschrift wird bei einer Zwangsvollstreckung gegen einen Ehegatten vermutet, dass für die Durchführung der Zwangsvollstreckung nur der Schuldner Besitzer und Gewahrsamsinhaber ist. Die Gewahrsamsfiktion des § 739 ZPO gewährleistet eine i.S.v. § 808 Abs. 1 ZPO verfahrensfehlerfreie Inbesitznahme des Gerichtsvollziehers auch hinsichtlich der Gegenstände, die im Eigentum des anderen Ehegatten stehen. Dem Ehegatten, in dessen Eigentum mit einem gegen den anderen Ehegatten ergangenen Titel vollstreckt wurde, steht nicht die Vollstreckungserinnerung nach § 766 ZPO zu, da die Vollstreckung wegen der Gewahrsamsfiktion des § 739 ZPO rechtmäßig war. Da es sich bei § 1362 um eine Vermutung i.S.v. § 292 ZPO handelt, hat der Ehegatte, der Eigentümer der gepfändeten Sache ist, die Möglichkeit, die Vermutung im Wege der Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO zu widerlegen. Das kann dadurch erfolgen, dass er darlegt, dass er den Gegenstand im eigenen Namen erworben bzw. der Gegenstand ihm schon vor der Eheschließung gehört hat. Im letzten Fall gilt für das Fortbestehen des Eigentums die Vermutung des § 1006.[69]
Beispiel
Gegen den Ehemann ergeht ein rechtskräftiges Urteil, durch das er verurteilt wird, 10 000 € an seinen Gläubiger G zu zahlen. Da der Ehemann nicht zahlungskräftig ist, pfändet der Gerichtsvollzieher ein wertvolles Bild in der Ehewohnung. Die Ehefrau wendet ein, das Bild stünde in ihrem Alleineigentum. Der Gerichtsvollzieher ist dennoch berechtigt, das Bild zu pfänden, da die Eigentumsvermutung des § 1362 eingreift. Da die Vollstreckung wegen der Gewahrsamsfiktion des § 739 ZPO rechtmäßig war, steht der Ehefrau keine Vollstreckungserinnerung nach § 766 ZPO zu. Sie muss vielmehr die Drittwiderspruchsklage gemäß § 771 ZPO erheben und in diesem Rechtstreit die Vermutung des § 1362 widerlegen, indem sie ihr Alleineigentum beweist.
77
Die Eigentumsvermutung gilt nach § 1362 Abs. 1 S. 2 nicht, wenn die Ehegatten getrennt leben und die Gegenstände, die gepfändet werden sollen, sich im Besitz des Ehegatten befinden, der nicht Schuldner ist. Für Sachen, die ausschließlich zum persönlichen Gebrauch eines Ehegatten bestimmt sind, wird nach § 1362 Abs. 2 vermutet, dass sie dem Ehegatten gehören, für dessen Gebrauch sie bestimmt sind.
Beispiel
Kleidung, Schmuck (sofern er nicht zur Kapitalanlage der Ehegatten erworben wurde).
Hinweis
Die Rechtsprechung[70] wendet die Vorschrift des § 1362 nicht analog auf die nichteheliche Lebensgemeinschaft an, da eine Regelungslücke wegen der Nichtplanwidrigkeit insoweit fehle. In der Literatur[71] wird dies zum Teil im Hinblick auf Art. 6 Abs. 1 GG gefordert.
1. Teil Familienrecht › C. Die Ehe › VI. Ehename
VI. Ehename
78
Nach § 1355 Abs. 1 S. 1 sollen die Ehegatten einen gemeinsamen Ehenamen führen. Zu einem gemeinsamen Ehenamen sind sie indes nicht verpflichtet. Sie können auch den zur Zeit der Eheschließung geführten Namen nach der Eheschließung behalten, § 1355 Abs. 1 S. 2. Zum Ehenamen kann nach § 1355 Abs. 2 auch ein Name erklärt werden, den einer der Ehegatten durch eine Heirat erworben hatte. Der Ehegatte, dessen Namen nicht Ehenamen wird, kann seinen Namen nach § 1355 Abs. 4 S. 1 dem Ehenamen voranstellen oder anfügen. Dazu ist er allerdings nicht berechtigt, wenn der Ehenamen bereits aus mehreren Namen besteht, § 1355 Abs. 4 S. 2. Nach der Entscheidung des BVerfG[72] greift dieses Verbot zwar in das Persönlichkeitsrecht der Ehegatten ein, dies sei aber ein legitimer Zweck zur Erhaltung der identitätsstiftenden Funktion des Namens. Wird ein Ehegatte, der seinen Geburtsnamen dem Ehenamen vorangestellt hat, adoptiert, hat dies auch Auswirkungen auf den Ehenamen. Der BGH[73] hält die Vorschriften der §§ 1767 Abs. 2, 1757 Abs. 1 für zwingend mit der Folge, dass sich der Begleitname automatisch in den durch die Adoption geänderten Geburtsnamen wandelt.
1. Teil Familienrecht › C. Die Ehe › VII. Eheliche Unterhaltspflichten