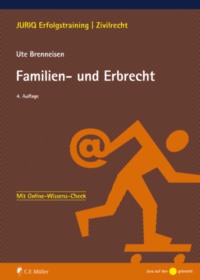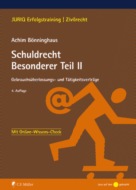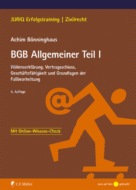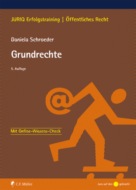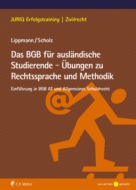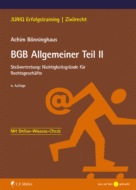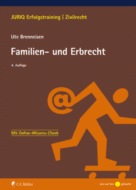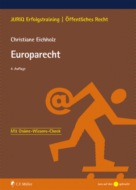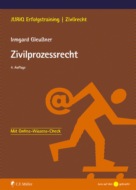Kitabı oku: «Familien- und Erbrecht», sayfa 6
VII. Eheliche Unterhaltspflichten
79
Durch die Ehe ergeben sich drei unterschiedliche Arten von Unterhaltsansprüchen:

[Bild vergrößern]
80
Die Voraussetzungen des Scheidungsunterhalts werden in Zusammenhang mit den Rechtsfolgen der Scheidung dargestellt.
1. Familienunterhalt
81
Nach § 1360 S. 1 sind die Ehegatten während der Ehe gegenseitig verpflichtet, für ihren angemessenen Lebensbedarf und für den Lebensbedarf der gemeinsamen Kinder zu sorgen. Anspruchsberechtigt ist jeder Ehegatte, so dass der Kindesunterhalt im eigenen Namen von einem Ehegatten gegenüber dem anderen Ehegatten geltend gemacht werden kann.
Aus der Vorschrift des § 1360 ergibt sich aber kein eigener Anspruch der Kinder gegen die Eltern. Der Unterhaltsanspruch der Kinder ist in §§ 1601 ff. geregelt. Der aus § 1360 S. 1 sich ergebende Unterhaltsanspruch kann nach § 1360 S. 2 auch in Natur in Form der Haushaltsführung geleistet werden (siehe oben unter Rn. 32). Nach § 1360a Abs. 2 S. 2 ist das dafür erforderliche Haushaltsgeld von dem anderen Ehegatten vorzuleisten. Zu dem Anspruch auf Familienunterhalt gehört auch das Taschengeld des den Haushalt führenden Ehegatten.
82
Ein Verzicht auf den Familienunterhalt ist für die Zukunft nicht möglich §§ 1360a Abs. 3, 1614 Abs. 1. Für die Vergangenheit kann Familienunterhalt nur unter den Voraussetzungen des § 1613 i.V.m. § 1360a Abs. 3 gefordert werden. Leistet ein Ehegatte mehr Unterhalt als er verpflichtet ist, ist nach § 1360b im Zweifel anzunehmen, dass er nicht beabsichtigt, von dem anderen Ehegatten Ersatz zu verlangen. Die Vorschrift ergänzt §§ 685 Abs. 1, 814. Nach § 1360a Abs. 4 hat ein Ehegatte, der nicht in der Lage ist, die Kosten eines Rechtsstreits in einer persönlichen Angelegenheit zu tragen, einen Anspruch gegen den anderen Ehegatten auf einen Vorschuss der Prozesskosten.[74]
2. Trennungsunterhalt
83
Im Fall der Trennung der Ehegatten tritt nach §§ 1361 Abs. 1 S. 1, 1361 Abs. 4 S. 1, S. 2 an die Stelle des Familienunterhalts der Trennungsunterhalt, der bis zum Zeitpunkt der Rechtskraft der Scheidung geltend gemacht werden kann. Ein Getrenntleben i.S.v. § 1567 liegt vor, wenn die Eheleute die eheliche Lebensgemeinschaft aufgegeben haben. Davon ist auszugehen, wenn zwischen ihnen keine häusliche Gemeinschaft mehr besteht (objektives Element) und ein Ehegatte sie auch erkennbar nicht mehr herstellen will (subjektives Element). Bei dem Trennungswillen handelt es sich um einen natürlichen Willen, für den eine Geschäftsfähigkeit nicht erforderlich ist.[75] Führen die Ehegatten keinen gemeinsamen Haushalt mehr und bestehen zwischen ihnen auch keine persönlichen Beziehungen mehr, so kann ein Getrenntleben auch innerhalb der gemeinsamen Ehewohnung möglich sein.[76] Ein Getrenntleben der Ehegatten liegt dagegen nicht vor, wenn die Ehegatten nur aus beruflichen Gründen getrennte Wohnsitze haben oder sich ein Ehegatte längere Zeit in einem Sanatorium oder in einer Haftanstalt aufhält. In diesen Fällen fehlt es an dem subjektiven Willen der Ehegatten, die eheliche Lebensgemeinschaft aufzugeben.
84
Ein Anspruch auf Gewährung von Trennungsunterhalt setzt voraus, dass der Ehegatte bedürftig ist. Das ist nicht der Fall, wenn der Ehegatte aus eigenen Mitteln seinen Lebensunterhalt bestreiten kann.[77] Die Bedürftigkeit eines Ehegatten kann nach § 1361 Abs. 2 dadurch gemindert sein, dass er es unterlässt, eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuführen. Im Rahmen des Trennungsunterhalts sind jedoch geringere Anforderungen an die Erwerbspflicht des bedürftigen Ehegatten zu stellen, da vor Rechtskraft der Scheidung die eheliche Solidargemeinschaft noch besteht.[78] Einkünfte aus einer überobligationsmäßigen Tätigkeit muss sich der Ehegatte nicht anrechnen lassen.[79]
85
Der unterhaltspflichtige Ehegatte muss zudem entsprechend leistungsfähig sein. Davon kann nur ausgegangen werden, wenn ihm ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, durch die sein eigener Unterhaltsbedarf nach Zahlung des Unterhalts an den bedürftigen Ehegatten gesichert ist (Selbstbehalt). Ist der Unterhaltspflichtige leistungsfähig, so hat er 3/7 seines Einkommens an den Unterhaltsberechtigten zu zahlen. Er hat nicht die Hälfte seines Einkommens als Unterhalt zu zahlen, da ihm 1/7 seines Einkommens als Bonus für seine Erwerbstätigkeit zu belassen ist.
86
Der Anspruch auf Trennungsunterhalt ist auf Zahlung einer Geldrente gerichtet. Die Vorschrift des § 1361 Abs. 4 verweist auf § 1360a Abs. 3, Abs. 4, so dass die im Rahmen des Familienunterhalts gemachten Ausführungen zu dieser Norm auch für den Trennungsunterhalts gelten.
87
Die Höhe des Unterhaltsanspruchs richtet sich nach den ehelichen Lebensverhältnissen, die von dem in der Ehe verfügbaren Einkommen geprägt werden. Dabei ist nicht auf den Zeitpunkt der Trennung, sondern auf die jeweils aktuellen Einkommensverhältnisse abzustellen. Das gilt nur dann nicht, wenn der Einkommensverlust des unterhaltspflichtigen Ehegatten auf einer freiwilligen beruflichen oder wirtschaftlichen Disposition beruht. In diesen Fällen wird ihm ein fiktives Einkommen unterstellt.[80] Zu dem Unterhaltsanspruch gehört auch der Vorsorgeunterhalt für die Übernahme der Kosten, die für eine angemessene Versicherung für den Fall des Alters sowie der verminderten Erwerbsfähigkeit entstehen, § 1361 Abs. 1 S. 2. Der Unterhaltsanspruch umfasst auch einen etwaigen Sonderbedarf, §§ 1360a Abs. 4, 1361 Abs. 4.
88
Nach § 1361 Abs. 3 findet im Rahmen des Trennungsunterhalts auch die Vorschrift des § 1579 Nr. 2–7 Anwendung. Danach kann der Unterhalt versagt, herabgesetzt oder zeitlich beschränkt werden, wenn die in § 1579 Nr. 2–7 aufgeführten Voraussetzungen vorliegen. Da § 1361 Abs. 3 nicht auf § 1579 Nr. 1 verweist, kann auch nach kurzer Ehe Trennungsunterhalt verlangt werden.
3. Hausrat und Ehewohnung während des Getrenntlebens
89
Jeder Ehegatte kann bei der Trennung nach § 1361a Abs. 1 S. 1 die ihm gehörenden Haushaltsgegenstände von dem anderen Ehegatten verlangen. Der Eigentümer ist allerdings verpflichtet, sie dem anderen Ehegatten zum Gebrauch zu überlassen, soweit dieser sie zur Führung eines abgesonderten Hausrats benötigt und die Überlassung der Billigkeit entspricht, § 1361a Abs. 1 S. 2. Haushaltsgegenstände, die den Ehegatten gemeinsam gehören, werden zwischen Ihnen nach den Grundsätzen der Billigkeit verteilt, § 1361a Abs. 1 S. 2. Soweit die Ehegatten sich nicht einigen können, kann eine gerichtliche Entscheidung nach §§ 200 ff. FamFG erfolgen.
90
Ein Ehegatte kann die Zuweisung der Ehewohnung oder einen Teil zur alleinigen Benutzung nach § 1361b Abs. 1 S. 1 verlangen, soweit dies unter Berücksichtigung der Belange des anderen Ehegatten notwendig ist, um eine unbillige Härte zu vermeiden. Eine unbillige Härte kann sich daraus ergeben, dass das Wohl der im Haushalt lebenden Kinder beeinträchtigt ist, § 1361b Abs. 1 S. 2. Der aus der Wohnung weichende Ehegatte kann nach § 1361b Abs. 3 einen Entschädigungsanspruch haben. Auch hinsichtlich der Ehewohnung kann eine gerichtliche Entscheidung nach den §§ 200 ff. FamFG ergehen.

Online-Wissens-Check
Wissen Sie noch, unter welchen Voraussetzungen ein Ehegatte aufgrund eines Rechtsgeschäfts des anderen Ehegatten mitverpflichtet wird?
Überprüfen Sie jetzt online Ihr Wissen zu den in diesem Abschnitt erarbeiteten Themen.
Unter www.juracademy.de/skripte/login steht Ihnen ein Online-Wissens-Check speziell zu diesem Skript zur Verfügung, den Sie kostenlos nutzen können. Den Zugangscode hierzu finden Sie auf der Codeseite.
Anmerkungen
[1]
am 1.10.2017.
[2]
BGBl. I 2017, 2787; BT-Drs. 18/12989, BT-Drs. 18/6665.
[3]
BGBl. I 2017, 2787; BT-Drs. 18/6665.
[4]
Palandt-Brudermüller § 1313 Rn. 5.
[5]
BGH Urt. v. 18.11.2009 (Az. XII ZR 173/06) = FamRZ 2010, 269; BGH Urt. v. 18.5.2011 (Az. XII ZR 67/09) = NJW 2011, 2725.
[6]
RG Urt. v. 22.1.1903 (Az. IV 288/02) = RGZ 53, 337.
[7]
BGH Urt. v. 4.11.1987 (Az. IVb ZR 83/86) = NJW 1988, 2032.
[8]
BGH Urt. v. 14.3.1962 (Az. IV ZR 253/61) = BGHZ 37, 38.
[9]
BGH Urt. v. 26.2.1954 (Az. V ZR 135/52) = BGHZ 12, 380.
[10]
Siehe zum Besitz ausführlich im Skript „Sachenrecht II“ Rn. 34 ff.
[11]
OLG Bremen Beschl. v. 19.9.2014 (Az. 4 UF 40/14) = NJW 2015, 495.
[12]
BGH Urt. v. 4.11.1987 (Az. IVb ZR 83/86) = NJW 1988, 2032.
[13]
MüKo-Roth § 1353 Rn. 6.
[14]
BGH Urt. v. 26.11.1968 (Az. VI ZR 189/67) = BGHZ 51, 109.
[15]
BGH Urt. v. 13.7.1971 (Az. VI ZR 31/70) = NJW 1971, 2066.
[16]
BGH Beschl. v. 9.7.1968 (Az. GSZ 2/67) = BGHZ 50, 304; BGH Urt. v. 3.2.2009 (Az. VI ZR 183/08) = FamRZ 2009, 596.
[17]
BGH Urt. v. 22.9.1970 (Az. VI ZR 28/69) = BGHZ 54, 269.
[18]
BGH Urt. v. 1.12.1978 (Az. VII ZR 91/77) = NJW 1979, 598.
[19]
BGH Urt. v. 25.9.1962 (Az. VI ZR 244/61) = BGHZ 38, 55.
[20]
BGH Urt. v. 25.6.2003 (Az. XII ZR 161/01) = NJW 2003, 2982 m.w.N.
[21]
BGH Urt. v. 25.6.2003 (Az. XII ZR 161/01) = NJW 2003, 2982 m.w.N.
[22]
Palandt-Sprau § 733 Rn. 10.
[23]
BGH Urt. v. 13.7.1994 (Az. XII ZR 1/93) = NJW 1994, 2545.
[24]
BGH Urt. v. 18.9.2009 (Az. XII ZR 176/06) = NJW 2010, 1879.
[25]
MüKo-Roth § 1353 Rn. 52.
[26]
BGH Urt. v. 26.6.1952 (Az. IV ZR 228/51) = BGHZ 6, 360.
[27]
RG Urt. v. 22.4.1909 (Az. VI 27/09) = RGZ 71, 85.
[28]
BGH Urt. v. 26.6.1952 (Az. IV ZR 54/52) = LM Nr. 2 zu § 823 (Af).
[29]
BGH Urt. v. 30.1.1957 (Az. IV ZR 279/56) = BGHZ 27, 215; BGH Urt. v. 19.12.1989 (Az. IVb ZR 56/88) = FamRZ 1990, 367.
[30]
BGH Urt. v. 19.12.1989 (Az. IVb ZR 56/88) = FamRZ 1990, 367; BGH Beschl. v. 2.7.2014 (Az. XII ZB 201/1) = juris Rn. 13.
[31]
BGH Urt. v. 8.4.1981 (Az. IVb ZR 584/80) = BGHZ 80, 235.
[32]
RG Urt. v. 23.4.1936 (Az. IV 304/35) = RGZ 151, 160; BGH Urt. v. 26.6.1952 (Az. IV ZR 228/51) = BGHZ 6, 360.
[33]
BGH Urt. v. 26.6.1952 (Az. IV ZR 228/51) = BGHZ 6, 360; BGH Urt. v. 26.6.1952 (Az. IV ZR 54/52) = LM Nr. 2 zu § 823 (Af).
[34]
BGH Urt. v. 26.6.1952 (Az. IV ZR 228/51) = BGHZ 6, 360; BGH Urt. v. 6.2.1957 (Az. IV ZR 263/56) = BGHZ 23, 279; BGH Urt. v. 8.1.1958 (Az. IV ZR 173/57) = BGHZ 26, 217; BGH Urt. v. 3.11.1971 (Az. IV ZR 86/70) = BGHZ 57, 229; BGH Urt. v. 8.4.1981 (Az. IVb ZR 584/80) = FamRZ 1981, 531.
[35]
Böhmer AcP 155, 181; Schwab Jus 1961, 142; Bosch FamRZ 1958, 101.
[36]
BGH Urt. v. 19.12.1989 (Az. IVb ZR 56/88) = FamRZ 1990, 367.
[37]
BGH Urt. v. 8.1.1958 (Az. IV ZR 173/57) = BGHZ 26, 217.
[38]
BGH Urt. v. 3.11.1971 (Az. IV ZR 86/70) = BGHZ 57, 229.
[39]
BGH Urt. v. 11.1.2012 (Az. XII ZR 194/09) = NJW 2012, 852; BGH Urt. vom 9.11.2011 (Az. XII ZR 136/09) = BGHZ 191, 259.
[40]
BGH Beschl. v. 2.7.2014 (Az. XII ZB 201/1) = juris Rn. 13.
[41]
BGH Beschl. v. 20.2.2013 (Az. XII ZB 412/1) = BGHZ 196, 207.
[42]
BT-Drs. 7/650 S. 98 f.
[43]
BGH Urt. v. 15.5.1991 (Az. VIII ZR 212/90) = NJW 1991, 2958.
[44]
BGH Urt. v. 13.3.1991 (Az. XII ZR 53/90) = BGHZ 114, 74; Palandt-Brudermüller § 1357 Rn. 19.
[45]
BGH Urt. v. 13.3.1991 (Az. XII ZR 53/90) = BGHZ 114, 74.
[46]
Siehe dazu Skript „Schuldrecht AT I“ Rn. 108 ff.
[47]
Palandt-Brudermüller § 1357 Rn. 22.
[48]
Palandt-Brudermüller § 1357 Rn. 22.
[49]
MüKo-Roth § 1357 Rn. 41; Ermann-Kroll-Ludwig § 1357 BGB Rn. 20.
[50]
Siehe dazu Skript „Schuldrecht AT I“ Rn. 78 f.
[51]
BGH Urt. v. 25.3.1982 (Az. VII ZR 60/81) = BGHZ 83, 293.
[52]
Palandt-Brudermüller § 1357 Rn. 21.
[53]
MüKo-Roth § 1357 Rn. 41.
[54]
BGH Urt. v. 13.3.1991 (Az. XII ZR 53/90) = FamRZ 1979, 469.
[55]
BGH Urt. v. 3.2.1985 (Az. IVb ZR 72/83) = FamRZ 1985, 576.
[56]
Palandt-Brudermüller § 1357 Rn. 11 m.w.N.
[57]
Palandt-Grüneberg § 312 Rn. 29; MüKo-Roth § 1357 Rn. 34.
[58]
Müko-Roth § 1357 Rn. 30 ff.
[59]
Palandt-Brudermüller § 1357 Rn. 11; a.A. MüKo-Roth § 1357 Rn. 28.
[60]
BGH Urt. v. 28.2.2018 (Az. XII ZR 94/17) = BGHZ 218, 34.
[61]
BGH Urt. v. 27.11.1991 (Az. XII ZR 226/90) = NJW 1992, 909.
[62]
BGH Urt. v. 27.11.1991 (Az. XII ZR 226/90) = BGHZ 116, 184.
[63]
BGH Urt. v. 13.2.1985 (Az. IVb ZR 72/83) = BGHZ 94, 1.
[64]
BGH Urt. v. 13.2.1985 (Az. IVb ZR 72/83) = BGHZ 94, 1.
[65]
Palandt-Brudermüller § 1357 Rn. 18.
[66]
BGH Urt. v. 27.11.1991 (Az. XII ZR 226/90) = BGHZ 116, 184.
[67]
BGH Urt. v. 13.1.1988 (Az. IVb ZR 110/86) = FamRZ 1988, 476; BGH Urt. v. 24.3.2009 (Az. VI ZR 79/08) = FamRZ 2009, 1048.
[68]
BGH Urt. v. 13.1.1988 (Az. IVb ZR 110/86) = NJW 1988, 1208.
[69]
Palandt-Herrler § 1006 Rn. 9.
[70]
BGH Urt. v. 14.12.2006 (Az. IX ZR 92/05) = BGHZ 170, 187.
[71]
Palandt-Brudermüller § 1362 Rn. 1.
[72]
BVerfG Urt. v. 5.5.2009 (Az. 1 BvR 1155/03) = NJW 2009, 1657.
[73]
BGH Beschl. v. 17.8.2011 (Az. XII ZB 656/10) = NJW 2011, 3094.
[74]
OLG München Beschl. v. 13.9.2005 (Az. 16 WF 1542/05) = NJW-RR 2006, 292.
[75]
Palandt-Brudermüller § 1567 Rn. 5.
[76]
BGH Urt. v. 13.3.1991 (Az. XII ZR 53/90) = FamRZ 1979, 469.
[77]
BGH Urt. v. 5.9.2001 (Az. XII ZR 336/99) = FamRZ 2001, 1693.
[78]
BGH Urt. v. 29.11.2000 (Az. XII ZR 212/9) = NJW 2001, 974.
[79]
OLG Karlsruhe Urt. v. 14.12.2001 (Az. 2 UF 212/00) = NJW 2002, 900.
[80]
BGH Urt. v. 18.3.1992 (Az. XII ZR 23/91) = NJW 1992, 2479.
1. Teil Familienrecht › D. Eheliches Güterrecht
D. Eheliches Güterrecht
91
Das Familienrecht enthält folgende Güterstände:

[Bild vergrößern]
1. Teil Familienrecht › D. Eheliches Güterrecht › I. Zugewinngemeinschaft
I. Zugewinngemeinschaft
92
Die Ehegatten leben nach § 1363 Abs. 1 im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, wenn sie nicht durch einen Ehevertrag nach § 1408 Abs. 1 etwas anderes vereinbart haben. Die Zugewinngemeinschaft beinhaltet die Vermögenstrennung der Ehegatten (§§ 1363 Abs. 2 S. 1, 1364 Hs. 1), Verfügungsbeschränkungen (§§ 1364 Hs. 2, 1365, 1369) und im Falle der Beendigung der Zugewinngemeinschaft einen Zugewinnausgleich (§§ 1363 Abs. 2 S. 2, 1371, 1390).
1. Vermögenstrennung
93
Bei dem gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft bleibt das Vermögen der Ehefrau und des Ehemannes während der Ehe getrennt. Das gilt für Vermögen, das in die Ehe von den Ehegatten eingebracht worden ist, sowie für das Vermögen, das erst während der Ehe von einem der Ehegatten erworben wurde, § 1363 Abs. 2 S. 1. Durch die Eheschließung entsteht kein gemeinschaftliches Eigentum der Ehegatten. Dieses kann nur nach allgemeinen Grundsätzen durch Rechtsgeschäft entstehen.
Beispiel
Die Ehegatten kaufen während der Ehe ein Haus oder Hausratsgegenstände, an dem sie Miteigentum nach Bruchteilen erwerben.
2. Verfügungsbeschränkungen
94
Nach § 1364 Hs. 1 kann jeder Ehegatte sein Vermögen und seine Einkünfte selbständig verwalten. Zur Erhaltung der wirtschaftlichen Grundlage der Familie und des Zugewinns wird dieser Grundsatz durch § 1364 Hs. 2 dahin eingeschränkt, dass die Ehegatten in der Verwaltung ihres Vermögens nach §§ 1365 ff. beschränkt werden.
a) Zustimmungspflicht des anderen Ehegatten, § 1365
95
Zustimmungsbedürftiger Verpflichtungsvertrag, §§ 1365 f.
I.Vertragsschluss mit Inhalt: „Verpflichtung zu Verfügung über Vermögen im Ganzen“
Verträge über einzelne VermögensgegenständeRn. 100
II.Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen (z. B. §§ 125, 311b Abs. 1–3)
III.(Schwebende) Unwirksamkeit nach § 1366 Abs. 1, Abs. 4?
1.Wirksame Ehe und Güterstand der Zugewinngemeinschaft
2.(Keine) Einwilligung des Ehegatten, § 1365 Abs. 1 S. 1?
3.(Verweigerung der) Genehmigung?
a)Genehmigung gegenüber handelndem Ehegatten?
(Achtung: Unwirksamkeit nach § 1366 Abs. 3 S. 1?)
b)Altern.: Genehmigung gegenüber Vertragspartner?
c)Gerichtlicher Zustimmungsbeschluss gem. § 1365 Abs. 2? (Achtung: Unwirksamkeit nach § 1366 Abs. 3 S. 3?)
d)(Kein) vorheriger Widerruf des anderen Teils nach § 1366 Abs. 2?
Scheidung oder Tod während SchwebezustandRn. 106
aa) Wirkungen der §§ 1365 ff.
96
Gemäß § 1365 bedarf der Ehegatte der Zustimmung des anderen Ehegatten, wenn er sich verpflichten will, über sein Vermögen als Ganzes zu verfügen oder eine solche Verpflichtung erfüllen will. Die in § 1365 Abs. 1 angeordnete Verfügungsbeschränkung der Ehegatten stellt ein absolutes Verfügungsverbot dar, da der Familienschutz höher eingestuft wird als der Verkehrsschutz.[1] Ein gutgläubiger Erwerb nach § 135 Abs. 2 ist von dem Eigentümer-Ehegatten nicht möglich, da die §§ 1365 ff. Spezialvorschriften zu § 134 sind.[2] Die Zustimmungspflicht erfasst sowohl das Verpflichtungs- als auch das Verfügungsgeschäft. Hat der zustimmungsberechtigte Ehegatte dem Verpflichtungsgeschäft zugestimmt, ist eine zusätzliche Zustimmung für das Verfügungsgeschäft nicht erforderlich.[3]
Hinweis
Bestand im Zeitpunkt des Abschlusses des Verpflichtungsgeschäfts keine Zustimmungspflicht, weil die Ehegatten zu diesem Zeitpunkt nur verlobt waren, und wird das Verfügungsgeschäft nach der Eheschließung abgeschlossen, ist nach h.M.[4] auch für das Erfüllungsgeschäft keine Zustimmung des anderen Ehegatten erforderlich.
bb) Rechtsgeschäft eines Ehegatten über sein Vermögen im Ganzen
97
Die Zustimmungspflicht des anderen Ehegatten besteht nur dann, wenn sich der Ehegatte verpflichtet, über sein Vermögen als Ganzes zu verfügen bzw. darüber verfügt. Die Vorschrift des § 1365 greift nicht ein, wenn ein Ehegatte sich lediglich im Rahmen einer Bürgschaft zu einer Geldzahlung verpflichtet, selbst wenn zur Erfüllung der Verbindlichkeit das gesamte Vermögen eingesetzt werden muss.[5] Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn die Eingehung der Verbindlichkeit allein deswegen erfolgt, um § 1365 zu umgehen.[6]
98

Es ist umstritten, wann sich eine Verfügung auf das Vermögen als Ganzes erstreckt.