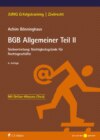Kitabı oku: «Familien- und Erbrecht», sayfa 9
cc) Endvermögen
144
Nach § 1375 Abs. 1 S. 1 ist Endvermögen das Vermögen, das einem Ehegatten nach Abzug aller Verbindlichkeiten bei der Beendigung des Güterstands gehört. Als maßgeblichen Ermittlungszeitpunkt nennt § 1375 Abs. 1 S. 1 zunächst die Beendigung des Güterstands. Nach der Neufassung des § 1384 tritt für die Berechnung des Zugewinns und für die Höhe der Ausgleichsforderung an die Stelle der Beendigung des Güterstandes der Zeitpunkt der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags.[71] Eine einschränkende Auslegung des § 1384 dahin, dass bei einem vom Ausgleichspflichtigen nicht zu verantwortenden Vermögensverlust die Begrenzung des § 1378 Abs. 2 S. 1 an die Stelle des § 1384 tritt, kommt nach der Rechtsprechung des BGH[72] nicht in Betracht. In einem solchen Fall soll aber § 1381 eine Korrektur grob unbilliger Ergebnisse ermöglichen. Darauf muss sich allerdings der Ausgleichspflichtige in dem gerichtlichen Verfahren berufen. Der Zeitpunkt der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags ist nur dann maßgebend, wenn die Scheidung den gesetzlichen Güterstand beendet. Haben die Ehegatten vor der Erhebung des Scheidungsantrags einen Ehevertrag geschlossen und dadurch den gesetzlichen Güterstand aufgehoben, ist dieser Zeitpunkt für die Berechnung des Endvermögens maßgebend.
145
Die Berechnung des Endvermögens erfolgt durch die Summierung aller Aktiva unter Abzug aller Verbindlichkeiten,[73] wobei das Endvermögen grundsätzlich auch negativ sein kann § 1375 Abs. 1 S. 2. Eine Gesamtschuld der Ehegatten wird jeweils zur Hälfte als Verbindlichkeit bei dem Endvermögen berücksichtigt. Steht dagegen fest, dass der von dem Gläubiger in Anspruch genommene Ehegatte seinen Ausgleichsanspruch aufgrund der Vermögenslosigkeit des anderen Ehegatten nicht durchsetzen kann, ist die gesamte Verbindlichkeit bei dem Endvermögen des zahlenden Ehegatten als Abzugsposten zu berücksichtigen[74].
Die Rechtspositionen, die bei der Ermittlung des Anfangsvermögens unberücksichtigt bleiben, werden auch nicht bei dem Endvermögen hinzugerechnet. Der Miteigentumsanteil an Hausrat, der den Ehegatten gemeinsam gehört, wird bei dem Endvermögen nicht berücksichtigt, da § 1568b vorrangig ist. Steht dagegen ein Hausratgegenstand im Alleineigentum eines Ehegatten, wird er im Rahmen des Zugewinnausgleiches berücksichtigt.
146
Der Berechnung des Endvermögens wird der Wert zugrunde gelegt, den das Vermögen bei Beendigung des Güterstands hatte. Bei der Wertermittlung sind auch Wertänderungen zu berücksichtigen, etwa wenn Ackerland nach der Eheschließung zum Bauland wird, Wertpapiere im Kurswert steigen oder sinken. Diese an sich eheneutralen Vorgänge wirken sich als echte Wertsteigerungen auch auf die Ausgleichsforderung aus.
Nach welcher Methode der Wert eines Unternehmens zu bewerten ist, ergibt sich nicht aus dem Gesetz. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH[75] ist die Ertragswertmethode, die immanent auch den ideellen Wert des Unternehmens abbildet, im Regelfall geeignet, als Bemessungsgrundlage für den Wert einer Unternehmensbeteiligung zu dienen. Der Ertragswert eines Unternehmens wird aus den nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelten nachhaltig ausschüttbaren Überschüssen berechnet, die kapitalisiert und auf den Bewertungsstichtag bezogen werden. Im Rahmen der Ertragswertmethode wird die Summe aller zukünftigen Erträge des fortgeführten Unternehmens ermittelt (Zukunftserfolgswert), und zwar durch eine Rückschau auf die Erträge des Unternehmens in den letzten Jahren. Auf dieser Grundlage wird eine Prognose zur Ertragslage der nächsten Jahre erstellt.
147
Sofern ein Unternehmen keine Überschüsse produziert, ist der Substanzwert eines Unternehmens heranzuziehen, der grundsätzlich mit dem Betrag zu bemessen ist, mit dem die Gesamtheit aller materiellen Wirtschaftsgüter im Falle eines Unternehmensverkaufs auf den gedachten Erwerber übergeht. Für den Substanzwert bzw. Reproduktionswert sind die Wiederbeschaffungspreise maßgeblich. Kann der zu bewertende Vermögensgegenstand nicht ohne weiteres wiederbeschafft werden, weil es für ihn keinen relevanten Gebrauchtgütermarkt gibt, kann der Wert hilfsweise durch Abschreibung aus dem Neupreis entwickelt werden. Die Heranziehung des Substanzwerts bzw. Reproduktionswerts für die Bemessung des Unternehmenswerts beruht allerdings auf der Grundannahme, dass das Unternehmen über den Bewertungsstichtag hinaus fortgeführt wird. Der Liquidationswert gilt in der Regel als unterste Grenze des Unternehmenswerts. Sein Ansatz kommt grundsätzlich dann in Betracht, wenn das Unternehmen zur Mobilisierung des Vermögens „versilbert“ werden muss, um den Zugewinnausgleich zahlen zu können, oder wenn dem Unternehmen wegen schlechter Ertragslage oder aus sonstigen Gründen keine günstige Fortführungsprognose gestellt werden kann.
148
Dem Endvermögen eines Ehegatten wird nach § 1375 Abs. 2 S. 1 der Betrag hinzugerechnet, um den sein Vermögen dadurch vermindert worden ist, dass er nach Eintritt des Güterstands unentgeltliche Zuwendungen gemacht hat, durch die er nicht einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprochen hat, Vermögen verschwendet hat oder Handlungen in der Absicht vorgenommen hat, den anderen Ehegatten zu benachteiligen. Der Tatbestand einer illoyalen Vermögensminderung ist nur dann schlüssig dargelegt, wenn der in Rede stehende Betrag nicht im Rahmen einer ordnungsgemäßen Lebensführung verbraucht worden sein kann.[76] Der Betrag der Vermögensminderung wird nach § 1375 Abs. 3 dem Endvermögen nur dann nicht hinzugerechnet, wenn sie mindestens 10 Jahre vor Beendigung des Güterstandes eingetreten ist oder wenn der andere Ehegatte mit der unentgeltlichen Zuwendung oder Verschwendung des Vermögens einverstanden war. Ist das Endvermögen eines Ehegatten geringer als das Vermögen, das er in der Auskunft zum Trennungszeitpunkt angegeben hat, so hat er nach § 1375 Abs. 2 S. 2 darzulegen und zu beweisen, dass die Vermögensminderung nicht auf Handlungen i.S.v. § 1375 Abs. 2 S. 1 Nr. 1–3 zurückzuführen ist.
Beispiel
Die Ehegatten haben während der Ehe folgenden Zugewinn erzielt:
| Ehemann | Ehefrau | |
|---|---|---|
| Anfangsvermögen | 60 000 € | 20 000 € |
| Endvermögen | 80 000 € | 20 000 € |
| Zugewinn | 20 000 € | 0 € |
Der Ehemann hat 2 Jahre vor der Scheidung seiner Geliebten Schmuck geschenkt, der im Zeitpunkt der Schenkung 20 000 € wert war. Hierbei handelt es sich um eine unentgeltliche Zuwendung i.S.v. § 1375 Abs. 2, die seinem Endvermögen zuzurechnen ist:
| Ehemann | Ehefrau | |
|---|---|---|
| Anfangsvermögen | 60 000 € | 20 000 € |
| Endvermögen | 100 000 € | 20 000 € |
| Zugewinn | 40 000 € | 0 € |
Der Ausgleichsanspruch der Ehefrau beträgt daher 40 000 € : 2 = 20 000 €
149
Nach § 1378 Abs. 2 S. 1 wird die Höhe der Ausgleichsforderung durch den Wert des Vermögens begrenzt, das nach Abzug der Verbindlichkeiten bei Beendigung des Güterstands vorhanden ist. Sinn und Zweck dieser Begrenzung ist der Schutz der übrigen Gläubiger des Ehegatten, denen durch den Ausgleich nicht ihre Haftungsmasse entzogen und damit die Durchsetzung ihrer Forderungen erschwert werden soll. Die Begrenzung der Ausgleichsforderung erhöht sich allerdings nach § 1378 Abs. 2 S. 2 in den in § 1375 Abs. 2 S. 1 genannten Fällen um den dem Endvermögen hinzuzurechnenden Betrag.
Unter den Voraussetzungen des § 1390 kann sich der ausgleichsberechtigte Ehegatte auch an einen Dritten halten. Nach § 1390 Abs. 1 kann der ausgleichsberechtigte Ehegatte von dem Dritten Wertersatz verlangen, wenn der ausgleichsverpflichtete Ehegatten dem Dritten in der Absicht eine unentgeltliche Zuwendung gemacht hat, den Ausgleichsgläubiger zu benachteiligen. Unerheblich ist dabei, ob der Dritte die Benachteiligungsabsicht kannte.
dd) Anrechnung von Vorausempfängen, § 1380
150
Auf die Ausgleichsforderung eines Ehegatten wird nach § 1380 Abs. 1 S. 1 angerechnet, was ihm von dem anderen Ehegatten durch Rechtsgeschäft unter Lebenden mit der Bestimmung zugewendet ist, dass es auf die Ausgleichsforderung angerechnet werden soll. Nach § 1380 Abs. 1 S. 2 wird im Zweifel angenommen, dass diejenigen Zuwendungen angerechnet werden sollen, die den Wert von Gelegenheitsgeschenken übersteigen, die nach den Lebensverhältnissen der Ehegatten üblich sind. Die Vorschrift des § 1380 setzt weiter voraus, dass der Zuwendungsempfänger auch Gläubiger der Ausgleichsforderung ist.
Die Anrechnungsbestimmung muss vor oder bei der Zuwendung getroffen werden. Später können nur noch beide Ehegatten gemeinsam eine Anrechnung vereinbaren und zwar in der Form des § 1378 Abs. 3 S. 2.[77] Bei der Berechnung des Zugewinnausgleichs wird nach § 1380 Abs. 2 die Zuwendung bei der Berechnung der Ausgleichsforderung dem Zugewinn des Ehegatten hinzugerechnet, der die Zuwendung gemacht hat. Der Wert bestimmt sich nach dem Zeitpunkt der Zuwendung.
Nach § 1380 Abs. 2 wird die Zuwendung hypothetisch dem Zugewinn des Zuwendenden hinzugerechnet und dann als Leistung an Erfüllungs statt von der Ausgleichsforderung abgezogen.
Hinweis
Der Grund für den Abzug der Schenkung vom Zugewinn des Beschenkten ist darin zu sehen, dass die Schenkung für die Berechnung der Ausgleichsforderung neutralisiert werden muss. Ansonsten würde sie sowohl bei dem Zugewinn des Zuwendenden als auch bei dem Zugewinn des Beschenkten berücksichtigt.[78]
151
Zu dem gleichen Ergebnis kommt man, wenn das Zugewandte dem Anfangsvermögen des Empfängers und seinem Endvermögen zugerechnet wird. Diese Methode scheidet allerdings aus, wenn § 1374 Abs. 2 weder nach seinem Sinn, noch seinem Wortlaut anwendbar ist, also insbes. bei sog. unbenannten Zuwendungen.[79] Es empfiehlt sich daher, die Zuwendung mit ihrem auf den Zurechnungszeitpunkt bezogenen Wert aus dem Endvermögen des Empfängers heraus zu rechnen.[80]
Beispiel
Während des Bestehens der Zugewinngemeinschaft hat der Ehemann seiner Ehefrau anrechnungspflichtig 10 000 € zugewandt. Die Ehegatten haben folgenden Zugewinn erzielt:
| Ehemann | Ehefrau | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Endvermögen (ohne Zuwendung) | 50 000 € | Endvermögen (inkl. der Zuwendung) | 25 000 € | ||
| – | Anfangsvermögen des Ehemanns | 20 000 € | – | Anfangsvermögen der Ehefrau | 0 € |
| = | Zugewinn | 30 000 € | = | Zugewinn | 25 000 € |
| + | Zuwendung | 10 000 € | – | Zuwendungsersatz | 10 000 € |
| = | Zugewinn unter Einbeziehung v. § 1380 Abs. 2 S. 1 | 40 000 € | = | Zugewinn nach Abzug des Zuwendungsersatzes | 15 000 € |
| Zugewinnsaldo der Ehegatten | ||||
| Ehemann | 40 000 € | |||
| – | Ehefrau | 15 000 € | ||
| = | Zugewinnsaldo | 25 000 € | ||
| Ausgleichsforderung der Ehefrau vor Anrechnung (25 000 € : 2) | 12 500 € |
| Ausgleichsforderung nach der Anrechnung (12 500 € – 10 000 €) | 2 500 € |
152
Wenn der Zugewinn des Empfängers geringer ist als der Wert der Zuwendung, kommt § 1380 mit der Folge zur Anwendung, dass der Wert der Zuwendung nicht unter 0 anzusetzen ist.[81]
Beispiel
Beträgt das beiderseitige Anfangsvermögen der Ehegatten 0 €, das Endvermögen des Ehemanns 100 000 € und der Ehefrau 20 000 €, so steht der Ehefrau grundsätzlich ein Ausgleichsanspruch in Höhe von 40 000 € zu (100 000 € – 20 000 € = 80 000 € : 2). Hat sie während des Bestehens der Zugewinngemeinschaft von dem Ehemann eine Zuwendung in Höhe von 50 000 € anrechnungspflichtig erhalten, so erhöht sich der Zugewinn des Ehemanns um den Wert der Zuwendung und beträgt daher 150 000 €, während der Zugewinn der Ehefrau nur 20 000 € beträgt. Würde man in diesem Fall der Ehefrau die Zuwendung in Höhe von 50 000 € anrechnen, so hätte sie einen negativen Zugewinn von 30 000 €. Da jedoch ein negativer Zugewinn nicht möglich ist, wird in diesen Fällen ihr Zugewinn mit 0 € angesetzt. Das hat zur Folge, dass sie sich auf ihren Zugewinnausgleichsanspruch in Höhe von 75 000 € die Zuwendung von 50 000 € anrechnen lassen muss, so dass ihr Zugewinn 25 000 € beträgt.
153
Wenn die Zuwendung nicht mehr im Endvermögen des Empfängers vorhanden ist, ist umstritten, ob die Zuwendung auch in diesen Fällen von dem Zugewinn des Empfängers abzuziehen ist. Nach h.M.[82] trägt das Risiko eines Untergangs oder einer Verschlechterung des Zuwendungsgegenstandes (bzw. seines Surrogats) der Empfänger. Aus diesem Grund wird auch bei einem ersatzlosen teilweisen oder vollständigen Untergang des Zuwendungsgegenstands der Wert der Zuwendung angerechnet. Im obigen Beispiel würde sich daher an der Höhe des Zugewinnausgleichsanspruchs durch den Untergang des Zuwendungsgegenstands nichts ändern.
154
Die Vorschrift des § 1380 findet indes keine Anwendung, wenn schon nach den allgemeinen Berechnungsvorschriften der Zuwender nicht den größeren Zugewinn erzielt hat.[83] Dieses Ergebnis ergibt sich aus dem Wortlaut des § 1380 Abs. 1 S. 1, wonach der Ausgleichspflichtige dem Ausgleichsberechtigten eine Zuwendung gemacht haben muss.
Beispiel
Ist das beiderseitige Anfangsvermögen der Ehegatten 0 €, das Endvermögen des Ehemanns 80 000 € und der Ehefrau 100 000 €, so steht dem Ehemann grundsätzlich ein Ausgleichsanspruch in Höhe von 10 000 € zu (100 000 € – 80 000 € = 20 000 € : 2). Hatte der Ehemann der Ehefrau eine Zuwendung von 30 000 € gemacht, so würde sich bei Anwendung des § 1380 der Zugewinn der Ehefrau auf 70 000 € ermäßigen. Der Zugewinn des Ehemannes wäre fiktiv um 30 000 € erhöht und würde daher 110 000 € betragen. Der Zugewinn der Ehefrau beträgt nach Anrechnung der Zuwendung 0 €, da die Ehefrau einen negativen Zugewinn von 10 000 € (110 000 € – 70 000 € = 40 000 € : 2 = 20 000 € – 30 000 € = -10 000 €) erzielt hat. Durch die Anwendung des § 1380 wäre der Ehemann benachteiligt, da er in diesem Fall seinen Zugewinnausgleichsanspruch in Höhe von 10 000 € verloren hätte.
b) Verjährung
155
Die Vorschrift des § 1378 Abs. 4 in der Fassung vom 6.7.2009, wonach die Ausgleichsforderung in drei Jahren verjährte, ist durch Art. 1 Nr. 5 des Gesetzes vom 24.9.2009[84] mit Wirkung zum 1.1.2010 entfallen. Durch die Streichung des § 197 Abs. 1 Nr. 2 wurden die familien- und erbrechtlichen Vorschriften der regelmäßigen Verjährung der §§ 195, 199 unterworfen.[85]
Hinweis
Nach § 207 Abs. 1 S. 1 ist die Verjährung des Ausgleichsanspruchs bis zur Rechtskraft der Scheidung gehemmt. Dieser Vorschrift kommt vor allem Bedeutung zu, wenn der Güterstand der Zugewinngemeinschaft durch einen Ehevertrag beendet wird. Das gilt auch dann, wenn die Zugewinngemeinschaft vorzeitig aufgehoben worden ist.[86]
c) Rechte des Ausgleichspflichtigen
aa) Stundung des Ausgleichsanspruchs, § 1382
156
Nach § 1382 Abs. 1 S. 1 kann das Familiengericht auf Antrag des Ausgleichspflichtigen die Ausgleichsforderung stunden, soweit sie vom Schuldner nicht bestritten wird und wenn die sofortige Zahlung auch unter Berücksichtigung der Interessen des Gläubigers zur Unzeit erfolgen würde. Davon ist nach § 1382 Abs. 1 S. 2 auszugehen, wenn die sofortige Zahlung die Wohnverhältnisse oder die Lebensverhältnisse der gemeinsamen Kinder nachhaltig verschlechtern würde.
bb) Leistungsverweigerungsrecht wegen grober Unbilligkeit, § 1381
157
Nach § 1381 Abs. 1 kann der Schuldner die Erfüllung der Ausgleichsforderung verweigern, soweit der Ausgleich des Zugewinns nach den Umständen des Falles grob unbillig wäre. Die grobe Unbilligkeit kann sich aus einem Fehlverhalten eines Ehegatten ergeben, wobei auch die Verletzung persönlicher Pflichten eine Rolle spielen kann. Einzubeziehen in die bewertende Betrachtung ist auch die Versorgungslage der beiden Ehegatten, ihr Einkommen und ihr Vermögen. Das Gesetz konkretisiert in § 1381 Abs. 2 einen Fall der Unbilligkeit, wenn ein Ehegatte, der den geringeren Zugewinn erzielt hat, längere Zeit hindurch die wirtschaftlichen Verpflichtungen, die sich aus dem ehelichen Verhältnis ergeben, schuldhaft nicht erfüllt hat. Dazu gehören die Unterhaltspflichten genauso wie die Pflicht der Haushaltsführung, soweit sie einvernehmlich von einem Ehegatten übernommen wurde. Auch die aus § 1353 abgeleitete Rücksichtnahme auf die wirtschaftlichen Belange des anderen ist hier zu nennen. Ob die Verfehlung längere Zeit gedauert hat, ist im Verhältnis zur Ehedauer und zur Schwere der Pflichtverletzung zu sehen.