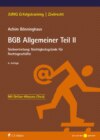Kitabı oku: «Familien- und Erbrecht», sayfa 8
1. Anwendbarkeit von § 1365 Abs. 1
Die Vorschrift des § 1365 greift nur ein, wenn der Verfügende im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft gelebt hat und die sich daraus ergebenden Verfügungsbeschränkungen nicht von den Ehegatten in einem Ehevertrag ausgeschlossen worden sind, §§ 1363 Abs. 1, 1408 Abs. 1. Das ist hier der Fall, da M und F die Vorschrift des § 1365 nicht abbedungen haben und in der Zugewinngemeinschaft gelebt haben.
2. Verfügung über das Vermögen im Ganzen
Nach dem Wortlaut des § 1365 erfasst die Vorschrift nur Verfügungen über das Vermögen im Ganzen. Vorliegend hat F nur über einen einzelnen Vermögensgegenstand verfügt. Nach h.M. wird die Vorschrift des § 1365 dahin erweitert, dass auch eine Verfügung über einen einzelnen Gegenstand zustimmungsbedürftig ist, wenn der betroffene Gegenstand das gesamte oder nahezu das gesamte Vermögen ausmacht (Einzeltheorie). Hierfür spricht der Zweck des § 1365, der neben der Sicherung eines möglichen Zugewinnausgleichsanspruchs die wirtschaftliche Lebensgrundlage der Ehe sichern soll. Beides kann durch eine Verfügung über einen einzelnen Gegenstand gleichermaßen gefährdet werden, wenn der Einzelgegenstand das gesamte Vermögen oder nahezu das gesamte Vermögen ausmacht. Daran fehlt es zwar, wenn dem Verfügenden ein Restvermögen von 15 % des ehemaligen Gesamtvermögens verbleibt.[40] Bei größeren Vermögen ab etwa 25 000 € zieht die Rechtsprechung die Grenze bei einem Vermögen von 10 % des ehemaligen Gesamtvermögens.[41]
Dabei können dingliche Belastungen Wert mindernd berücksichtigt werden. Unberücksichtigt bleiben hingegen nach h.M. etwaige Gegenleistungen des Vertragspartners, auch wenn diese einen gleichwertigen Ausgleich darstellen.[42] Vorliegend verbleibt der F nach der Verfügung über das Grundstück nur ein Restvermögen von 1000 €. Gemessen an dem anfänglichen Gesamtvermögen von 101 000 € beträgt das Restvermögen weniger als 10 %. F hat daher durch die Veräußerung ihres Grundstücks nahezu über ihr gesamtes Vermögen verfügt.
3. Subjektive Einschränkung des § 1365
Die Vorschrift des § 1365 findet nach der subjektiven Einzeltheorie nur dann Anwendung, wenn K positive Kenntnis davon gehabt hat, dass es sich bei dem Grundstück nahezu um das gesamte Vermögen der F gehandelt hat.[43] Die Darlegungs- und Beweislast für die Kenntnis des Vertragspartners trägt derjenige, der sich auf die Unwirksamkeit der Verfügung nach § 1365 beruft. Das ist in der Regel der nicht verfügende Ehegatte.[44] Vorliegend hat K die Vermögensverhältnisse der F nicht gekannt. Er hatte daher auch keine Kenntnis davon, dass das an ihn veräußerte Grundstück nahezu das gesamte Vermögen der F darstellt. Mangels einer entsprechenden positiven Kenntnis des K war die Verfügung der F nicht zustimmungsbedürftig i.S.v. § 1365. Die F hat daher wirksam über das Grundstück verfügt. K ist daher gemäß §§ 873, 925 durch Auflassung und Eintragung Eigentümer des Grundstücks geworden. Die Voraussetzungen eines Grundbuchberichtigungsanspruchs nach § 894 sind daher nicht gegeben, da die materielle Rechtslage nicht von der formellen Rechtslage abweicht.
III. Ergebnis
Die zulässige Klage des M ist unbegründet, da er von K nicht die Rückgängigmachung des Kaufvertrags verlangen kann.
3. Zugewinnausgleich
122
Wegen des Zugewinnausgleichs von Todes wegen siehe ausführlich unter Rn. 298 ff.
Der Zugewinn, den die Ehegatten in der Ehe erzielen, wird nach § 1363 Abs. 2 S. 2 ausgeglichen, wenn die Zugewinngemeinschaft endet. Der Ausgleich des Zugewinns beruht auf der Erwägung, dass jeder Ehegatte an dem teilhaben soll, was die Ehegatten während des Güterstands im Rahmen einer arbeitsteiligen Zusammenarbeit erworben haben. Der Ausgleich des Zugewinns erfolgt zu Lebzeiten der Ehegatten im Fall der Scheidung (§§ 1564 ff.) oder bei Aufhebung der Ehe (§§ 1313 ff.) bzw. bei Aufhebung des gesetzlichen Güterstands durch Ehevertrag, §§ 1385, 1386. Erfolgt die Beendigung der Zugewinngemeinschaft zu Lebzeiten der Ehegatten, so wird der Zugewinn nach der güterrechtlichen Lösung ausgeglichen, §§ 1372 bis 1390. Dem ausgleichsberechtigten Ehegatten steht eine Ausgleichsforderung aus § 1378 Abs. 1 zu. Wird die Zugewinngemeinschaft durch den Tod eines Ehegatten beendet, vollzieht sich der Zugewinnausgleich gemäß § 1371 Abs. 1 i.V.m. § 1931 Abs. 3 nach der sog. erbrechtlichen Lösung.
a) Berechnung der Ausgleichsforderung
123
Ausgleichsanspruch aus § 1378 Abs. 1
I. Anspruchsentstehung
1.Ehe mit Güterstand der Zugewinngemeinschaft
2.Beendigung der Zugewinngemeinschaft zu Lebzeiten der Ehegatten
3.Umfang
a)Hälftiger Zugewinnüberschuss des Anspruchsgegners
aa)Zugewinn des Gegners nach §§ 1373 ff.
bb)abzüglich des Zugewinns des Anspruchstellers nach §§ 1373 ff.
cc)verbleibender Zugewinnüberschuss des Gegners?
dd)Halbierung des generischen Überschusses
b)Begrenzung gem. § 1378 Abs. 2
c)Anrechnung von Vorausempfängen, § 1380 Abs. 1
II. Rechtsvernichtende Einwendungen (insbes. §§ 362 ff. )
III. Durchsetzbarkeit
1.Fälligkeit
2.Einreden
aa) Ausgangsformel
124
Der Zugewinn ist nach der Legaldefinition des § 1373 der Betrag, um den das Endvermögen (§ 1375) eines Ehegatten dessen Anfangsvermögen (§ 1374) übersteigt.
Hinweis
Der Zugewinn wird also wie folgt berechnet:
Zugewinn (§ 1373) = Endvermögen (§ 1375) – Anfangsvermögen (§ 1374)
125
Hat ein Ehegatte einen größeren Zugewinn erzielt, so hat derjenige mit dem geringeren Zugewinn gegen den anderen einen schuldrechtlichen Ausgleichsanspruch auf Zahlung der Hälfte des Überschusses § 1378 Abs. 1.
Beispiel
| Ehemann | Ehefrau | |
|---|---|---|
| Anfangsvermögen | 10 000 € | 30 000 € |
| Endvermögen | 100 000 € | 60 000 € |
| Zugewinn | 90 000 € | 30 000 € |
Ausgleichsanspruch: Zugewinn Ehemann von 90 000 € – Zugewinn Ehefrau von 30 000 € = 60 000 € : 2 = 30 000 €.
Der Ausgleichsanspruch der Ehefrau beträgt damit 30 000 €.
Hinweis
Die Höhe des Ausgleichsanspruchs berechnet sich damit wie folgt:
(Höherer Zugewinn – niedriger Zugewinn) : 2 = Höhe des Ausgleichsanspruchs
126
Ist das Endvermögen eines Ehegatten geringer als sein Anfangsvermögen, so findet kein Verlustausgleich statt. Wegen des in § 1373 enthaltenen Gesetzeswortlauts „übersteigt“ kann der Zugewinn nicht negativ sein[45].
Beispiel
| Ehemann | Ehefrau | |
|---|---|---|
| Anfangsvermögen | 30 000 € | 30 000 € |
| Endvermögen | 10 000 € | 60 000 € |
| Zugewinn | 0 € | 30 000 € |
Ausgleichsanspruch: Zugewinn der Ehefrau von 30 000 € – Zugewinn des Ehemanns von 0 € = 30 000 € : 2 = 15 000 €.
Der Zugewinnanspruch des Ehemannes beträgt damit 15 000 €.
bb) Anfangsvermögen
127
Für die Ermittlung des Zugewinns ist zunächst das jeweilige Anfangs- und Endvermögen zu ermitteln. Nach §§ 1377 Abs. 2, 1035 S. 3 kann jeder Ehegatte von dem anderen Ehegatten verlangen, dass ein Inventar über das Anfangsvermögen durch einen Notar aufgenommen wird. Diese Verpflichtung ist eine unvertretbare Handlung, die nach § 120 FamFG, § 888 ZPO vollstreckt werden kann.
128
Anfangsvermögen ist nach § 1374 das Vermögen, das einem Ehegatten nach Abzug der Verbindlichkeiten bei Eintritt des Güterstands gehört. Soweit die Ehegatten keinen Ehevertrag geschlossen haben, ist in der Regel der Zeitpunkt der Eheschließung für den Eintritt des Güterstands maßgebend. Haben die Ehegatten im Zeitpunkt der Eheschließung im Rahmen eines Ehevertrages Gütertrennung vereinbart und heben sie im Laufe der Ehe den vereinbarten Güterstand durch einen weiteren Ehevertrag wieder auf, indem sie den gesetzlichen Güterstand vereinbaren, ist für das Anfangsvermögen auf den Zeitpunkt des Abschlusses des zweiten Ehevertrages abzustellen.
(1) Aktivvermögen
129
Zu den zu berücksichtigenden Aktiva zählen alle dem Ehegatten am Stichtag zustehenden rechtlich geschützten Positionen von wirtschaftlichem Wert, d.h. also neben den einem Ehegatten gehörenden Sachen alle ihm zustehenden objektiv bewertbaren Rechte, die bei Eintritt des Güterstandes bereits bestanden haben.[46] Dazu gehören unter anderem auch geschützte Anwartschaften mit ihrem gegenwärtigen Vermögenswert sowie vergleichbare Rechtspositionen, die einen Anspruch auf eine künftige Leistung gewähren, sofern diese nicht mehr von einer Gegenleistung abhängig und nach wirtschaftlichen Maßstäben (notfalls durch Schätzung) bewertbar sind.[47]
130
Nicht zum Anfangsvermögen gehören alle vor dem Stichtag begründeten Rechts- und Dauerschuldverhältnisse, die Ansprüche auf künftig fällige, wiederkehrende Einzelleistungen (Arbeitsentgelt, Besoldung, Unterhaltsleistungen) begründen. Ein güterrechtlicher Ausgleich findet ebenfalls nicht statt, soweit eine Vermögensposition bereits auf andere Weise ausgeglichen wird.[48] Auch Hausrat, der nach §§ 1568a ff. verteilt wird, und Anwartschaften, die durch den Versorgungsausgleich ausgeglichen werden, fallen nicht in das Anfangsvermögen.
131
Die Wertermittlung des Anfangsvermögens erfolgt nach §§ 1376 Abs. 1. Danach wird bei der Berechnung des Anfangsvermögens der Wert zugrunde gelegt, den das Vermögen im Zeitpunkt des Eintritts in den Güterstand hatte. Für den Wert des Vermögens, das dem Anfangsvermögen zuzurechnen ist, ist der Zeitpunkt des Erwerbs maßgebend.
(2) Verbindlichkeiten
132
Vom Wert des Aktivvermögens sind alle am Stichtag vorhandenen Verbindlichkeiten aller Art abzuziehen, also sowohl öffentlich-rechtliche wie private Schulden, Steuern und Abgaben, wie private Lasten. Die Verbindlichkeiten müssen am Stichtag schon entstanden, aber noch nicht fällig sein.[49]
Hinweis
Bis zum 30.8.2009 war durch § 1374 Abs. 1. Hs. 2 die Abzugsfähigkeit der Verbindlichkeiten beschränkt auf die Höhe des Aktivvermögens. Das Anfangsvermögen konnte daher nur den Wert Null haben. Damit wurde bezweckt, dem Ausgleichsschuldner beim Zugewinnausgleich mindestens die Hälfte seines Zugewinns zu belassen.[50] Nach Art. 229 § 20 Abs. 2 EGBGB gilt die alte Rechtslage weiter, wenn der Scheidungsantrag vor dem 1.9.2009 anhängig gemacht wurde. Das Gesetz zur Änderung des Zugewinnausgleichs- und Vormundschaftsrechts vom 6.7.2009[51] hat die Beschränkung der Abzugsfähigkeit von Verbindlichkeiten beseitigt; es wurde § 1374 Abs. 1 Hs. 2 aufgehoben und in dem neu eingefügten § 1374 Abs. 3 klargestellt, dass Verbindlichkeiten über die Höhe des Anfangsvermögens hinaus abgezogen werden können. Als Konsequenz des Halbteilungsgrundsatzes wird daher nunmehr für die Berechnung des Zugewinnausgleichs auch ein negatives Anfangsvermögen berücksichtigt. Verbindlichkeiten sind bei der Berechnung des Anfangsvermögens abzuziehen, sofern sie am Stichtag bereits vorhanden waren. Auf deren Fälligkeit kommt es nicht an.[52] Auch wenn sich dadurch an den Haftungsverhältnissen im Außenverhältnis nichts ändert, wird damit der wirtschaftliche Erfolg aus der Ehezeit zur Hälfte auf die Ehegatten verteilt.[53]
Beispiel
Der Ehemann hat im Zeitpunkt der Eheschließung Schulden in Höhe von 200 000 €. Das Anfangsvermögen der Ehefrau beträgt 5000 €. Während der Ehezeit tilgt der Ehemann seine Verbindlichkeiten und hat im Zeitpunkt der Scheidung ein Endvermögen von 0 €. Die Ehefrau verfügt über ein Endvermögen in Höhe von 20 000 €. Nach altem Recht hätte der Ehemann gegen die Ehefrau einen Anspruch auf Zugewinnausgleich in Höhe von 7500 € (20 000 € [Endvermögen] – 5000 € [Anfangsvermögen] = 15 000 € : 2) gehabt. Dieses Ergebnis wurde als ungerecht empfunden, weshalb § 1374 Abs. 1 Hs. 2 gestrichen wurde. Stattdessen bestimmt § 1374 Abs. 3, dass Verbindlichkeiten auch über die Höhe des Vermögens hinaus abgezogen werden können, so dass das Anfangsvermögen auch negativ sein kann. Danach beträgt der Zugewinn des Ehemannes 200 000 €, da er während der Ehezeit Verbindlichkeiten in dieser Höhe getilgt hat. Der Ehefrau stünde daher ein Zugewinnausgleich in Höhe von 92 500 € (200 000 € [Zugewinn des Mannes] – 15 000 € [Zugewinn der Frau] = 185 000 € : 2) zu. Der Ausgleichanspruch der Ehefrau ist nach § 1378 Abs. 2 S. 1 indes auf die Hälfte des Vermögens beschränkt, über das der Ehemann am Stichtag verfügt. Da dieses im Beispielsfall 0 € beträgt, steht der Ehefrau kein Zugewinnausgleich zu. Im Gegensatz zur alten Regelung steht in diesem Fall aber auch dem Ehemann gegenüber der Ehefrau kein Zugewinnausgleich zu.
133
Während nach der alten Rechtslage jeder Ehegatte die Höhe seines Anfangsvermögen beweisen musste, wird nunmehr nach § 1377 Abs. 3 i.S.v. § 292 S. 1 ZPO gegenüber dem anderen Ehegatten widerlegbar vermutet, dass das Anfangsvermögen der Ehegatten null beträgt, wenn sie gemäß § 1377 Abs. 1, Abs. 2 kein Vermögensverzeichnis erstellt haben. Nach § 1379 Abs. 1 Nr. 2 steht jedem Ehegatten nach der Beendigung des Güterstands ein Auskunftsanspruch über die Höhe des Anfangsvermögens zu.
(3) Privilegiertes Vermögen
134
Nach § 1374 Abs. 2 wird Vermögen, das ein Ehegatte nach Eintritt des Güterstands der Zugewinngemeinschaft von Todes wegen oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht oder durch Schenkung oder Ausstattung erwirbt, nach Abzug der Verbindlichkeiten dem Anfangsvermögen hinzugerechnet. Dem liegt der Rechtsgedanke zugrunde, dass der Erwerb von Vermögen privilegiert und damit nicht ausgleichspflichtig sein soll, der auf einer besonderen persönlichen Beziehung des Erwerbers zum Zuwendenden oder auf ähnlichen persönlichen Umständen beruht.[54] Nur bei den in § 1374 Abs. 2 genannten Fallgruppen handelt es sich um ein nicht ausgleichspflichtiges Anfangsvermögen. Bei der Vorschrift des § 1374 Abs. 2 handelt es sich nach h.M.[55] um eine abschließende und nicht analogiefähige Sonderregelung. Aus diesem Grund unterliegen Lottogewinne, Spekulationsgewinne oder ein Schmerzensgeldanspruch nicht der Vorschrift des § 1374 Abs. 2. Die Privilegierung tritt ohne eine entsprechende Anordnung des Zuwendenden kraft Gesetzes ein.[56] Das durch den privilegierten Erwerb dem Anfangsvermögen hinzurechnende Vermögen wird gemäß § 1374 Abs. 1 nach dem Wert berechnet, den es im Zeitpunkt des Erwerbs hatte.
(a) Schenkungen während der Ehe
135
Der Begriff der Schenkung entspricht § 516, so dass eine Schenkungsabrede erforderlich ist. Bei gemischten Schenkungen ist nur der unentgeltliche Teil dem Anfangsvermögen hinzuzurechnen.[57] Spätere Gewinne wie Zinsen oder Wertsteigerungen des geschenkten Vermögensgegenstands fallen dagegen in den Zugewinn des Ehegatten.
Beispiel
Die Ehefrau bekommt während der Ehe von ihren Eltern ein Sparbuch mit einem hohen Sparguthaben geschenkt. Bei der Schenkung handelt es sich um einen privilegierten Erwerb i.S.v. § 1374 Abs. 2, so dass das auf dem Sparbuch befindliche Guthaben nicht in den Zugewinn fällt. Dagegen unterliegen die Zinsen, die seit der Schenkung angefallen sind, dem Zugewinnausgleich, wenn sich die Ehegatten scheiden lassen.
136
Freiwillige Leistungen des Arbeitgebers wie Gratifikationen oder Trinkgelder stellen in der Regel kein Geschenk, sondern eine Entlohnung dar.[58]
137
Auf Schenkungen zwischen den Ehegatten ist § 1374 Abs. 2 nicht anzuwenden.[59] Das ergibt sich aus Sinn und Zweck dieser Bestimmung. Danach sollen nur Zuwendungen von dritter Seite, zu deren Erwerb der andere Ehegatte weder unmittelbar noch mittelbar etwas beigetragen hat, vom Zugewinnausgleich ausgenommen werden. Bei Zuwendungen zwischen den Ehegatten ist demgegenüber eine Berücksichtigung im Zugewinnausgleichsverfahren gerade gewollt. Den Zugewinnausgleich nimmt der BGH in diesem Fall nach § 1380 (Anrechnung von Vorausempfängen) vor. Bei ehebezogenen (unbenannten) Zuwendungen findet § 1374 Abs. 2 ebenfalls keine Anwendung.[60] Zuwendungen seitens der Schwiegereltern sind dagegen nach der neueren Rechtsprechung des BGH[61] als Schenkungen dem Anfangsvermögen des Schwiegerkindes hinzuzurechnen. Der Wert dieser Schenkungen ist allerdings zu mindern, wenn die Schwiegereltern bei dem Scheitern der Ehe einen Rückforderungsanspruch nach § 313 haben. Die Höhe des Rückforderungsanspruchs entspricht dabei der Wertminderung der Schenkung.
138
Wird die Schenkung vor dem Endvermögensstichtag widerrufen oder wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage rückgängig gemacht, so sind die entstehenden Rückgewähransprüche in der Zugewinnbilanz entsprechend zu berücksichtigen.[62]
Eine an sich privilegierte Schenkung ist dem Anfangsvermögen nach § 1374 Abs. 2 BGB nicht hinzuzurechnen, soweit sie den Umständen nach zu den Einkünften zu rechnen ist. Was in diesem Zusammenhang unter Einkünften zu verstehen ist, definiert das Gesetz nicht näher. Mit der Zielsetzung, die der Zugewinnausgleich verfolgt, sollen nur Vermögenszuwächse ausgeglichen werden. Bei unentgeltlichen Zuwendungen im Sinne des § 1374 Abs. 2 BGB ist deshalb in erster Linie danach zu unterscheiden, ob sie zur Deckung des laufenden Lebensbedarfes dienen oder die Vermögensbildung fördern sollen. Das wird im Einzelfall unter Berücksichtigung des Anlasses der Zuwendung, der Willensrichtung des Zuwendenden und der wirtschaftlichen Verhältnisse des Zuwendungsempfängers zu beurteilen sein. Dabei werden sich bei größeren Sachzuwendungen brauchbare Anhaltspunkte für die Beurteilung, ob es sich um Einkünfte handelt, vor allem aus der Prognose gewinnen lassen, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Zuwendungsgegenstand, wäre die Ehe in einem überschaubaren Zeitraum nach der Zuwendung gescheitert, noch mit einem nennenswerten Vermögenswert im Endvermögen des begünstigten Ehegatten vorhanden gewesen wäre. Nach diesen Maßstäben sind Zuwendungen einer Stiftung zur Anschaffung eines behindertengerechten Fahrzeugs nicht zu den Einkünften zu rechnen.[63]
(b) Erwerb von Todes wegen
139
Zu dem privilegierten Erwerb gehören auch die Vermögensgegenstände, die ein Ehegatte im Rahmen der gesetzlichen oder gewillkürten Erbfolge als Allein-, Mit-, Vor- oder Nacherbe erhält oder durch ein Vermächtnis, durch eine Auflage, durch ein Pflichtteil bzw. als Abfindung für einen entgeltlichen Erbverzicht erlangt. Hierzu gehören auch die durch einen Erbfall eingetretene Befreiung von einer Verbindlichkeit (Konfusion)[64] sowie Ansprüche aus Vergleichen über erbrechtliche Rechtsverhältnisse.[65] Zum privilegierten Erwerb gehört auch das Anwartschaftsrecht des Nacherben einschließlich der realen Wertsteigerungen.
140
Zu dem privilegierten Erwerb zählen auch alle Vermögensgegenstände, die ein Ehegatte aufgrund einer vorweggenommenen Erbfolge erhält. Dass der erwerbende Ehegatte gesetzlicher oder gewillkürter Erbe des Zuwendenden ist, ist nicht erforderlich; entscheidend ist, dass der Erwerb von Todes wegen (wenigstens teilweise) durch eine vorweggenommene Erbfolge ersetzt wird.[66] Die Vereinbarung einer Gegenleistung (etwa Versorgungsrechte wie laufende Rentenzahlungen, Erbringung von Pflegeleistungen) ist oftmals geradezu typisch und hindert daher nicht den Abzug der zugesagten Leistungen.[67]
141
Ist Vermögen, das ein Ehegatte mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht erwirbt, zugunsten des Übergebers mit einem Nießbrauch belastet, unterliegt der fortlaufende Wertzuwachs der Zuwendung aufgrund des abnehmenden Werts des Nießbrauchs für den dazwischen liegenden Zeitraum bzw. die Zeit zwischen dem Erwerb des Grundstücks und dem Erlöschen des Nießbrauchs nicht dem Zugewinnausgleich. Bei der Berechnung des Zugewinns des Zuwendungsempfängers wird auf ein Einstellen des Wertes des Nießbrauchs zum Ausgangs- und Endzeitpunkt in die Vermögensbilanz insgesamt verzichtet. Ist hingegen der Wert des Nießbrauchs gestiegen, weil das belastete Grundstück im maßgeblichen Zeitraum einen Wertzuwachs (hier: infolge gestiegener Grundstückspreise) erfahren hat, muss der Wert des Nießbrauchs im Anfangs- und Endvermögen eingestellt werden, ohne dass es weiterer Korrekturen des Anfangsvermögens bedarf.[68]
142
Auch eine Lebensversicherungssumme, die der Ehegatte als Begünstigter nach dem Tod eines nahen Verwandten aus dessen Versicherung ausgezahlt erhält, fällt entsprechend dem Normzweck der Privilegierung hierunter, auch wenn „rechtstechnisch“ kein Erwerb aus dem Nachlass vorliegt (§§ 330, 331), sondern ein rechtsgeschäftlicher Erwerb nach § 159 VVG.[69] Hat ein Ehegatte in Zusammenhang mit der Zuwendung ein Wohnrecht oder ein Nießbrauch übernommen, so ist dieses bei Ermittlung des Anfangs- als auch des Endvermögens wertmindernd zu berücksichtigen, wenn das übernommene Recht fortbesteht. Dabei ist der fortlaufende Wertzuwachs der Zuwendung aufgrund des abnehmenden Wertes des Wohn- bzw. Nießbrauchrechtes zu bewerten, um den gleitenden Erwerbsvorgang zu erfassen und vom Zugewinnausgleich ausnehmen zu können. Dabei ist das jährliche Absinken des Wertes gesondert zu indexieren und inflationsbedingt zu bereinigen[70].
143
Nach der Neufassung des § 1374 Abs. 2 ist der privilegierte Erwerb mit einem negativen Anfangsvermögen zu verrechnen.
Beispiel
Der Ehemann hat im Zeitpunkt der Eheschließung Schulden in Höhe von 30 000 €. Während der Ehe erbt er 20 000 €. Seit dem 1.9.2009 ist die Erbschaft als privilegierter Erwerb mit dem negativen Anfangsvermögen zu verrechnen, so dass von einem negativen Anfangsvermögen in Höhe von 10 000 € auszugehen ist. Unter der alten Rechtslage war umstritten, ob zunächst das Anfangsvermögen auf 0 zu setzen ist und sodann mit der Erbschaft zu addieren ist. Dieser Streit hat sich durch die Neufassung des § 1374 Abs. 2 erledigt.