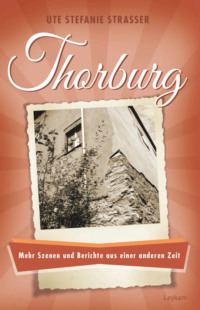Kitabı oku: «Thorburg», sayfa 3
Einmal, die Frau vom O. war bereits die Witwe vom O., da schlug ihr meine Mutter bei einem Plausch am Ortgang vor, das zweite Bett doch wegzugeben, damit sie mehr Platz hätte. Nein, sagte die Witwe vom O., unmöglich, das zweite Bett brauche sie für ihren Mittagsschlaf. Das hörte sich für meine Mutter zu verrückt an und sie fragte nach. Ja, wegen der Katze, die sei es gewöhnt, um die Mittagszeit in einem Bett zu schlafen, und wenn sie nur mehr ein Bett hätte, könnte sie sich für ihren Mittagsschlaf nicht mehr lang legen.
Die Frau vom O. war bestimmt um die zwanzig Jahre jünger als ihr Mann. Wahrscheinlich war sie nicht wesentlich älter als meine Mutter, doch wirkte sie viel schwerfälliger, denn sie hatte ein komisches Gstöi (Gestell/Körperbau); allerdings war es anders komisch als das meiner Großmutter Ama.
Es ist ja so (ganz frei nach Tolstoi): Alle schönen Menschen ähneln einander (sieht man von Haar- und Augenfarben ab), jeder Nichtschöne ist dagegen auf seine eigene, ganz persönliche Art nicht schön. Schönheit liegt in einem vom Zeitgeist akzentuierten Ebenmaß, die Kategorie des Schönen ist schmal, Abweichungen davon gibt es viele. Im wirklichen Leben kann uns menschliche Schönheit faszinieren – erzählerisch gesehen gibt sie viel weniger her als Nichtschönheit.
Wie sah nun der Frau vom O. ihr komisches Gstöi aus? Sie hatte nicht Amas dünne Beine, mit denen sie geschäftig dahinschritt, sondern kräftige, die sie gemächlich am Boden entlangzog; sie hatte nicht Amas breite Hüften, sondern eher schmale, obzwar seitlich hoch aufgepolstert, und sie hatte nicht Amas zierlichen Oberkörper, sondern einen eher dominanten; und ihre besondere Besonderheit war ein imposanter Busen, der, bereits altersgerecht gesenkt, ihre Vorderfront dominierte. Ba dera, sagte mein Vater, ba dera – do dastickst (bei der, da erstickst du; nebenbei bemerkt: der Steirer verwendet statt der Vorsilbe er gern die Vorsilbe da – dasticken statt ersticken, dawortn statt erwarten, daschlogn statt erschlagen). Er meinte damit, dass man, würde man von einer so vollbusigen Frau herzlich umarmt und gedrückt, dass man dann, wenn’s dumm zuginge, mit Nase und Mund in die Furche zwischen ihre Brüste (die Alan Bennett als Elfjähriger für eine pektorale Vagina hielt) geraten könnte, und dass man, dadurch am Atmen behindert, womöglich der Gefahr des Erstickens ausgesetzt wäre. Meine Mutter spielte auf die reife Schwere des nachbarlichen Busens an, indem sie uns vorspielte, wie ihr die Frau vom O. einmal Verdauungsprobleme geschildert hatte. Meine Mutter stand auf, ließ ihre flache Hand um den Nabel kreisen und sagte, die leise raue Stimme der Frau vom O. nachahmend, es täte ihr da unter der Brust so weh.
Die Frau vom O. hat ihren Stolz, sie lässt sich nichts schenken, außer alten Zeitungen und Romanheftchen, die nimmt sie gerne. Einmal schenkte ihr meine Mutter Winterstiefel, weil sie sich selbst neue gekauft hatte, modernere. Doch die alten waren noch gut, zu schade zum Wegwerfen. Die Frau vom O. hat sie angenommen, gesehen haben wir sie nie an ihren Füßen. Vielleicht hat sie sie in eine Schachtel gepackt und unter das Bett oder in die Kredenz gestellt, falls sie sie doch einmal braucht. Meine Mutter hat das gestiert (geärgert), dass sie diese noch guten Stiefel nicht trug. Wenn sie das vorher gewusst hätte, hätte sie sie behalten, denn für Schiach wären sie noch lang gut gewesen.
Wenn meine Mutter am Freitag eine Mehlspeis (Kuchen) backte und der Frau vom O. zwei Stück davon anbot, sagte die Neindanke, sie könne selbst backen. Hin und wieder hängte ihr meine Mutter zwei Stück Gugelhupf oder Ähnliches in einem Sackerl (Tüte) an die Türschnalle (Türklinke), die Frau vom O. hängte es zurück an unsere Tür. Und wenn meine Mutter Pech hatte, war sie noch dazu pikiert. Das äußerte sie, indem sie meiner Mutter aus dem Weg ging und wegschaute, wenn die beiden sich trotzdem begegneten. Es dauerte, bis meine Mutter endlich begriff, dass ihre gut gemeinten Gaben als beleidigende Almosen aufgefasst wurden. Bemerkenswert ist, dass meine Mutter nie auf die Idee kam, das Ehepaar O. zu uns einzuladen, was aus meiner heutigen Perspektive naheliegend gewesen wäre, wenn man jahrelang so nah bei-
einander wohnt. Das kam aber nicht in Frage, denn das Ehepaar O., das wa-ren fremde Leute und anders geartet als wir. Und kommen würden sie eh nicht, weil sie sich ja nicht mit einer Gegeneinladung revanchieren könnten, allein aus Platzgründen nicht. Auch später, als die Frau vom O. schon seine Witwe war, wurde sie nie zu uns gebeten; schon gar nicht an Weihnachten – denn Weihnachten ist ein Familienfest.
Der Haushalt der Frau vom O. ist klein und schnell getan, weshalb sie bereitwillig Putz- und Gartenarbeiten für Ama erledigt. Und Ama schickt sie gern einkaufen, denn Großvater Jo, der willig, wenn auch nicht freiwillig, Küchendienst verrichtet, verhält sich beim Einkaufen störrisch. Er kommt lange nicht zurück und dann bringt er das Falsche mit, statt einem Kilo
Äpfel zwei Kilo Birnen, statt der Glühbirne eine neue Nachttischlampe, statt Semmeln dunkles Brot. Plausible Begründungen für sein langes Ausbleiben und seine etwas anderen Einkäufe hat er, aber Ama will frische Semmeln und kein Schwarzbrot, auch wenn er dessen Kauf begründen kann. Die Frau vom O. erledigt die Einkäufe schneller und bringt nicht nur genau das Verlangte, sondern auch Neuigkeiten aus der Stadt mit. In ihr hat Ama ein billiges Dienstmädchen gefunden, nach ihr hören wir sie regelmäßig durchs Haus rufen. Sie rief freilich nicht Frau O., sie rief selbstverständlich deren vollen Namen, den ich an dieser Stelle verrate, denn er ist so schön passend im Sinne des nomen est omen. Frau Orthelfer!, rief Ama nach ihrer Helferin. Laut rief sie es von unten nach oben und rief noch dazu, sie möge doch kurz kommen. Und die Frau Orthelfer öffnete oben ihre Tür und rief: I kumm glei!
Meine Mutter fand diese Hin-und-Her-Schreierei unmöglich – kein Benehmen habe meine Großmutter, ihre Schwiegermutter; die Frau Keidel, mei-ner Mutter Ex-Arbeitgeberin in Wien, hätte so etwas nie – niemals gemacht. Überhaupt gebärde sich Ama immer so laut im Haus. Nachdem sie mit ihrer Küche in Kathis Zimmer hinter dem Ortgang umgezogen ist, hören wir sie häufig durch den langen Flur hin und her stöckeln (sie trägt schwarze halbhohe Stöckelschuhe mit Schnürsenkel), und alle paar Tage ruft sie dabei laut und in für sie ungewöhnlich hoher Tonlage Hatschi. Sie muss niesen. Sie tut es in Serie und mit Genuss, einmal auf dem Hinweg und einmal auf dem Rückweg, oder sie niest zweimal auf dem Hinweg und keinmal auf dem Rückweg, oder dreimal auf dem Hinweg und noch einmal – ich hör schon auf. Es ist meiner Mutter ein Rätsel, warum die gerade immer im Flur niesen muss, und es
ärgert sie. Ich glaube, die Hausgespenster hat es auch geärgert und sie haben sich wegen des forschen Taktak-Gestöckels und der herzhaften Hatschis meiner
Großmutter aus dem dunklen Vorhaus, diesem Gruselgang, in den noch dunkleren Keller zurückgezogen.
Wenn Ama also nach der Frau Orthelfer schrie, empörte sich meine Mutter: Wos wü sie denn jetz scho wieda von da Orthöferin? Wenn man Frauen nachnamentlich erwähnte, hängte man oft ein In an – ganz modern, oder? Man sagte nicht, gestern habe man die Frau Pichler gesehen, sondern gestern habe man die Pichlerin gesehen. Und so nannten meine Mutter und Ama die Frau vom O. familienintern die Orthöferin; aus der Helferin wurde auf Steirisch eine Höferin, wodurch das nomen es omen nicht mehr stimmt.
Die Orthelferin steht gern am Ortgang, lieber noch steht sie vor der Haustür an der Alten Straße. Sie steht da und schaut, wer vorbeigeht. Sie freut sich, wenn sie angesprochen wird und ein wenig Unterhaltung hat – was Neues erfährt. Neuigkeiten schnappt sie außer beim Einkaufen auch bei ihren Kirchgängen auf, vor der Kirchentür, versteht sich. Sie weiß Bescheid über Hochzeiten Schwangerschaften Geburten Unfälle Todesfälle Begräbnisse, und sie erzählt alles meiner Großmutter und meiner Mutter weiter, sie ist unsere Lokalreporterin. Was die Schwangerschaften und die Geburten betrifft, interessieren besonders die unehelichen. Und von denen sind wiederum diejenigen am interessantesten, bei denen der Vater des erwarteten oder schon vorhandenen Kindes nicht bekannt ist. Da darf spekuliert werden nach Herzenslust. Und wenn es gelingt, den Verdacht auf einen biederen Familienvater aus unserer kleinen Stadt zu lenken, wird es wirklich aufregend, der Verdächtigte und seine Ehefrau werden gründlich durchgehechelt. Ein Dschrawodln im Sinne eines Konsensplauschs ist das nicht, mehr ein Tratschen, bei dem die Meinungen geteilt sind und bleiben.
Wenn mein Vater am Nachmittag heimkommt und sich zum aufgewärmten Mittagessen setzt, setzt sich meine Mutter zu ihm und erzählt: Stöi da vur, wos ma die Orthöferin dazöit hot: Die Putzi Meier – keinnst eh –, dei hot a Kind kriagt! Und stöi da vur, wos die Leit reidn: Da – sie schaut zu mir und flüstert ihm einen Namen zu –, der sui da Vota sein. Na, deis glab I oba net! (Übersetzung:
Stell Dir vor, was mir die Orthelferin erzählt hat: Die Putzi Meier hat ein Kind gekriegt. Und stell Dir vor, was die Leute reden: Der … soll der Vater sein. Das glaub ich aber nicht!) Mein Vater hört sich das an und kommentiert es mit: Jojo, die Leit reidn vü. Die Leute reden viel, das Thema uneheliche Kin-der ist nicht so sein Interessensgebiet. Meine Mutter lässt sich nicht aus dem Konzept bringen, sie ergeht sich jetzt im Aufzählen von Argumenten gegen die Annahme einer Vaterschaft des von den Leuten verdächtigten Herrn und sie ergeht sich weiter in Spekulationen über Alternativen. Mein Vater schaut in die Gegend, kaut sein Essen, denkt an dies und das und dann und wann wirft er meiner eifrigen Mutter ein A-geh-a-sou-a-Bledsinn! (Blödsinn!) entgegen. Oder er bemerkt, wenn sich meine Mutter zu sehr ereifert, dass das alles, gemessen an den Dimensionen des Universums, doch völlig unwichtig sei. Diesen Vergleich brachte er öfters einmal, daran habe ich mich erinnert, als ich den Buchtitel las: Letztendlich sind wir dem Universum egal.
Oje, jetzt bin ich von unserer Gerüchteküche bis ins Universum gekommen und war doch noch gar nicht fertig mit der Führung durch die Thorburg. Her mit dem roten Faden und weiter geht’s!
Wir verlassen den Oberstock, wo wir so lange hängen geblieben sind, und gehen über eine gerade Treppe nach oben in die vierte Ebene des Hauses, in den Dachboden mit den Wäscheleinen. Gleich nach der Treppe steht rechts an die Giebelwand des Hauses gebaut ein Holzhäuschen mit Flachdach, eine hölzerne Schachtel. Darin befindet sich ein Dachstübchen, in das irgendwann Amas verwitwete Schwester, meine Großtante Mitzi, und ihre etwa dreizehnjährige Tochter Mitzi eingezogen sind, und zwar aus dem gleichen Grund, weshalb des Großvaters Bruder damals mit seiner Familie ins Weiße Haus im Feenthal eingezogen ist. Auch die alte und die junge Mitzi befanden sich in einer wirtschaftlichen Notlage. In diesem Fall war es kein Blitzschlag in eine Kuhherde, sondern der Tod des Ehemannes – ein liederlicher Trinker, der die Tante mittellos zurückgelassen.
Die junge Mitzi geht noch zur Schule. Sie hat braunes Haar von der Farbe frischer Rosskastanien, das ihr bis zu den Oberschenkeln reicht. Sie hat es in zwei dicke Zöpfe geflochten, die sie über die Schultern nach vorne legt und mir zum Spaß miteinander verknotet. Hochstecken kann sie das Haar nicht, dazu ist es zu schwer. Alle vier bis acht Wochen wird es gewaschen, an einem Sonntagvormittag, damit es vor dem Schlafengehen trocknen kann, das ist vor allem im Winter wichtig. Meine Mutter hilft der Großtante bei dieser Arbeit. Ich will auch helfen, aber es heißt: Geh, geh dauni! Und lieber aufpassen soll ich, dass ich nicht nass werde. Ama ist auch mit von der Partie, sie und ich, wir sitzen auf dem einzigen Bett im Raum und schauen zu. Setzen Sie sich zu uns, liebe Leser – nein, bitte nur einer!
Schon vorher ist kübelweise (meine Mutter und Ama haben dafür Kübel zur Verfügung gestellt) Wasser vom Hausbrunnen ins Stübchen geschleppt und der Holzfußboden mit alten Wochenschauen (von der Frau Orthelfer, schon gelesen) ausgelegt worden. Jetzt schöpft die Großtante mit einem Krug heißes Wasser aus dem Schiff im Herd und gießt es in die Lavur, die auf einem Stockerl in der Mitte des Raumes steht. Anschließend schöpft sie kaltes Wasser aus dem Kübel und schüttet es dazu bis die Temperatur passt. Die junge Mitzi sitzt, oben herum nur mit einem Hemdchen bekleidet, auf einem Stuhl vor dem Stockerl. Sie beugt sich nach vorne und lässt ihr Haar kopfüber in die Lavur hinunterfallen. Weil sie so ihr Haar nicht zur Gänze nass machen kann, wird ihr noch von oben aus dem Krug lauwarmes Wasser über den Kopf gegossen. Jetzt werden Kopfhaut und Haar gründlich mit Schichtseife – Shampoon gibt’s hier nicht – eingeseift, und die beiden Frauen, die Großtante und meine Mutter, eine rechts und eine links, reiben und drücken und wringen das Haar wie ein Stück Wäsche. Die junge Mitzi jammert dazu, weil ihr trotz eines um den Hals gelegten Handtuchs Wasser in die Ohren und über Schultern und Brust rinnt. Das kitzelt und brennt, behauptet sie. Danach wird die Seife gründlich ausgespült. Aus dem Krug wird dreimal lauwarmes Wasser über den Kopf gegossen und dem letzten Spülgang mit kaltem Wasser – da schreit die junge Mitzi auf – wird Essig beigegeben, für den Glanz. Nach dem Waschen und nach jedem der Spülgänge wird das gebrauchte Wasser in den Schmutzwasser-Kübel geleert. Und jedes Mal, wenn der voll ist, geht meine Mutter damit hinunter vors Haus und entleert ihn in den Straßengraben. Zum Schluss wird das Haar mit einem am Herd angewärmten Handtuch möglichst trocken gerubbelt und anschließend ölt die alte Mitzi der jungen Mitzi die Kopfhaut mit Klettenwurzelöl ein – für den gesunden Haarwuchs. Dann wird das Haar unter beidseitigem Gezeter mit einem Kamm frisiert, und die junge Mitzi setzt sich mit einer Illustrierten an den Herd oder in den Garten, je nach Wetter und Jahreszeit.
Liebe Leser, vielleicht hat Sie das Lesen dieser Prozedur, das erlesene Zu-schauen, gelangweilt, aber ich hoffe, Sie haben dadurch eine Vorstellung davon bekommen, wie umständlich und zeitaufwändig gewöhnliche Verrichtungen in den Fünfzigerjahren sein konnten. Sie füllten das Alltagsleben der Menschen aus, weshalb sie des Fernsehens und dergleichen Zerstreuungen noch nicht bedurften.
Irgendwann freilich wurde den beiden Mitzis diese Reinigungsprozedur zu umständlich, das Haar wurde abgeschnitten: moderne Kurzhaarfrisur. Auf die war die junge Mitzi stolz, und froh war sie, die Last vom Kopf zu haben. Ich war traurig über den Verlust ihrer Haare, denn ich war stolz darauf gewesen, eine Verwandte mit Haaren wie Rapunzel zu haben. Nur einmal noch habe ich so lange und dichte rotbraune Haare gesehen, bei Marcia in Chile. Marcia mussten die Haare abgeschnitten werden, weil sie so schwer waren, dass sie ihr den Kopf nach hinten unten zogen und dadurch Kopfschmerzen verursachten. Über Kopfschmerzen hat die junge Mitzi nie geklagt, woraus ich schließe, dass sie keine hatte. Das verdankte sie womöglich ihrer verhältnismäßig großen Nase, deren Gewicht dem Gewicht ihrer Haare entgegenwirken konnte. Das ging bei Marcia nicht, denn die hatte eine Nase wie Kleopatra, die legendäre Königin mit der hübschen Nase. Und diese so zierliche Nase konnte ob ihrer Leichtigkeit die Schwere der Haare nicht ausgleichen, Marcias armer Kopf wurde ungebremst nach hinten unten gezogen.
Nebenbei bemerkt: Die Mitzi und die Marcia gehörten zu den weiblichen Wesen, deren Haare so prachtvoll sind, dass ich die Sitte, sie mit einem Tuch zu bedecken, damit ihre erotische Strahlkraft die Männer nicht verwirre, nachvollziehen kann.
Es war kein bequemes Wohnen dort oben unter dem Dach, es war eine Notlösung, bis man was Richtiges fände. Ich aber ging gerne zu den beiden Mitzis, ich fühlte mich wohl bei ihnen im Shabby Chic-Dachstübchen mit Herd Kredenz Kleiderkasten Tisch Stuhl Stockerl und dem einen Bett, das sie sich teilen mussten.
Hier nun, liebe Leser, ist meine Führung durch die Fünfzigerjahre-Thorburg zu Ende. Wir haben uns Räume und Leute angeschaut und ein wenig von deren Alltag erfahren. Wie ich es schon für das Feenthal beschrieben habe, hatten auch hier alle einen annähernd gleichen Lebens-Rhythmus: das Wäschewaschen am Montag und am Dienstag, das Flicken und Bügeln am Mittwoch und Donnerstag, das Putzen am Freitag, das Backen mit seinem Wohlgeruch am Samstag, und am Sonntag – die Stille. Und in den Nächten schliefen selbst die Halbwüchsigen. Am Samstagabend spät heimkommen hieß gegen Mitternacht. Das ist die Zeit, wo die jungen Leute heute weggehen, denn: Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, die Nacht ist da, dass was geschieht …
Also wenn das möglich wäre, würde ich Ihnen dieses fröhliche Lied zum Abschluss des Kapitels vorsingen.
Drittes Kapitel
Auf d’Nacht und in da Nacht
Die Großmutter trägt Zöpfchen und dem Großvater entfallen die Zähne, ich verteile meine Kleider und schlafe darüber ein, eine Königstochter isst Delikatessen, russische Silvester, eine rassige Person; meine Eltern gehen auf den Ball, anfangs mit und dann nur noch ohne T.Resa, und warum dies, erzählt mir meine Mutter; sie erzählt mir auch sonst noch allerhand von Seinerzeit, und so weiter – zum Beispiel: ich – äh, pinkle auf Mehlspeisen
Der späte Nachmittag, der Vorabend, begann bei uns um fünf Uhr. Um sechs Uhr gab es das Abendessen. Den anschließenden Zeitraum bis zum Schlafengehen um acht Uhr nannten wir nicht Abend, sondern auf der Nacht – kürzer: auf d’Nacht. Auf d’Nacht ging man an gewöhnlichen Tagen nicht mehr aus dem Haus.
Bald nach unserem Umzug in die Thorburg bildete sich ein abendliches Ritual heraus: Ich ging nach dem Abendessen – es war in der Regel ein Abendbrot –
einen Stock tiefer zu den Großeltern. Die saßen am Tisch im Wohnzimmer und spielten Schnapsen, dieses Wirtshaus-Kartenspiel. Häufig gewann der Großvater; weil er besser schummeln kann, behauptete Ama. Wenn sie sein Schummeln bemerkte, rief sie empört: Jo, Schnecken! (mit Jo meinte sie Ja, nicht meinen Großvater). Bei diesen Schnecken handelt es sich nicht um die im Garten kriechenden, sondern um die Mehrzahl von Schneck, womit im Osten Österreichs ein Stück verdickter Nasenschleim (Raunga Rammel Wuzl Popel) bezeichnet wird (Robert Sedlaczek). Der Ausruf Schnecken bedeutet, etwas sei nichtiger Nasendreck, ein Nichts, durch die Verwendung der Mehrzahl zu einem totalen Nichts gesteigert. Wenn meine Großmutter Schnecken rief, meinte sie: Nichts da! Das gilt nicht! Da wird nichts draus! Und in Konsequenz: Ich lass mich von dir nicht beschummeln! Der Großvater grinste vergnügt in sich hinein.
Wenn ich bei ihnen ankomme, nehme ich alsogleich einen Kamm und zwei Bürsten, eine normale Haarbürste und eine Babybürste, aus der Stofftasche, die unter dem Spiegel in der Nische zwischen Kachelofen und Kredenz hängt, und lege sie rechts von Ama auf den Tisch. Aus der Blechdose, die in der Nische der Kredenz steht, nehme ich Schleifen Kämmchen Haarspangen Haarklammern Haarnadeln Gummiringe und lege sie dazu; dann stelle ich mich hinter Ama und gehe ans Werk. Als erstes entferne ich die u-förmigen Haarnadeln aus ihrer Nackenrolle, löse eine Art borstigen Lockenwickler heraus und lege ihn in die Blechdose. Ich fasse diesen Rollenfüller mit Widerwillen an, denn er enthält Verunreinigungen, deren nähere Beschreibung ich mir und Ihnen, liebe Leser, hier nicht antue. Als nächstes nehme ich die normale Bürste zur Hand und beginne vorsichtig Amas schwarzes schulterlanges Haar zu bürsten, und Ama beginnt zu gurren und zu schnurren, um mir zu signalisieren, welches Behagen ihr diese Berührung bereitet. Vielleicht, denke ich heute, waren es die einzigen Streicheleinheiten, die sie erhielt, denn wer streichelt schon eine alte Frau. Was sage ich da: alte Frau? Sie war damals jünger als ich es jetzt bin, kaum sechzig. Und selbstverständlich bin ich keine alte Frau; schon erstaunlich, dieser Unterschied, meinen Sie nicht?
Wenn ich finde, dass ich Ama lange genug gebürstet habe, tausche ich die Bürste gegen den Kamm. Mit dem ziehe ich ihr einen Mittelscheitel, teile ihr Haar und flechte zwei dünne Zöpfe oder, wenn es besonders lustig sein soll, vier ganz dünne. Die binde ich an den Enden mit Gummiringen und klammere oder stecke sie mit den u-förmig gebogenen Nadeln zu einer Gretlfrisur hoch. Oder ich flechte nicht, sondern ich binde mithilfe von Schleifen zwei Schwänzchen, eines über dem rechten und eines über dem linken Ohr, und nenne meine Großmutter Pipi Langstrumpf; oder ich binde ihr einen Pferdeschwanz und nenne sie eine kesse Göre (diesen Ausdruck habe ich aus der Zeitschrift Bravo); oder ich lasse ihr das Haar offen hängen, stecke hier und da ein Kämmchen hinein und sage, mit der Frisur könne sie auf den Ball gehen. Jaja, auf den Federnball (ins Bett) lacht sie. Ich flechte und klammere und stecke und binde und begutachte sie jeweils von allen Seiten – perfekt. So irgendwie zurechtgemacht lasse ich sie sitzen, nehme die Babybürste zur Hand und wechsle meinen Standort. Ich stelle mich hinter den Großvater, nehme ihm die Pullmankappe ab und bürste seine Glatze und die Härchen drumherum. Zum Abschluss der Bürsterei suche ich sein Narbenschüsselchen am Hinterkopf, taste mit dem Zeigefinger die Ränder ab und kann es nicht lassen hineinzutasten. Da erfühle ich unter der dünnen Haut dieses Loch im Knochen und es graust mir. Schnell ziehe ich meinen Finger zurück. Mein Großvater setzt sich seine Pullmankappe wieder auf und rückt sie zurecht. Ich wechsle abermals meinen Standort, stelle mich erneut hinter die Großmutter und befreie sie von Klammern, Kämmchen und so weiter, löse Verflechtungen und Bindungen und bürste das Haar noch einmal für eine Weile. Für die Nacht bleibt es dann so – offen.
Nicht immer werde ich die noch herumliegenden Frisierutensilien weggeräumt haben, denn um Viertel vor acht wird oben im ersten Stock unsere Wohnungstür geöffnet und meine Mutter ruft nach mir, das bedeutet: Zeit zum Schlafengehen. Ja, meine Mutter schreit mich herbei, obwohl sie Amas Herbeischreien der Orthelferin so unhöflich, ja unmöglich findet. Scheint’s, dass im Umgang mit Kindern die zwischen Erwachsenen geltenden Höflichkeitsregeln nicht gelten.
Ich gebe Ama ein Eili – bei einem Eili wird die Wange kurz an die Wange des Gegenübers gelegt, damals eine Geste der Liebkosung zwischen Menschen, die sich nahe stehen. Vergesse ich, weil in Eile, das Eili, fordert sie es ein. Gib a Eili, sagt sie und hält mir ihre weiche Wange hin. Nach dem Eili steht sie auf, wendet sich zur Kredenz, nimmt den Deckel von der Porzellandose und entnimmt ihr ein Bettsteigerl (Betthupferl). Das überreicht sie mir, wenn ich vom Eiligeben beim Großvater auf dem Weg zur Tür wieder an ihr vorbeikomme. Ich sage Danke und Gute Nacht, stecke mir das Bettsteigerl in den Mund und gehe nach oben. Dort muss ich mich waschen und für die Nacht umziehen, um acht Uhr soll ich im Bett liegen. Bei uns wurde früh schlafen gegangen, einmal, weil mein Vater schon um halb fünf aufstehen musste, und zum anderen, weil meine Eltern ausreichenden Schlaf als eine notwendige Voraussetzung für Wohlbefinden und Gesundheit erachteten.
Die Großeltern gingen nicht so früh schlafen. Sie verbummelten die Abende bei Kartenspiel Lektüre Kreuzworträtseln und Radiohören. Wie schon früher einmal erwähnt, war Großvater Jo abends hin und wieder aushäusig, und hin und wieder blieb er aushäusig und Ama bereitete ihm bei seiner Heimkehr am nächsten Tag einen lautstarken Empfang: Schrei-Zack-Klescha.
An den Abenden seiner Aushäusigkeit war sie jedoch keinesfalls schlecht gelaunt. Wenn ich gegen halb sieben nach kurzem Anklopfen das großelterliche Wohnzimmer betrat, saß sie am Tisch und löste ein Kreuzworträtsel. Ich fri-sierte sie, sie blätterte in einer Illustrierten und las mir das eine oder das andere daraus vor. Danach spielten wir Mikado. Da muss man aus einem Haufen von einundvierzig Stäbchen, die wie hölzerne Stricknadeln aussehen, eines herausholen und darf mit dem Herausholen von Stäbchen so lange fortfahren, bis dabei ein Stäbchen, das man gerade nicht herausholen will, auch in Bewegung gerät. Da muss man aufhören und der andere kommt dran. Jedes Stäbchen hat einen bestimmten Punktwert und wer am Ende, wenn der ganze Haufen abgeräumt ist, mehr Punkte hat, ist der Sieger. Es geht hier um Fingergeschicklichkeit, Aufmerksamkeit und Konzentration. Wir spielen schweigend. Nur die Pendeluhr redet ihr igga-igga-igga (oder iggá-iggá-iggá – so oder so kann ich es hören) in die Stille hinein, und wenn sich ein Stäbchen durch das Niederdrücken eines Endes mit dem rechten Zeigefinger am anderen Ende hochschwingt, sodass es mit der linken Hand vorsichtig abgehoben werden kann, gibt es ein leises Sirren von sich. Und freilich, immer wenn sich ein falsches Stäbchen bewegt, schreien wir beide auf.
Einmal kam der Großvater vom Besuch bei den Freunden schon nachts nach Hause und es war ihm schlecht. Er erbrach sich und mit seinem Mageninhalt entfielen ihm auch seine Zähne und plumpsten ins Plumpsklo (kleine Sünden straft der liebe Gott sofort), und plumpsten weiter durchs lange Rohr nach unten bis in die Jauchengrube im Garten. Weil mein Großvater ein sparsamer und eher armer Mann war und am Vertrauten hing, schöpfte er am nächsten Tag mit einem großen hölzernen Schöpfer die Jauche aus dem betonierten Schacht unter der Gartenstiege und entleerte sie in den vorfrühlingshaften Garten. Meine Mutter und ich standen am Fenster und schauten ihm zu, am Fenster unter uns stand die schadenfrohe Ama, die uns bereits über den Zweck des großväterlichen Tuns aufgeklärt hatte. Meine Mutter schimpfte über diese Sauerei, abgesehen vom Gestank sei das verboten wegen der krank machenden Keime. Aber sie ging nicht hinunter und wies ihn zurecht. Nein, tat sie nicht, denn der Großvater, stur wie er war, hätte bestimmt ungerührt weiter in der Scheiße gerührt. Als er sein Gebiss endlich fand, hatte er schon die halbe Jauchengrube ausgeschöpft. Die andere Hälfte ließ er jetzt drin, gab die hölzerne Abdeckung wieder in den Betonrahmen und lehnte den Schöpfer in die Ecke. Sein Gebiss klaubte er auf – Pfui Deifl!, rief meine Mutter am Fenster dazu –, wickelte es in dafür bereitgelegtes Zeitungspapier und trug es nach oben. Er wusch es unter dem fließenden Wasser am Hausbrunnen, kochte es anschließend zur Desinfektion in Wasser aus und setzte es mit einem Klack wieder ein. Pfui Deifl, sagte meine Mutter viele Male, als sie meinem Vater am Abend vom Verlieren, Suchen und Wiederfinden, und von der Wiederverwendung des Gebisses erzählte.
Ja, bei uns ging es noch irgendwie mittelalterlich zu: hinterm Haus die Scheiße und vorm Haus die Pisse. Denn angeblich, so das Gerücht, wurde vom ersten Stock des Hauses neben uns allfrühmorgendlich der Inhalt eines Nachttopfes auf die Alte Straße entleert.
Mein Vater war auf d’Nacht bis auf sehr wenige Ausnahmen (Betriebsausflüge) nie allein aushäusig. Meine Eltern gingen gleich nach mir gegen halb neun zu Bett. Ob sie da schon schlafen konnten? Ich jedenfalls lag meist noch lange wach und lauschte den in unregelmäßigen Abständen vorbeifahrenden Autos hinterher. Lesen durfte ich nicht, als Unterhaltung blieb mir das Den-ken. Ich erfand mir Denk-Spiele.
Bei einem Denkspiel sortierte und zählte ich meinen Gewandbestand: Unterhemden Unterhosen Strümpfe Schals Hauben Pullover Röcke Kleider. Ich legte alles nebeneinander, versammelte arme nackte Kinder um mich und kleidete sie damit ein. Dann ließ ich sie wie bei einer Modenschau an mir vorbeidefilieren, arrangierte hier und da etwas um und zählte mit, wie viele ich hatte einkleiden können. Wenn ich dabei nicht einschlief, führte ich die nun Bekleideten zu einer (tatsächlich existierenden) Holzhütte im Feenthal, die ich mit Möbeln aus unserem Mobiliendepot ausstattete, und mit Geschirr aus unserer Kredenz, und mit Decken und Kissen, die brauchten sie ja auch. Ich verteilte mein und unser Weniges und es erfüllte mich mit Behagen, wie viel es war, darüber schlief ich ein.
Ein anderes Denkspiel war das Schön-Denken, wie ich es bei mir nannte; in einer Version entrückte ich mich in eine Villa am See. Dort wandle ich in prächtigen Kleidern durch prächtige Räume und habe jede Menge Hauspersonal. Ein attraktiver Mann besucht mich, er sieht aus wie Gerhard Riedmann oder wie mein aktueller Schwarm vom Eislaufplatz oder ganz anders – aber immer attraktiv. Mit dem Mann spaziere ich um den See. Wir plaudern, er legt seinen Arm um mich, zieht mich an sich, beugt sich zu mir herab und legt seine Lippen auf die meinen. So stehen wir da, lange. Ich sinke an seine breite Brust, wir seufzen und stehen immer weiter so da, bis ich einschlafe. Wenn ich nicht einschlafe, muss ich die Szene wiederholen, wenn nötig mehrmals und etwas variiert.
Ein ganz anderes Denkspiel war das Schlimm-Denken. Da dachte ich mir zum Beispiel aus, dass ich in die Konditorei Weiss ginge und mich dort ganz unmöglich verhielte. Nämlich wie? Ja so: Ich stelle mich breitbeinig vor die Vitrine und entlasse wie ein Bub einen frechen Strahl auf die dort liegenden Mehlspeisen mit Rauchgeschmack – im Klartext: Ich pinkle drauf. Eigentlich ja höchstens eine lässliche Sünde, aber ein Tabubruch vom Feinsten. Und der Hauptspaß dabei sind die entsetzten Gesichter um mich herum, die aufgerissenen Augen und Münder, die Schreie voller Ekel und Abscheu. Ha, denen hab ich’s gezeigt! Ähnliches, vermute ich, haben die Wiener Aktionisten (Otto Muehl u. a.) bei ihrer Uni-Ferkelei am 7. Juni 1968 empfunden. Freilich, ihre Provokation war Kunst, meine nur eine phantasierte Ferkelei, weshalb ich mich nicht als eine Vorläuferin des Wiener Aktionismus bezeichnen kann.
Kürzlich erzählte mir meine Freundin Monika, dass sie eine Zeit lang, auch etwa im Alter von zehn Jahren, von der Vorstellung verfolgt wurde, bei einem Gottesdienst nackt durch den Mittelgang zu rennen. Ein richtiger Zwangsgedanke sei das gewesen, verbunden mit der Angst, es eines Tages wirklich zu tun. Natürlich hat sie es nie getan, wie auch ich nie auf Mehlspeisen gepinkelt habe – weder auf verrauchte noch auf nicht verrauchte, weder öffentlich noch privat.