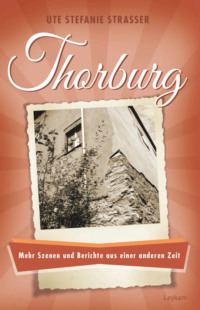Kitabı oku: «Thorburg», sayfa 5
Erster Exkurs:
Von den Tücken der deutsch-österreichischen Kommunikation
Wenn Sie schon nicht den ganzen Exkurs lesen möchten, nehmen Sie bitte wenigstens die darin angesprochene Problematik zur Kenntnis.
Ja, das gibt es: das deutsche Deutsch und das österreichische Deutsch einschließlich der jeweiligen Umgangssprachen mit ihren regionalen Unterschieden; von den Dialekten, will ich hier gar nicht groß reden.
Wenn ein Deutscher (D; damit sind Frauen und Männer, alle dazwischen liegenden Variationen und Kinder gemeint) in der Steiermark Karfiol hört oder Topfenkolatsche, oder ein Wort wie Traunschtga oder Gschroppn, erkennt er es als ein fremdes Wort, so als wär’s spanisch oder chinesisch (was er beides nicht spricht). Er fragt deshalb nach und erfährt, dass Karfiol Blumenkohl ist und eine Topfenkolatsche eine Quarktasche, dass eine Traunschtga eine einfältige Frau ist und dass Gschroppn kleine Kinder sind. Auch wenn ein Österreicher (Ö; damit sind Frauen und Männer, alle dazwischen liegenden Variationen und Kinder gemeint, aufgrund meines Herkommens vorrangig aus der Steiermark) angesichts von Teuerungen sagt, es gehe ihm der Schiach an, merkt der D die Lücke in seinem Wortschatz und lässt sich über die Bedeutung dieser Phrase aufklären; und dann solidarisiert er sich mit dem Ö, denn die Inflationsrate macht ihm auch Angst. Nun gibt es aber viele österreichische Wörter und Redewendungen, die der D nicht als fremd erkennt, obwohl sich deren Bedeutungen nicht mit den Bedeutungen im deutschen Deutsch decken. Als Folge davon kann es zu Missverständnissen und Unstimmigkeiten kommen, wobei zu sagen ist, dass der Ö den D in der Regel besser versteht, da ihm neben der österreichischen meist auch die deutsche Sprachvariante geläufig ist.
Schauen wir uns ein paar Beispiele an.
Wenn ein D von einem Ö hört, dass es sich mit dem Geld nicht ausgeht (siehe oben), überhört er das sich leicht und meint womöglich, dem Ö gehe das Geld nicht aus – aber ganz das Gegenteil ist ja der Fall: Dem Ö ist das Geld schon ausgegangen, er kann sich den Kuchen nicht mehr leisten. Der D würde in diesem Fall sagen es kommt nicht mehr hin mit dem Geld, eine Formulierung, die der Ö im Prinzip versteht, doch kann sie ihn auch verwirren, und er fragt sich, wohin der D mit seinem Geld kommen oder vielleicht fahren will.
Es verblüfft einen D, wenn ihm ein Ö rät, er solle beim Auf-den-Berg-Gehen öfters ausrasten, denn er sieht keinen Sinn dahinter, auf einer anstrengenden Bergwanderung auszuflippen. Deshalb schaut er nach dieser Empfehlung etwas ratlos drein, fragt jedoch nicht unbedingt zurück, sondern hält den Ö für komisch. Der wiederum versteht nicht, warum der D auf seinen Rat hin, sich auf einer anstrengenden Wanderung öfter einmal auszuruhen, so ein Gesicht zieht.
Ein Ö sagt, dass er jemanden nicht möge, weil der andere Leute ausrichte. Hier denkt ein D eher nicht an schlechte Nachrede, sondern an ein Geradeausrichten anderer im militärischen Sinn oder an ein Den-Kopf-Zurechtsetzen. Einen Leute-Ausrichter hält er deshalb eher für eine autoritäre denn eine verleumderische Person.
Ein D weiß vermutlich nicht, was ein Ö getan hat, wenn der ihm erzählt, er habe gerade eine Grippe übertaucht, der D würde dafür überstanden sagen; damit hätte der Ö kein Problem, er kennt diese Formulierung.
Ein Ö kommt zu spät zu einem Treffen mit einem D und entschuldigt sich, er sei auf dem Weg durch den Park an einem Spielplatz vorbeigekommen. Da habe ihn ein Kind auf einer Hutsche (Schaukel) gebeten, es ein wenig anzutauchen (anzuschubsen); diese Bitte habe er nicht abschlagen können. Danach habe er sich eh gedummlt (von tummeln, beeilen), aber leider – es tue ihm leid. Von diesen entschuldigenden Erklärungen versteht der D einiges nicht, obwohl der Ö alles in einwandfreiem Deutsch vorgebracht hat. Seltsame Ausreden, denkt er sich, unwahrscheinlich, dass er nachfragt.
Vielleicht fragt er nach, falls der Ö sein Zuspätkommen damit entschuldigt, dass er im Park hergefallen sei. Über wen?, fragt der D, denn er weiß nicht, dass ein Ö hinfällt, wenn er herfällt. Der Ö nimmt das Wen für ein Was und sagt: Übera Wurzel. Das verwirrt den D noch mehr, er hält die Wurzel womöglich für ein Dialektwort (ich will nicht näher drauf eingehen wofür) und das Herfallen über eine Wurzel für eine verbrecherische Handlung. Eine solche schließt er aber aus und denkt sich, der Ö mache einen Scherz, einen Schmäh (das Wort kennt er), weshalb er sich veräppelt fühlt, gepflanzt, wie ein Ö sagen würde. Kein idealer Gesprächsstart.
Überhaupt, der unterschiedliche Gebrauch von Umstands- und Vorwörtern hat es in sich: Der Ö fällt her, der D fällt hin; der Ö hält sich an, der D hält sich fest; der Ö schaltet das Licht auf und ab, der D schaltet das Licht an und aus; der Ö feiert zu Weihnachten, der D feiert an Weihnachten; der Ö fährt auf Urlaub, der D fährt in den Urlaub; und während man sich in Österreich die SZ am Wochenende um 3,90 Euro kaufen muss, bekommt man sie in der BRD schon für 3,20 Euro. Und kennen Sie den? Frage: Warum ist der Ö klüger als der D? Antwort: Weil er in die Schule geht und nicht wie der D bloß zur Schule.
Ein D lacht, wenn ihm ein Ö nach einer Party anbietet, er könne ihn heimführen, zwar denkt er nicht, der Ö wolle ihn heiraten, aber er sieht vor seinem inneren Auge, wie dieser beherzt seinen Unterarm unter den seinen schiebt oder ihn bei der Hand nimmt und nach Hause führt. Er versichert dem Ö, dass er nüchtern sei und diese unterstützende Begleitung zur Bewältigung des Heimweges nicht benötige. Sollte ihn der Ö, vorausgesetzt er sei ebenfalls nüchtern, jedoch heimfahren wollen, nehme er das gerne an.
Ein Ö erwähnt, dass er studiert hat; ein D, immer interessiert an der beruflichen Laufbahn anderer, fragt ihn, was er studiert habe. Da sagt der Ö, er habe letzte Nacht lange wach gelegen und hin und her studiert, ob er nach Kärnten oder nach Tirol auf Urlaub fahren soll. Der Ö setzt hier Nachdenken und Studieren gleich – ist ja nicht falsch.
Ein Ö bittet einen D um einen Schreiber. Bei dem Bittsteller handelt es sich keineswegs um einen Analphabeten, im Gegenteil, weil er alphabetisiert ist, braucht er jetzt einen Stift – nein, keinen Lehrling, sondern einen Bleistift oder einen Kugelschreiber, denn er hat den seinen nicht mit – bzw. dabei.
Eines Abends informierte ich (Ö) meinen Ehemann (D) darüber, dass ich noch schnell den Müll (Abfall) austragen würde. Da hat er mich gefragt, ob ich einen Job als Müllausträgerin, vergleichbar dem einer Zeitungsausträgerin, angenommen hätte. Er nämlich bringe den Müll immer nur hinaus zur Mülltonne, noch nie habe er ihn an Nachbarn verteilt.
Ein andermal sagte ich zu meinem deutschen Kollegen an der Universität in Frankfurt am Main, wir müssten uns das mit der Klausuraufsicht noch ausreden, worauf er mich erstaunt fragte, wieso ich ihm die Aufsicht ausreden wolle. Wollte ich nicht, er hätte sie von mir aus allein machen können. Nein, ich wollte mit ihm absprechen, wer von uns beiden wann, erste oder zweite Halbzeit, die Aufsicht übernimmt. Das erklärte ich ihm, er hörte zu, ließ mich ausreden und hat’s verstanden.
Übrigens: Dieser Kollege ist heute Psychotherapeut und heißt Alexander Boxan. Sein Name sei genannt, denn er hat mir im März 2015 vor Zeugen bedeutet, dass er nichts dagegen hätte, wenn ich ihn in meinen Text hineinnähme. Das habe ich hiermit getan.
Möchte noch jemand in einen Text hinein? Sie vielleicht, lieber Leser – ja, Sie meine ich, der Sie diese Zeilen gerade lesen. Literarische Verankerung in meinem nächsten Buch gefällig? Wir könnten ins Geschäft kommen: Ich schreibe Sie in mein drittes Buch hinein, und dafür verpflichten Sie sich, zwei Exemplare dieses Buches zu kaufen, die ich selbstverständlich signiere. Sie lassen sich also jetzt auf eine sogenannte Proskriptionsliste eintragen und helfen mir damit die Druckkosten zu finanzieren.
Voilà, die Liste ist eröffnet – wer drauf will, bitte melden! Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit ihren Bekannten aus einem Buch herauszuwinken, werden Sie ein Buchwinker analog den sogenannten Telewinkern, das sind diese Leute, die, wenn sie zufällig von einer Fernsehkamera erfasst werden, beherzt in unsere Wohnzimmer hineinwinken.
Ganz knifflig kann es in der verbalen Kommunikation zwischen Österreichern und Deutschen werden, wenn Wörter, die das gleiche bedeuten, ein klein wenig anders lauten. Wenn ein D zum Beispiel liest, das Fenster sei nicht öffenbar oder die Tür sei nicht benützbar, oder einen Ö vom Wissenschafter sprechen hört, klingt das in seinen Ohren irgendwie schräg, ja falsch. Wenn umgekehrt ein Ö einen D Wissenschaftler sagen hört, erinnert ihn das an einen Gschaftlhuber, einen hyperaktiven Macher, typisch deutsch. Ein Ü statt einem U, ein L zu viel – Beispiele für Jean Pauls Worte: Misstöne desto härter kreischen, je näher sie dem Einklange sind. Dass sich Österreicher und Deutsche durch die gleiche Sprache voneinander unterscheiden, soll nach Robert Sedlaczek schon Karl Farkas (und nicht Karl Kraus) formuliert haben.
Ich hoffe, ich habe Sie, liebe Leser, egal auf welcher Seite Sie stehen, ob Sie ein D oder ein Ö sind, mit meinen Beispielen für die oft feinen Unterschiede zwischen dem österreichischen Deutsch und dem deutschen Deutsch sensibilisieren können. Und ich hoffe sehr, dass Ihnen aus dieser Sensibilisierung die Einsicht erwächst, dass es nicht ein richtiges und ein falsches Deutsch gibt (das gibt es in einem anderen Sinn selbstverständlich auch), sondern ein vielfältiges Deutsch; es gibt ja auch noch die Umgangssprachen und die Dialekte und das Schwyzerdütsch, und schon einmal was vom Mittelhochdeutschen gehört? Ganz schön vertrackt, nicht wahr?
Aber letztendlich, das müssen Sie zugeben, macht es keinen Unterschied, ob man in den Urlaub oder auf Urlaub fährt (Hauptsache: man freut sich drauf), ob man einen Nadelstreifenanzug oder einen Nadelstreifanzug trägt (Hauptsache: er sitzt gut), ob der Teller oder das Teller auf dem Tisch steht (Hauptsache: er oder es ist voll). Also, üben Sie Nachsicht gegen den, der ein etwas anderes Deutsch spricht und fragen Sie einfach nach, wenn Ihnen Wörter oder Formulierungen spanisch vorkommen.
Und üben Sie bitte Nachsicht mir gegenüber, denn in meinem Wortschatz sind mittlerweile das deutsche Deutsch und das österreichische Deutsch ineinander gewuchert und miteinander verwachsen und verknäult, ein Zustand, der mir erst beim Schreiben so richtig klar geworden ist.
So, das war jetzt der Versuch eines Beitrages zur deutsch-österreichischen Völkerverständigung. Sollten Sie mehr zu diesem Thema wissen wollen, empfehle ich Ihnen Robert Sedlaczek und Sebastian Lörscher.
Exkurs Ende
Weiter mit unseren Besuchern.
Ich muss ungefähr dreizehn Jahre alt gewesen sein, als meine Eltern den Schwarzweiß-Fernseher anschafften. Jetzt ging ich nicht mehr jeden Abend zu den Großeltern hinunter, jetzt kamen sie fast täglich zum Nachrichten-Schauen zu uns herauf. An den Samstagabenden kam Frau Lauri für die Sen-dung nach den Nachrichten und an manchen Sonntagnachmittagen schauten wir, wie oben erwähnt, mit T.Resa und Onkel F. fern.
Während der Woche zog sich mein Vater nach den Nachrichten zurück, wir anderen durften, wenn wir wollten, noch ein bisschen sitzenbleiben. Was uns da am Bildschirm geboten wurde, erinnere ich nicht mehr so genau, nur dass Großvater Jo nach der Nachrichtensendung Zeit im Bild einschlief. Das fiel auf, weil er zu schnarchen begann – leise, aber meine Mutter fühlte sich trotzdem gestört. Sie schwieg dazu, wenn Ama dabei war, nahm nur einen verkniffenen Gesichtsausdruck an; war der Großvater alleine da, weckte sie ihn grob. Zuerst sprach sie ihn laut an mit Vota? und Hallo! Wachte er davon nicht auf, fasste sie ihn am Arm oder an der Schulter und rüttelte ihn ein bisschen. Schlug er die Augen auf und schaute sie erschrocken an, befahl sie ihm, heim ins Bett zu gehen. Er folgte ihrer Aufforderung ohne Murren, wenn auch leicht schwankend, weil schlaftrunken.
An den Samstagabenden kam Frau Lauri, ihren Ehemann brachte sie nie mit. Von ihm sagte sie: Der spinnt scho wieda, oder: Der spinnt nou imma. Damit bedeutete sie uns, dass er beleidigt sei und nicht mit ihr rede. Warum er beleidigt war, das wusste sie nie, da konnte sie nur raten, denn er sagte es ihr nicht. Das war seine Rache für ihr Vergehen, von dem sie nichts wusste. Während sie also mit uns vor dem Fernseher saß, saß ihr Ehemann spinnend zu Hause, oder vielleicht nicht spinnend sonstwo, wer weiß. Irgendwann reichte es ihr –
weil er überhaupt nicht mehr aufhörte mit seinem schweigenden Spinnen, reichte sie die Scheidung ein. Später heiratete sie wieder, und weil der neue Mann einen Fernseher hatte, kam sie nicht mehr zu uns zum Fernsehschauen.
Frau Lauri kam gegen acht Uhr und wir schauten Heiteres Berufe Raten. Bevor das harmlose Ratespiel um den Beruf des jeweiligen Kandidaten begann, wurde der vom Spielleiter Robert Lembke gefragt: Welches Schweinderl hätten S’ gern?, denn es gab verschiedenfarbige zur Auswahl. Nachdem sich der Kandidat sein Schweinderl ausgesucht hatte, machte er typische Gesten seines Berufes und das vierköpfige Rateteam, unter denen Prominente wie die Schauspielerin Marianne Koch waren, durfte ihm Fragen stellen, die er bejahen oder verneinen musste. Nach jeder mit einem Nein beantworteten Frage warf ihm der Herr Lembke eine Münze ins Schweinderl, ich glaube es waren fünf D-Mark. Wenn er Glück hatte, errieten sie den Beruf lange nicht oder gar nicht, und er durfte ein schweres Schweinderl heimtragen; und bestimmt erhielt er zusätzlich eine Reise- und Unkostenvergütung.
Oder wir schauten Einer wird gewinnen mit Hans Joachim Kulenkampff. Oder wir schauten eine Operette oder ein Theaterstück vom Ohnsorg-Theater oder eine Schlager-Parade. Wir saßen auf den Fauteuils und auf der Bettbank um einen rechteckigen Tisch, den man nach Bedarf hoch oder niedrig kurbeln konnte. Auf dem Tisch standen Schüsselchen mit Soletti-Salzstangen, mit Erdnüssen, mit Kartoffelchips und ähnlichem Zeug. Mein Vater und ich lümmelten und knabberten, die beiden Frauen saßen aufrecht und enthielten sich des Knabberns – nein, heute Abend dürfen sie nichts mehr. Wir befinden uns in den Sechzigerjahren, da frau bereits auf die Figur achtet.
Schon damals gab es Reklame im Fernsehen, allerdings noch eindeutig vom übrigen Programm abgesetzt, vor und nach einem Film und nicht mittendrin. Wenn für irgendein Knabberzeug geworben wurde, das mein Vater nicht kannte, wollte er es ausprobieren, meine Mutter solle es kaufen. Mein Vater war amaleckig (oral neugierig), er wollte immer alles kosten, koste es, was es wolle. Sagte meine Mutter, so etwas Ähnliches habe sie doch letztens gekauft und es habe ihm nicht geschmeckt, ob er das nicht mehr wisse, zog er ein schiefes Gesicht und antwortete: Missgunnst mas leicht? Er unterstellte ihr, halb im Spaß, sie missgönne es ihm vielleicht. Wenn sie daraufhin protestierte, nein, es sei einfach schade ums Geld, versprach er ihr ein Extrageld dafür, eine Aufstockung des Haushaltsgeldes. Sie ging also und kaufte es, und wir alle durften am nächsten Wochenende davon probieren. Ausführlich wurde das Preis-Leistungs-Verhältnis diskutiert und anschließend entschieden, ob sie es wieder kaufen oder dies lieber unterlassen solle.
Abgesehen von den regelmäßigen Besuchen, die wir rund um das Jahr erhielten, gab es noch die besonderen, die außertourlichen, zu unseren Geburts- und Namenstagen.
In manchen Kalendern steht an jedem Tag der Name eines/einer Heiligen drinnen. Der/die Heilige, dessen/deren Namen man trägt, ist zusätzlich zum Schutzengel noch ein persönlicher Schutzpatron / eine persönliche Schutzpatronin, und seinen/ihren Gedenktag haben wir als Namenstag gefeiert. Der 27. Dezember zum Beispiel ist der Johannstag (Johannestag) und war somit der Namenstag meines Großvaters und meines Vaters, den dieser Brauch nicht störte. Damit war er aufgewachsen, das war Tradition nicht Religion, das verband er nicht mit Kirche. Meinen Namenstag hätten sie bezugnehmend auf meinen zweiten Vornamen auf den 26. Dezember, den Stephanitag, legen können, aber das war ihnen zu viel Gedränge in diesem Monat mitNikolaus (& Krampus) und Weihnachten und Silvester und den zwei Geburtstagen (den meinen und den meiner Mutter) und den zwei Namenstagen. Also legte meine Mutter den 16. Februar für mich fest, denn Namenstag musste sein. Dass sie gerade diesen Tag wählte, habe ich nie verstehen können, denn in unseren Kalendern stand an diesem Tag Jahr für Jahr Juliane. Meine Mutter behauptete aber, sie habe einmal einen Kalender gehabt, da sei an diesem Tag mein erster, der von ihr ausgewählte Name gestanden. Das muss ein Druckfehler gewesen sein, oder sie hat sich verlesen oder – sie log. Es gibt keine heilige Ute; ich hätte eine werden können, wenn das damals im Feenthal mit der Marienerscheinung geklappt hätte.
Nebenbei bemerkt: Ob eine Marienerscheinung für mich von Vorteil gewesen wäre, kann ich nicht beurteilen, aber für die Region wäre sie das gewesen, denn mit Sicherheit hätte sie den Tourismus und damit den wirtschaftlichen Aufschwung des oberen Murtals gefördert. Inzwischen gibt es da ja eine Rennstrecke, den Red-Bull-Ring, die den Tourismus zumindest saisonal ankurbelt. ABER: Um wie viel umweltfreundlicher und noch dazu rund ums Jahr hätte die Heilige Maria den Tourismus ankurbeln können, hätte sie sich dazu herabgelassen, mir zu erscheinen, anstatt sich oben hinter einer Wolke zu verstecken.
Am Vorabend zu meinem Geburtstag gehe ich nicht nach unten, sondern ich beginne nach dem Abendbrot um sechs Uhr auf die Gratulanten zu warten. Ich beschäftige mich mit irgendetwas, tue ganz gewöhnlich, lausche aber insgeheim nach draußen. Spätestens gegen sieben Uhr knarren dort die Stufen unter vorsichtigen Schritten – die Großeltern schleichen sich heran, ihr Klopfen sollte aus dem Nichts kommen. Poch-poch-poch – dreimal pocht es an die Tür. Das Dreimal ist wichtig, es betont das Besondere des Einlass Begehrenden. Meine Mutter tut den Hereinruf, die Tür öffnet sich und Ama schiebt sich, Kopf voraus, zur Tür herein. Ihre Hände hält sie hinter dem Rücken versteckt; nach ihr kommt der Großvater. Da stehen sie und sagen Guten Abend und lächeln mich an. Wir spielen verwundert ob ihres Auftretens. Sie aber gehen schnurstracks auf mich zu. Ama wünscht mir alles Gute, auch im Namen des Großvaters (Wir wünschen dir …), holt das Blumenstöckchen (rosa Zyklamen) von hinter ihrem Rücken hervor und überreicht es mir. Ich geb’s meiner neben mir stehenden Mutter weiter, die stellt es auf den Tisch. Jetzt holt der Großvater das Päckchen von hinter seinem Rücken hervor, dar-in sind Pralinen oder ein Buch oder Unterwäsche, gibt es der Großmutter, die wiederum gibt es mir und ich geb’s meiner Mutter, die es auf den Tisch legt. Nun muss ich den Großeltern die Hand und ein Eili geben und mich bedanken; und der Großvater zieht noch den Briefumschlag mit der Glückwunschkarte und dem Geldschein aus der Westentasche und lehnt ihn an den Zyklamenstock. Wir setzen uns an den Tisch, ich öffne das Paket und rufe Oh, und danke! Dann gibt es Tee Wein Eierlikör und Torte – jedes Jahr die gleiche, das wünsche ich mir so. Leider, lieber Leser, kann ich Ihnen kein Stück davon aus dem Text hinausreichen. Wenn Sie die Torte trotzdem kosten wollen, planen Sie zwei Stunden Zeit ein und vergewissern Sie sich, dass Ihnen eine Springform, eine Rührschüssel, ein Kochlöffel oder ein Mixer und ein Backrohr zur Verfügung stehen. Zutaten und Arbeitsablauf finden Sie im folgenden Rezept. (Weil Sie vermutlich schon älter sind und womöglich auf Ihren Cholesterinspiegel achten müssen, und auf die Linie sowieso, habe ich die Variante ohne Butter ausgewählt.) Jetzt Schürze umbinden und loslegen.
Als erstes stellen Sie ein Biskuit her, es gibt verschiedene Rezepte dafür. Das folgende stammt aus dem mit der Hand geschriebenen Kochheft meiner Mutter:
Biskuitteig:
6 Eier werden mit 6-Ei-schwer Zucker eine halbe Stunde gerührt
6-Ei-schwer Mehl hineinsieben und verrühren,
die Masse in eine gefettete Springform gießen und
30 Minuten bei 175° backen
Meine Variante: 6 Dotter und 200 g Zucker verrühren, 200 g Mehl dazu und den Eischnee der 6 Eier darunterziehen; so wird der Teig lockerer als nach dem obigen Rezept. Wenn Sie Backpulver verwenden, wird er noch lockerer.
Während der Teig im Backrohr ist, können Sie in Thorburg oder in einem anderen Buch lesen, oder stricken, aber bitte behalten Sie dabei den Teig im Auge (und in der Nase), auf dass daraus ein Biskuit werde. Sind die dreißig Minuten um, kontrollieren Sie mit einer dünnen Stricknadel (Zahnstocher geht zur Not auch), ob der Teig durchgebacken ist. Wenn ja, auf ein Gitter stürzen und auskühlen lassen. Jetzt reinigen Sie die verwendete Stricknadel(z. B. durch Ablecken) und legen Sie das Strickzeug oder das Buch beiseite, denn nun sollten Sie Rahm (Sahne) schlagen und die Glasur herstellen.
Glasur:
Ein Esslöffel Wasser mit 4 Rippen Manner Schokolade (ca. 100 g Bitterschokolade) am Feuer verrühren, bis es dick ist, dann (vom Feuer nehmen und) weiterrühren, bis es kalt ist (an den Lippen lau).
Dann: Den ausgekühlten Biskuitkuchen in zwei Teile schneiden, mit Schlagrahm (Schlagsahne) füllen; oben mit Marmelade bestreichen und die Glasur darüber gießen, nicht verstreichen!
Fertig ist meine Geburtstagstorte (zum Namenstag gab es die gleiche), und Sie können sich ein Stück davon abschneiden und es kosten. Und bitte beachten Sie, falls Ihnen die Torte nicht schmeckt, ist das nicht meine Schuld – Siehaben sie selbst gebacken. Könnte es sein, dass Sie dabei ein bisschen nachlässig waren?
Am nächsten Tag, dem Geburtstag selbst, kocht meine Mutter etwas, von dem sie weiß, dass ich es mag, zum Beispiel Eiernockerl. Dann kommt jemand von der Feenthaler Verwandtschaft zum Gratulieren, und dann kommen ein paar Schulfreundinnen. Und alle essen von meiner Geburtstagstorte, die jetzt noch besser schmeckt als am Vorabend, weil das Biskuit sich mit dem Schlagrahm vollgesogen hat.
Alle Geburts- und Namenstage verliefen ähnlich, nicht nur die meinen. Hatten Großmutter oder Großvater Geburtstag, gingen wir mit einer Kaffeecremetorte und mit Blumen zu ihnen hinunter und saßen nach dem Gratulieren eine Weile bei Tee und Torte und bemüht freundlichem Geplauder.
Rückblickend ins Feenthal habe ich eine einzige und leider unangenehme Geburtstagserinnerung. Ich muss zwischen drei und vier gewesen sein und es war ein Geburtstag meiner Oma Rosa, ein Schock Leute war anwesend. Meine Mutter hatte mir ein Gedicht beigebracht, ich sollte es der Oma als Geschenk aufsagen. Als sie mich nun zu ihr hinschob und alle zu mir herschauten, streikte ich, wie das Kinder unter Zwang gerne tun. Da packte mich meine Mutter an den Schultern, drehte mich mit dem Gesicht in die Küchen-ecke zwischen Eingangstür und Schlafzimmertür und sagte laut: I bin a klans Binkerl, i stöi mi ins Winkerl, und wali nix kau, drum faung i nix au (Ich bin ein kleiner Nichtsnutz und stell mich in den Winkel, und weil ich nichts kann, drum fang ich nichts an). Sie klatschten und lachten, sie fanden das alle lustig – außer mir. Ich stand in der Ecke und weinte ein bisschen (Plärrmadam) und flüchtete hinaus in den Hof. Dort stand ich herum, bis frau mich wieder hineinholte.
Zurück in die Thorburg.
Es gab einen Tag im Jahr, an dem ich meine Großeltern schon am frühen Morgen besuchte, spätestens gegen acht Uhr, um ihnen eine ganz spezielle Gabe zu verabreichen. Wenn es stimmt, was Draaisma sagt, nämlich dass wir vor allem gefühlsgeladene Ereignisse erinnern, ist es leicht zu erklären, warum ich diese Besuche so lebhaft im Gedächtnis habe – sie bereiteten mir ein exquisites Vergnügen. An diesem Morgen klopfte ich dreimal bei den Großeltern an, und hielt, wenn Ama mich einließ, meine Hände hinter dem Rücken versteckt. Ama sprang ins Bett zurück und ich ging an ihr vorbei zum Großvater ins Kabinett. Er lag im Bett und stellte sich schlafend. Ich zog ihm die Decke weg, holte die Birkenrute von hinter meinem Rücken hervor und gebärdete mich wie eine Rabiate – ich drosch weit ausholend auf seine Beine ein und kreischte in höchsten Tönen: Frisch und gsund, frisch und gsund, laung leibn und gsund bleibm, nix klunsn nix klogn, bis i wieda kum schlogn! (Frisch und gesund, lang leben und gesund bleiben, nicht jammern und nicht klagen, bis ich wieder komm schlagen). Der Großvater lachte und setzte sich auf – da musste ich aufhören, so war die Regel für das Frisch- und Gsundschlagen am Morgen des 28. Dezember, dem Tag der Unschuldigen Kinder – das sind die, die König Herodes auf der Suche nach Jesus hat ermorden lassen. In Sitte und Brauch in Österreich steht allerdings, dass es sich hierbei um einen uralten Fruchtbarkeitszauber handle; da hat die römisch-katholische Kirche wieder einmal sehr geschickt einen christlichen Gedenktag auf einen heidnischen Fruchtbarkeitstag gestülpt. Aber eh: katholisch oder heidnisch – für mich hätte das keinen Unterschied gemacht, ich hätte so oder so zuschlagen dürfen. Nachdem der Großvater erledigt war, ging ich mit der Birkenrute zu Ama, zog ihr die Decke weg und schlug auf ihre Waden ein, wieder so wild, dass ihr das Lachen verging und sie sich rasch aufsetzte. Ja, interessant: Ich liebte meine Großeltern, trotzdem genoss ich es, sie durchzuhauen. Und wenn sie Auweh! schrien, jubelte ich. Hatte ich ihnen rote Beine und damit, wie sie glaubten, frisches Leben und Gesundheit für das kommende Jahr angeschlagen, bedankten sie sich und gaben mir Geld.
Meine Eltern habe ich nie aus dem Bett geschlagen. Mein Vater, der zwischen den Jahren meistens Urlaub hatte und länger im Bett lag, wollte wegen so eim Blödsinn nicht gestört werden; und meine Mutter war vor mir aufgestanden, um mich zu wecken und mit der Rute zu den Großeltern zu schicken, die Wert auf die Erfüllung dieses für mich in zweifacher Hinsicht einträglichen Brauches legten.
Rund um das Jahr bekamen die Großeltern Verwandtenbesuche – Schwes-tern und Brüder, Schwägerinnen und Schwäger, Nichten und Neffen. Viele kamen aus Dörfern im Oberland und der Anlass für den Besuch war meist, dass sie im Städtchen etwas erledigen mussten. Da schauten sie dann bei den Großeltern vorbei, und der eine oder der andere kam zu uns in den ersten Stock oder wir wurden nach unten gebeten.
Am liebsten waren meinen Eltern die drei freundlichen Cousinen meines Vaters aus dem May-Haus. Die älteste von ihnen hatte jetzt schon eine eigene Familie. Wenn ihr Ehemann, mein Onkel Sepp – quicklebendig im Unterschied zu dem auf dem Bild auf Amas Anrichte – mit dem Auto ins Städtchen kam, nahm er meistens seine Kinder mit. Das Auto parkte er an der Alten Straße, die Töchter brachte er zu Ama, er selbst ging irgendwelchen Erledigungen nach.
Die kleinen Mädchen – waren es drei oder schon vier? – saßen auf der Bettbank wie die Hühnchen auf der Stange, geduckt übers österreichische Manna, den Manner Schnitten, mit denen sie ihre Schnitten-Tante, meine Großmutter, fütterte. Wer will mitfahren zur Schnitten-Tante?, habe sie der Vater jedes Mal gefragt. Ja genau, auf Hochdeutsch habe er sie gefragt, denn das sollten sie sprechen, schließlich waren sie die Kinder eines Lehrerehepaares. Ihre Mutter, meines Vaters freundliche Cousine, habe sogar Ohrfeigen verteilt, wenn ihr von Seiten ihrer Kinder ein O statt einem A, ein Jo statt einem Ja zu Ohren gekommen sei. Deshalb haben sie sich, zumindest die Töchter, angewöhnt, das A in allen Wörtern besonders lang zu betonen, zur Sicherheit, weil – wer kriegt schon gern eine Ohrfeige? Diese Gewohnheit, ein langes und breites A zu sprechen, haben sie beibehalten und an ihre Kinder weitergegeben. Deshalb wird es heute noch gesprochen, und es ist weithin bekannt als das sogenannte Neubauer-A.
Aber jetzt sitzen die kleinen Mädchen noch auf der Bettbank und sagen weder A noch O, beschäftigen sich bloß mit den Schnitten. Beißen mit ihren kleinen Zähnen, lecken mit ihren rosigen Zungen und bröseln mit ihren rundlichen Fingerlein, die bald schokoladeverschmiert sind. Wenn sie ihre Schnitten aufgegessen haben, geht Ama mit einem nassen Waschlappen die Reihe entlang und säubert ihnen Mund und Hände. Sauber gewischt schauen sie so ein bisschen rundherum und sitzen weiterhin stumm nebeneinander. Ama hat den Eindruck, die Zeit werde ihnen lang. Sie ruft mich herbei, ich soll die Schüchternen auflockern. Aber sie wollen auch mit mir nicht reden, geschweige denn Mikado oder Flohhüpfen spielen. Wenn ihr Vater endlich wieder erscheint, stürzen sie direkt auf ihn zu. Geht er dann noch auf einen Sprung zu uns, laufen sie ihm hinterher. Wenn er sich hinsetzt und mit mei-nen Eltern plaudert, drücken sie sich eng an ihn und lauschen.
Wies er seine Töchter aber an, bei Ama sitzen zu bleiben, die in diesem Fall noch eine Runde Schnitten ausgab, und kam allein zu uns hoch, ließ sich meine Mutter niemals die Gelegenheit entgehen, ihn zusammenzustauchen, wegen der Rücksichtslosigkeit gegen seine Frau, die angeblich schon wieder schwanger sei. Wie das bloß gutgehen soll – Kinder kosten Geld, viel Geld. Er lachte und sagte: Schickt der liebe Gott das Haserl, so schickt er auch das Graserl. Meine Mutter erwiderte: Dein Wort in Gottes Ohr, und schickte die Drohung hinterher: Du wirst dich noch anschauen! Er werde schon sehen, wie viele Sorgen ihm die Kinder, am Ende waren es zehn, noch bereiten würden. Er zuckte die Schultern und behielt sein Lachen, und mein Vater wies meine Mutter zurecht: Misch di do net ein! Unsa Göd issas net. Sie solle sich nicht einmischen, es sei ja nicht ihr Geld. Da ärgerte sie sich laut darüber, dass die Männer immer zusammenhalten. Und hinterher sagte sie zu meinem Vater, das verstehe sie nicht, dass seine Cousine sich nicht wehren könne, sie solle ihrem Ehemann doch Brom oder sowas ins Essen mischen, um seine körperlichen Begierden zu dämpfen. Das sei doch auch beim Militär üblich gewesen, oder?
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.