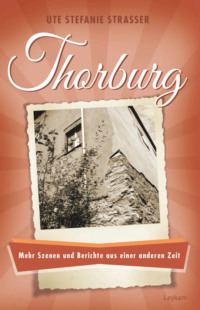Kitabı oku: «Thorburg», sayfa 4
Schön-denken, Anders-denken. Denken war Flucht in den Kopf, in die Freiheit (Ulla Hahn), das hatte ich wohl nötig angesichts der deprimierenden Situation um acht Uhr abends fremdbestimmt im Bett liegen zu müssen.
Ich erinnere mich noch an ein mittägliches Denkspiel. Wenn ich während der Woche mittags nur mit meiner Mutter zu Tisch saß, hatte sie sich im Nu abgespeist. Sie stand auf, räumte ihren Teller und ihr Besteck ab, begann hin und her zu gehen und dies und das zu tun. Ich saß weiter am Tisch mit der Aufgabe aufzuessen, damit hatte ich aber nicht selten Schwierigkeiten. So wie sich das Tor zum Schlafen nicht öffnen wollte, so wollte sich hier mein Hals nicht öffnen, es war da so eine Enge, das Essen konnte kaum durchrutschen. Da begann ich zu spielen.
Als erstes sortierte ich mein Essen auseinander – ein Häufchen Kartoffel, ein Häufchen Gemüse, ein Häufchen Fleisch. Als nächstes schuf ich innerhalb der jeweiligen Häufchen Muster – einen Kreis, eine Schlange, ein Viereck, dabei aß ich schon etwas auf, damit es passte. Und jetzt dachte ich mir, dass ich eine Königstochter bin – immer Tochter, nie Königin (die ist tot) – und dass auf meinem Teller die erlesensten Speisen liegen. Mein Vater, der König (Astrid Lindgren), hat seine Diener in aller Herren Länder geschickt, um diese Delikatessen zu erwerben; denn das Beste ist gerade gut genug für mich, die ich krank bin an Leib und Seele (warum, das spielt hier keine Rolle) und gesund werden soll. Ich sitze da und spieße jede Erbse einzeln auf die Gabel, führe sie mir bedächtig zum Mund, lege sie mir auf die Zunge und lutsche sie, sie schmeckt golden. (Wie Gold schmeckt? Gold schmeckt fantastisch!) Ich zelebriere ein Mahl der Kostbarkeiten. Mein Vater, der König, sitzt bei mir und schaut mir lächelnd zu, und um uns steht der Hofstaat und schaut mir ebenfalls lächelnd zu. Alle freuen sich, dass ich esse und also nicht sterben werde. Nur meine Mutter, die keine Ahnung hat von goldenen Erbsen, schüttelt den Kopf und jammert, auf diese Weise würde ich nie fertig werden, und überhaupt, alles sei ja schon ganz kalt, wie ungesund! Dann verlässt sie mich, geht ins Wohnzimmer oder hinunter zum Ortgang, weil sie mir im Unterschied zu König und Hofstaat bei solchem Essen nicht zuschauen möchte.
Wenn ich woanders aß, hatte ich nie Probleme mit dem Schlucken. Es kam vor, dass ich bei meinen täglichen Besuchen der Großeltern noch in deren Abendessen hineingeriet, das sie vor dem Kartenspielen einnahmen. Ama stellte mir dann einen Teller hin und ich durfte mitessen. Hunger hatte ich eigentlich keinen mehr, aber bei ihnen zu essen war interessant. Es gab eine kalte Platte mit Schinken und Wurst und Käse und Essiggurken und von Ama selbst zubereitete Salate: Kartoffelsalat mit Zwiebeln, Gurkensalat mit Zwiebeln, Bohnensalat mit Zwiebeln – keine Blattsalate, das war ihr zu viel Arbeit mit dem Putzen und dem Waschen. Amas Salate waren Erlebnissalate; wenn ich sie aß, reisten meine Geschmacksnerven durch unerwartete Sensationen: Im Sauren überraschte ein süßes Inselchen, im Wässrigen ein scharfer Knall, durchs Ölige zog sich eine salzige Spur. Ein dissonantes Miteinander war das – Öl Essig Salz Pfeffer Paprika und andere mir unbekannte Zutaten. Ich wurde von Geschmacksempfindung zu Geschmacksempfindung geworfen, salatlang ins Ungewisse hinein. Im Vergleich dazu waren die mütterlichen Salate in ihrer süßsauren Harmonie langweilig. Meine Mutter fand die Salate ihrer Schwiegermutter selbstverständlich fürchterlich. Die haue da einfach alles Mögliche drauf und mische das Ganze nicht einmal durch – zu faul dazu! Und obendrauf diese grob geschnittenen Zwiebeln – grauslich! Meine Mutter schüttelt sich; was würde sie erst zu den Salaten von Gregs Opa gesagt haben: Bohnen, Gurken und ein Haufen Kresse drauf, und das alles schwimmt in einer Schüssel voll Essig.
Es kam vor, dass mir abends im Bett ein wenig übel war, vielleicht vom doppelten Abendessen oder von Großmutters Zwiebel-Salat. Da war dann nix mit Denkspielen, da schlich ich mich zum Sekretär und öffnete die gläserne Schiebetür, wo im oberen Fach Mutters selbst Angesetzter stand. Dabei handelte es sich um einen klaren Korn auf Wacholderbeeren, Kalmuswurzel und ich weiß nicht was noch. Von diesem würzigen Schnaps nahm meine Mutter einen Schluck, wenn ihr der Magen drückte, oder wenn sie meinte das Herannahen einer Erkältung zu spüren. Irgendwann hatte ich herausgefunden, dass dieser Schnaps auch mir gegen Magenbeschwerden half und mir darüber
hinaus ein gewisses Wohlbefinden bescherte. Hätte ich nicht befürchtet, meine Mutter könnte – ja, würde den Schnapsschwund bemerken, hätte ich mir allabendlich einen Schluck aus der Bottle gegönnt. Meistens machte mich der Schnaps müde, hin und wieder machte er mich munter. Dann schlich ich mich abermals zum Sekretär, öffnete die gläserne Schiebetür und kramte von hinter den Büchern das Doktorbuch heraus. Damit ging ich zum Fens-ter, stellte mich zwischen Scheibe und Vorhang, betrachtete beim Licht der Straßenlampe die sich darin befindenden Bilder und las kreuz und quer im Text herum – ich schmökerte; schlau wurde ich nicht daraus. Zwischendurch schaute ich zum Fenster hinaus in die gähnende Leere einer Kleinstadt der Fünfzigerjahre, wo höchstens einmal einer eilig oder schwankend, oder eilig schwankend die Alte Straße hinunter ging, vom Wirtshaus nach Haus. Nicht immer, wenn mich der Schnaps munter gemacht hatte, ermunterte er mich zum Aufstehen. Nein, ab und zu blieb ich schnapslustig im Bett liegen und rezitierte Sprüche wie: Heut bei der Nacht hat der Bettpfosten kracht, ist der Scherm (Nachttopf) explodiert, sind die Mäus aufmarschiert; und das stellte ich mir lebhaft vor. Ich musste nur aufpassen, dass ich nicht zu laut lachte, das hätte womöglich meine Mutter herbeigerufen, die hätte gefragt, was los sei, und dabei meine Schnapsfahne errochen.
Sogar an Silvester gingen wir vor Mitternacht ins Bett, wozu aufbleiben? Ich durfte aber Radio hören, bis um zwölf Uhr die Pummerin vom Stephansdom ins Land läutete und der Donauwalzer erklang. Da liege ich also im Bett, während dort in Wien bildschöne Frauen in wunderschönen Ballkleidern in den Armen eleganter Männer zur inoffiziellen österreichischen Hymne tanzen. Da liege ich im Bett und bin nicht dabei – und niemals würde ich dabei sein. Ich werde sentimental und weine ein bisschen. Nach dem Donauwalzer erscheint meine Mutter im Nachthemd, sagt Prost Neujahr und schaltet mir das Radio aus. Jetzt lieg ich im Finstern, und während die Schönen und die Reichen weiter durch die festliche Neujahrsnacht tanzen, schlafe ich ein – schlaf ein …
Als wir später den Fernseher im neuen Wohnzimmer hatten (die Familie Trappl war ausgezogen und wir hatten uns räumlich ausgedehnt), feierten wir (meine Eltern und ich, die Großeltern und Frau Lauri, eine Bekannte) Silvester im Halbkreis um diese Attraktion. Wir tranken Russischen Tee mit Stroh-Rum und aßen Russische Eier auf Endiviensalat. Um Mitternacht beim Donauwalzer stießen wir mit einem Glas Sekt an, danach gingen unsere Gäste heim und wir ins Bett. Am ersten Januar aßen wir zum Frühstück am späteren Vormittag wieder Russisches, nämlich die Russen, das sind sauer eingelegte Heringe. Wir aßen sie als Mittel gegen den Kater, weil wir nachts ja ein Glas Sekt getrunken, und meine Eltern davor schon ein Glas Wein und einen Obstler.
Mit Silvester wurde die Faschingszeit und die Ballsaison eröffnet, und meine Eltern besuchten jedes Jahr mindestens einen Ball. Sie konnten mich jetzt mit den Großeltern im Haus ja bedenkenlos allein lassen.
Am Vormittag des Balltages ging meine Mutter zum Frisör, zur Frau Erna. Frau Erna war eine stattliche Person, vollschlank und sehr dunkel, mit schwarzen Locken, einem Bartflaum über der Oberlippe und Haaren an den hohen Bei-nen unter den Seidenstrümpfen mit Naht. Igitt! oder wööaa! wird sich jetzt der eine oder die andere denken, doch glauben Sie mir, liebe Leser, das ist Gewohnheitssache. Die heute angestrebte Ganzkörper-Haarlosigkeit bei Erwachsenen hätte man eher mit der rosaroten Nacktheit eines Hausschweins denn mit menschlicher Schönheit in Verbindung gebracht. Nur Haare auf den Zähnen fand man abstoßend, um eine damit Ausgestattete machte man lieber einen Bogen. Frau Erna wurde als rassig bezeichnet, sie hatte Sex-Appeal, wie man später im Zuge der Amerikanisierung unserer Sprache sagte. Sie war ein Augenschmaus, wenn sie in der Aura einer gewissen Distinguiertheit stolz einherschritt; und wenn sie mit samtiger Stimme sprach, war dies ein Ohrenschmaus und eine reizvolle Alternative zum harmlosen Zwitschern der Blondgelockten in den Filmen.
Nachdem die Haare meiner Mutter gestylt waren, eilte sie nach Hause und wärmte das Vorgekochte auf. Nach dem Essen hielten meine Eltern einen Mittagsschlaf, ein Vorausschlaf sollte das sein. Danach tranken sie echten Bohnenkaffee und meine Mutter legte die Ballkleidung zurecht, dabei gab es einiges zu besprechen. Zwar war die Auswahl nicht groß, aber ein paar Varia-tionen waren möglich: Welcher Selbstbinder (Krawatte), welches Hemd – das eine ist ein bisschen zu klein und das andere ist ein bisschen zu groß –, das schwarze Kleid oder der schwarze Rock mit der weißen Bluse, welche Halskette? Man wird es kaum glauben, aber sie diskutierten oft lange. Nach dem Abendessen rasierte sich mein Vater und meine Mutter schminkte sich: Augenbrauenstift und Lippenstift, Rouge für die Wangen und Puder für die Nase, damit diese in der Hitze des Balles nicht zu leuchten begänne. Zum Schluss tupfte sie sich etwas Tosca hinter die Ohren. Dann kleideten sie sich an. Um halb acht kamen T.Resa und Onkel F., auch schwarzweiß gewandet, um sie abzuholen. Und bevor sie nach Ermahnungen an mich, nicht zu lange aufzubleiben, feierlich gestimmt loszogen, genehmigten sie sich ein Stamperl Schnaps im Stehen.
Irgendwann wollte mein Vater nicht mehr mit T.Resa und Onkel F. auf den Ball gehen, das heißt eigentlich mit T.Resa wollte er nicht mehr. Zur Vermeidung des gemeinsamen Ballbesuchs produzierte er Kopfweh Magenweh Knieweh und dergleichen mehr Weh. Es war nämlich auf dem letzten Sängerball Folgendes passiert: Mein Vater tanzte mit T.Resa eine Polka, und während sie sich schwindlig drehten, habe meine Tante auf einmal laut Juchhu gerufen und meinen Vater wie toll ins Kreisrund gerissen, fast seien sie gestürzt. Mein armer Vater, ein krebsroter, von T.Resa gepeitschter Kreisel, wollte in den Boden versinken. Aber T.Resa, nun voll in Führung, habe noch einmal gejauchzt, schamlos in die staunende Hautevolee hinein – wohlhabende Geschäftsleute, Ärzte und Rechtsanwälte mit ihren Gattinnen. Die Gattinnen hätten pikiert geschaut (Was für ein Weib!) und die Männer grinsend (Was für ein Weib!). Da hat mein Vater beschlossen, nie mehr mit seiner Schwägerin zu tanzen. Aber freilich, bei einem gemeinsamen Ballbesuch hätte er dies als seine Pflicht angesehen; und selbst, wenn es ihm gelungen wäre, sich davor zu drücken, hätte sie ihn bestimmt bei der Damenwahl erwischt – so eine war das. Lieber also nicht mehr auf den Ball mir ihr, denn die Zähmung dieser widerspenstigen Tänzerin traute er sich nicht zu.
Diese Geschichte hat mir meine Mutter erzählt, und sie hat sie folgendermaßen kommentiert: Es stimme schon, dass die Tante tänzerisch zuweilen etwas wild werde und auch, dass sie vor Vergnügen jauchze, aber wenn mein Vater glaube, alle würden zu ihnen hinschauen und darüber reden, täusche er sich. Am Ball sei dermaßen ein Lärm und ein Gedränge, da wisse niemand so genau, wer gejauchzt hat; und dass ein Paar zu fortgeschrittener Stunde überdreht tanzt, sei üblich und nichts Besonderes. Ein paar werden halt geschaut haben, na und?
Die Stunde vor dem Abendessen, der Vorabend, war besonders im Herbst und im Winter meiner Mutter Nähstunde, und ich saß bei ihr. Wenn mein Vater im Schwimmbad (Hallenbad) oder allein auf Stadtrunde oder unten bei seinen Eltern war, gehörte diese Stunde uns beiden allein und meine Mutter erzählte mir, wie sie das schon im Feenthal getan hatte, gerne Geschichten von Seinerzeit.
Nicht selten höre ich Geschichten mehrmals, ganz gleich aber nie – meine Mutter variiert, schmückt aus, fügt neue, mir bis dahin unbekannte Details hinzu, verschiebt Handlungsschwerpunkte. Bei der Ballgeschichte etwa variiert sie die Anzahl der Jauchzer und die Größe der Gefahr, dass die beiden, mein Vater und die Tante, tatsächlich hingefallen wären. Sie erzählt mir von den Streitigkeiten ihrer Eltern, besonders eine Geschichte erzählt sie öfters, sie findet wohl, ich bin jetzt alt genug für diesen Schlag in die gemütliche Erzählstunde. Die Geschichte geht ungefähr so: Nach Entsorgung der beiden kleineren Schwestern zur Urgroßmutter sei sie, meine Mutter, von ihrer Mutter, meiner späteren Oma Rosa, zu einer Nachbarin mitgenommen und dort zurückgelassen worden – die Mutter müsse etwas erledigen. Meine Mutter half der Nachbarin ein wenig bei der Hausarbeit und spielte mit deren klei-ner Tochter. Nach gut zwei Stunden kam ihre Mutter zurück, trank mit der Nachbarin schnell einen Kaffee im Stehen und machte sich dann mit der Tochter schnellschnell auf den Heimweg. Unterwegs mussten ja noch die kleinen Schwestern abgeholt werden. Inzwischen aber war die flotte Resi der Urgroßmutter entwichen und nach Hause gelaufen. Ihr Vater, mein späterer Opa K., der nicht wusste, wem sie davongelaufen war, weil die Resi das nicht so genau sagen konnte, nahm sie an der Hand und ging seine Ehefrau suchen.
Sie begegneten sich mitten auf der Gasse, der Vater mit einem Mädchen an der Hand und die Mutter mit einem Mädchen an der Hand. Feindselig standen sie einander gegenüber. Meine Mutter vorab instruiert zu bezeugen, dass sie und ihre Mutter den ganzen Nachmittag über gemeinsam – ja, gemeinsam bei der Nachbarin gewesen seien, stellte sich vor Aufregung ungeschickt an: Sie schrie das Zeugnis angesichts des Vaters sofort ungefragt heraus und sie heulte dabei. Durch dieses ihr Verhalten erhärtete sich des Vaters Verdacht gegen seine Ehefrau. Und da passierte es: Der Vater gab der Mutter eine Ohrfeige – mitten auf der Gasse. Dann drehte er sich um und ging davon, die Resi ließ er zurück. Jetzt heulten sie heimzu, die Mutter und ihre beiden Töchter; die Resi heulte, weil ihre Mutter und die große Schwester (meine Mutter) heulten. Zu Hause hatte das Familienoberhaupt vor Zorn die Tür hinter sich zugesperrt, die drei mussten sich draußen herumdrücken; zur Urgroßmutter, von wo die Jüngste noch abgeholt werden musste, trauten sie sich so verheult nicht. Ein Glück, dass es Sommer war. Endlich, nach ungefähr einer Stunde verließ der Vater die Wohnung und ließ die Tür unversperrt.
Fürchterlich sei das alles gewesen, sagt mir die Tochter von damals, meine Mutter, unter keinen Umständen würde sie ihrem Ehemann, meinem Vater, so etwas antun – Liebe hin, Liebe her, womit sie meint, selbst dann nicht, wenn sie einen anderen lieber hätte als ihn.
Und meine Mutter erzählte mir von ihren und von meines Vaters Jugendfreunden und Jugendfreundinnen, sie redete von ihnen wie von guten Bekannten, die am nächsten Tag bei uns vorbeikommen könnten. Sie erzählte vom feschen Ludwig, Sohn reicher Winzer, der sie so gerne geheiratet hätte, aber sie war ja schon mit ihrem ersten Mann verlobt; und sie erzählte von der feschen Salzburgerin, der Fastverlobten meines Vaters, deren Fotografie ich noch immer besitze. Ich habe nicht das Herz sie wegzuwerfen. Die Helma trägt darauf eine Frisur und eine Spitzenbluse, mit der sie heute zu Beginn des 21. Jahrhunderts ganz aktuell zurechtgemacht wäre, und auf die Rückseite hat sie geschrieben: In Liebe Deine Helma, 31. Juli 1941.
Ich kannte die Helma und den Ludwig schon von früher, denn ihre Bilder lagen in der Schuhschachtel bei den losen Fotografien, die ich oft angeschaut hatte, aber erst jetzt erfuhr ich von der Sonderstellung dieser beiden innerhalb des Freundeskreises meiner Eltern.
Ich glaube, meine Mutter sehnte sich nach ihren Freundinnen und Freunden von vor dem Krieg. Sie hätte sie gerne einmal wieder getroffen, aber die Wege zueinander waren so weit, und Reisen und Telefonate viel zu teuer, und das Briefeschreiben so aufwändig. Ach, wie einfach können wir Heutigen doch zueinanderkommen! Wirklich? Doch, doch – wir simsen, wir chatten, wir mailen, wir telefonieren, wir setzen uns ins Auto und fahren hin. Wir pfeifen auf die Sehnsucht!
Viertes Kapitel
Wir bekommen Besuch
Kein besonders interessantes Kapitel, es geht darin unter anderem um Krautfleckerl und Eier; eilige Leser können es überschlagen, es sei denn, sie möch-ten wissen, was es mit dem Neubauer-A auf sich hat. Die im Exkurs angesprochene Problematik empfehle ich allerdings jedem zur Kenntnisnahme.
1. Exkurs: Von den Tücken der deutsch-österreichischen Kommunikation
Es war einmal, damals bei uns, da verabredete man sich nicht schon Wochen im Voraus und telefonierte vor dem verabredeten Treffen noch einmal, um sich zu vergewissern, dass es klappt – nein, da praktizierte man das Vorbeischauen. Man sagte: Ich schau nächste Woche einmal vorbei, oder auch: Lass dich nächste Woche einmal anschauen, das war die ganze Verabredung. Da einem die Tagesabläufe der anderen im Großen und Ganzen geläufig waren, weil sie den eigenen ähnelten, ging man dann zu einer Zeit, die man für passend hielt, vorbei und ließ sich anschauen. Passte es trotzdem nicht oder war keiner zu Hause, weil irgendetwas Unvorhergesehenes eingetreten war, schaute man halt am nächsten Tag wieder vorbei und fragte: Wo bist denn gestern herumzigeunert?, und schon gab’s Gesprächsstoff. Ja sicher, wenn man von weiterher kam, unter Umständen sogar übernachten wollte, meldete man sich vorher per Brief oder per Telegramm an: Ankomme Dienstag zwölf Uhr.
Ich habe weiter oben erzählt, dass mein Opa K., als er bereits in Rente war, öfters einmal bei uns vorbeischaute. Davor, als er noch in der Autoreparaturwerkstatt arbeitete, war er für ein gutes Jahr von Montag bis Freitag zu uns zum Mittagessen gekommen. Er kam in seiner blauen Arbeitsmontur voller Ölflecken, aber mit sauberen Händen und sauberem Gesicht und meist ohne seine Kappe. Wenn er die Thorburg betrat, erschnupperte er schon unten im Flur, was es so gab im Haus, und kommentierte es halblaut vor sich hin. Er aß fast alles, doch er mochte nicht alles, und es gab etwas, das er gar nicht mochte und nicht aß: Wer auf Gott vertraut, der braucht kein Kraut, sagte er und rührte die Krautfleckerl (viereckige Nudeln mit Speck und Kraut) nicht an. Meine Mutter schmierte ihm ein Butterbrot. Das nächste Mal, als es Krautfleckerl gab, dieses Wintergericht, das wir nicht ungern aßen, machte sie für ihren Vater ein Extrakoch: Fleckerl nur mit Speck. Der aber behauptete, allein der Geruch vom Kraut verursache ihm Kopfschmerzen. Er werde, wenn sie in Zukunft Krautfleckerl oder sonst was Krautiges machen wolle, er werde dann lieber wegbleiben. So kam es, dass meine Mutter alle Gerichte mit Kraut für die Zeit, da da Vata ihr Kostgänger war, auf die Samstage verschob, da nämlich arbeitete er nur am Vormittag und ging zum Mittagessen heim.
Ein- bis zweimal die Woche kam T.Resa zum Einkaufen ins Städtchen und schaute davor oder danach, wie’s besser passte, bei uns auf einen Kaffee vorbei. Meine Mutter freute sich über den Besuch ihrer Schwester, es gab ja stets irgendetwas zu bereden. Oft brachte T.Resa Eier mit, die guten vom Bauern Zeisl ganz hinten im Feenthal. Was sie ihr dafür schuldig sei, fragte meine Mutter, und T.Resa sagte: Nix. Meine Mutter ließ nicht locker, bitte, sie wolle die Eier bezahlen, T.Resa hätte der Bäuerin die Eier schließlich auch bezahlt. Doch ihre Schwester blieb stur und verweigerte die Annahme des Geldes mit der Begründung, meine Mutter habe ihr kürzlich dies oder das gegeben und auch kein Geld dafür nehmen wollen. Da steckte ihr meine Mutter einen Geldschein heimlich in eine Tasche – Jackentasche Manteltasche Einkaufs-tasche. Nach dem nächsten Besuch meiner Tante fand sie das Geld retour – es lag unter der Kaffeetasse, der Blumenvase oder in irgendeiner Schüssel. Wenn die Tante dann das nächste Mal da war, steckte sie ihr den Schein wieder heimlich in eine Tasche, und nach dem übernächsten Besuch der Tante fand sie ihn wieder irgendwo, womöglich erst ein paar Tage später und einmal so-gar in der Bestecklade, obwohl sie, wie sie sagte, die Tante die ganze Zeit über nicht aus den Augen gelassen hatte.
Die beiden wurden wachsamer gegeneinander und gewitzter, dachten sich immer raffiniertere Verstecke aus. So konnte sich das über Wochen hinziehen, keine der beiden wollte nachgeben. Einmal ließ sich die Tante etwas besonders Gemeines oder Lustiges, wie man’s nimmt, einfallen: Sie umarmte meine Mutter zum Abschied, was diese schon hätte stutzig machen können, denn das war im Alltag zwischen den beiden nicht üblich, und dabei steckte sie ihr das Geld zwischen die Kittelschürze und das Kleid. Später entdeckte es meine Mutter auf dem Fußboden, da schimpfte sie sehr und sagte, jetzt werde sie aber richtig zornig. So ging das: Die beiden Frauen steigerten sich immer weiter hinein. Am Anfang war es eine Art Spiel, allmählich wurde ein Wettkampf daraus und schließlich ein regelrechter Kampf – zunehmend verbissener wurden sie bei ihrem Hin und Her um die paar Schillinge. Bis T.Resa eines Tages in vollem Ernst sagte, wenn sie jetzt zu Hause das Geld wieder in einer ihrer Taschen finde, werde sie das letzte Mal bei uns gewesen sein. Da gab meine Mutter nach und nahm das Geld wieder aus der Einkaufstasche. Aber die Auseinandersetzung war damit nicht ausgestanden. Wenn T.Resa das nächste Mal kam, hatte meine Mutter einen Kuchen für sie gebacken, den packte sie ihr ein und nötigte sie, ihn heimzutragen. Verweigerte die Tante das Kuchengeschenk, wurde es bitterernst: Meine Mutter nahm die nächste Eierlieferung nicht an, ließ die Tante womöglich nicht zur Tür herein und die musste die guten Eier woanders loswerden. War es so weit gekommen, blieb die Tante eine Weile aus. Sie war beleidigt – meine Mutter aber auch, bis es nach einiger Zeit bei einem Besuch in Oma Rosas Häuschen zu einer tränenreichen Versöhnung kam.
An vielen Sonntagnachmittagen schleppte ich mich hinter meinen Eltern ins Feenthal hinein zu Oma Rosas Häuschen, wo ich mich nur noch langweilte. Wenn es schüttete oder schneite oder sehr kalt oder sehr windig war, hatten auch meine Eltern keine Lust auf diesen Hatscha (mühsamer Gang). An solchen trüben Sonntagen flohen T.Resa und Onkel F. aus der Einsamkeit des Tals ins Städtchen hinaus, und wir gingen gemeinsam in die Nachmittagsvorstellung des Stadtkinos. Oder sie kamen, wenn dort nix Gscheits gspielt wurde, zu uns und wir spielten zu viert Canasta. Bei diesem Kartenspiel erhitzte sich mein Vater oft gewaltig. Wenn er verlor, verlor er nicht selten jegliche Contenance, gebärdete sich als Wuthupf – vergleichbar dem später berühmt gewordenen HB-Männchen. Gift und Galle spuckend behauptete er, irgendei-
ner von uns habe ihn ogfeanzt (hinterhältig) hineingelegt, darum spiele er nicht weiter mit. Er warf die Karten auf den Küchentisch und ging ins vordere Zimmer, wir hörten ihn dort herumrumoren und saßen ratlos. Ein andermal wieder zeigte er sich als pedantischer I-Dipferl-Reiter (Korinthenkacker), behauptete, jemand hätte die Spielkarten nicht korrekt gemischt oder verteilt, und bestand darauf, dass sie eingesammelt und neu gemischt noch einmal verteilt wurden. Kamen wir diesem Wunsch nicht nach, spielte er zwar weiter, kehrte aber den Grantscherm (schlecht gelaunter Mensch) heraus und verdarb uns die Spielfreude. Er tyrannisierte uns – wir ließen uns tyrannisieren. Bis T.Resa eines Sonntags verkündete, mit so einem, der so einen Depscher (Knall) habe, spiele sie nicht mehr. Damit war unsere Canasta-Phase beendet. Jetzt saßen wir herum, tranken Kaffee, aßen Gugelhupf und redeten miteinander – ist ja auch nicht schlecht. Später, als wir das neue große Wohnzimmer und darin einen Fernseher hatten, kamen Tante und Onkel zum sonntäglichen Fernsehschauen. Dabei war das Fernsehen an sich die Attraktion, was gezeigt wurde, ein tschechischer Märchenfilm oder ein Tierfilm oder ein Hollywood-Film, war nicht so wichtig.
Oma Rosa kam selten zu Besuch. Nachdem sie der Franzl umgfiat ghobt hot – wobei sie ja Glück im Unglück gehabt hatte, denn der Franzl hatte sie nur umgfiat und net zammgfiat (umgefahren, nicht zusammengefahren), das heißt, er hatte sie nur gestreift und umgeworfen, war nicht über sie drübergefahren; gar nicht auszudenken, was ihr passiert wäre, hätte er dies getan, mindestens schwere Verletzungen und nicht nur die paar Erschütterungen und Kratzer und das bisschen Schock –, also: Nachdem sie der Franzl umgfiat ghobt hot, befand sie sich häufig nicht mehr so wohl und war nicht mehr so mobil. Wenn allerdings im Sommer Verwandtenbesuch aus Wien anreiste, vergaß sie ihre Wehwehchen, verlebendigte sich enorm und kam mit dem Wiener Besuch zu uns auf Besuch. Dafür machte sie sich schön. Sie zog ein luftiges Sommerkleid an, schmückte es mit einem schmalen weißen Gürtel, schminkte sich. Die Lippen rot, das Haar gewellt, die Nase gepudert, die Augenbrauen dunkel nachgezogen, so lacht sie mir aus einer Fotografie aus der Mitte der Wiener in unserem Wohnzimmer entgegen. Sie war, wie schon einmal erwähnt, modisch orientiert. In diesem Punkt wie in vielen anderen unterschied sie sich krass von meiner Großmutter Ama, der Kleidung praktisch wurscht war, und von meiner Mutter, die mehr aufs Zeitlose hielt.
Mit den Wienern begab sich Oma Rosa gern ins Städtchen, denn die bestellten sich ein Taxi für den Hin- und Rückweg. Sie waren nicht nur ein wenig gehfaul, sondern auch ein wenig verschwenderisch, wie das Leute halt so sind, bei denen das monatliche Einkommen nie wirklich fürs Auskommen reicht. Egal wie wenig sie ausgeben, wenn sie ausgehen: Es geht sich eh nie aus.
Hier muss ich mein Erzählen unterbrechen, denn diese Redewendung schreit nach einem Exkurs: